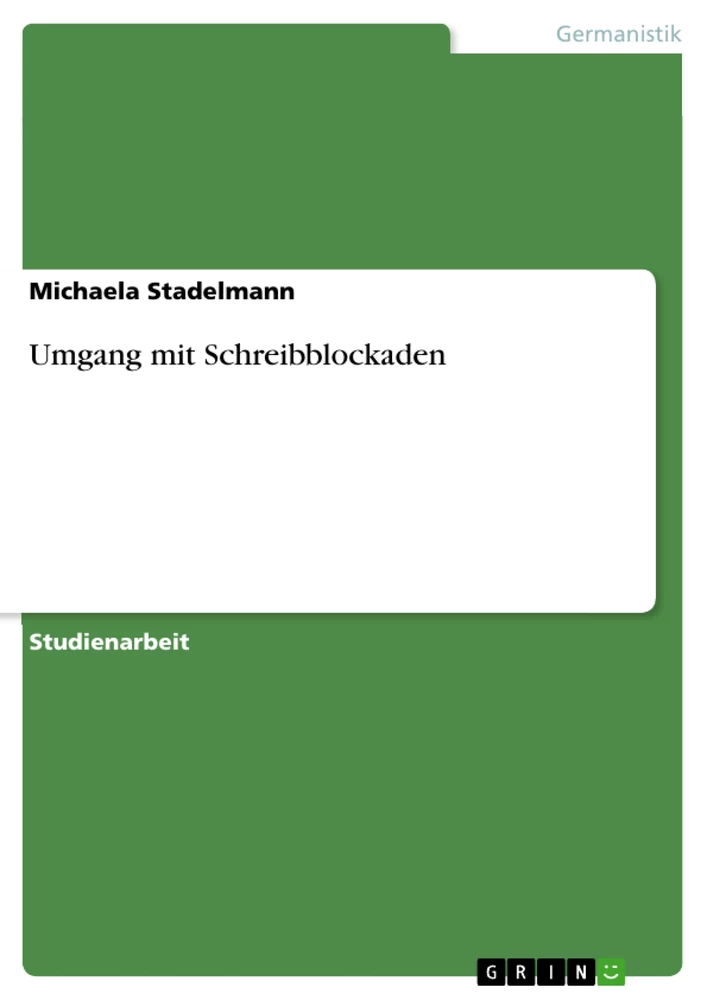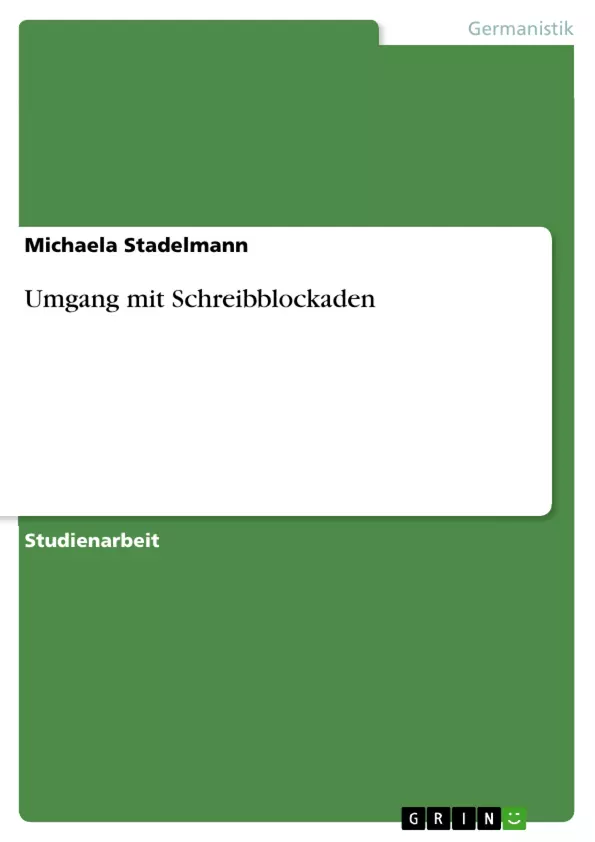In der Schule und während des Studiums können bei Schülern und Studenten Schreibblockaden auftreten, deren Auswirkungen von schlechteren Abschlüssen bis hin zu Kurs- und Studienabbrüchen reichen. In einer Studie der Universitäten Istanbul, Ankara und der Provinz Duzce wurden die Faktoren, die zu Schreibblockaden führen können, analysiert und für immanent befunden.
Im Unterschied dazu können die Gegebenheiten von Berufsautoren und -künstlern freier bestimmt werden. Man könnte daraus den voreiligen Schluss ziehen, dass in diesen Gruppen kaum oder keine Blockaden auftreten; das Gegenteil ist jedoch der Fall, wie Malcolm T. Cunningham von der Manchester Business School in seinem Resümee darlegt.
Neben den beruflich Kreativen gibt es das weite Feld der Laien. Sie unterliegen weder einer Publikationspflicht, noch müssen sie sich öffentlicher Kritik aussetzen. Trotzdem können auch Hobby-Autoren an Schreibblockaden leiden. In einer spontanen, nicht repräsentativen Umfrage auf der Social-Media-Plattform Twitter habe ich oberflächlich nach den Gründen, warum geschrieben wird, und einigen Begleiterscheinungen gefragt. Einige Widersprüche und Parallelen zu Schülern, Studenten und Berufsautoren, die Aufschluss über die Ursachen von Schreibblockaden geben können, fließen in diese Arbeit ein.
Erweitert wird das Thema durch den Blick auf die Buchbranche, die bei Berufsautoren und Laien erheblichen Einfluss auf den Schreibprozess hat und vom Dilemma mit dem weißen Blatt profitiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemdarstellung
1.2 Ziel und Aufbau
2 Definitionen
2.1 Schreibprozess
2.2 Schreib- und Lesekompetenzerwerb, Schreibkompetenzmodelle
2.3 Schreibblockade
2.4 Arbeitsstörung
3 Ursachen und Merkmale der Schreibblockade
3.1 Akademisches Schreiben
3.1.1 PISA-Studie 2018
3.1.2 Probleme des akademischen Schreibens
3.2 Schreiben als Beruf
3.2.1 Kreative Blockaden in Kunst und Wirtschaft
3.2.2 Somatome und psychiatrische Ursachen
3.3 Schreiben in der Freizeit
3.3.1 Umfrage zur Schreibblockade
3.3.2 Profit der Buchbranche
4 Überwindung der Schreibblockade
4.1 Innere Einstellung
4.2 Praktische Strukturierung des Schreibprozesses
4.3 Kreatives Schreiben
5 Zusammenfassung
6 Literatur- und Quellenverzeichnis
- Citation du texte
- Michaela Stadelmann (Auteur), 2022, Umgang mit Schreibblockaden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170970