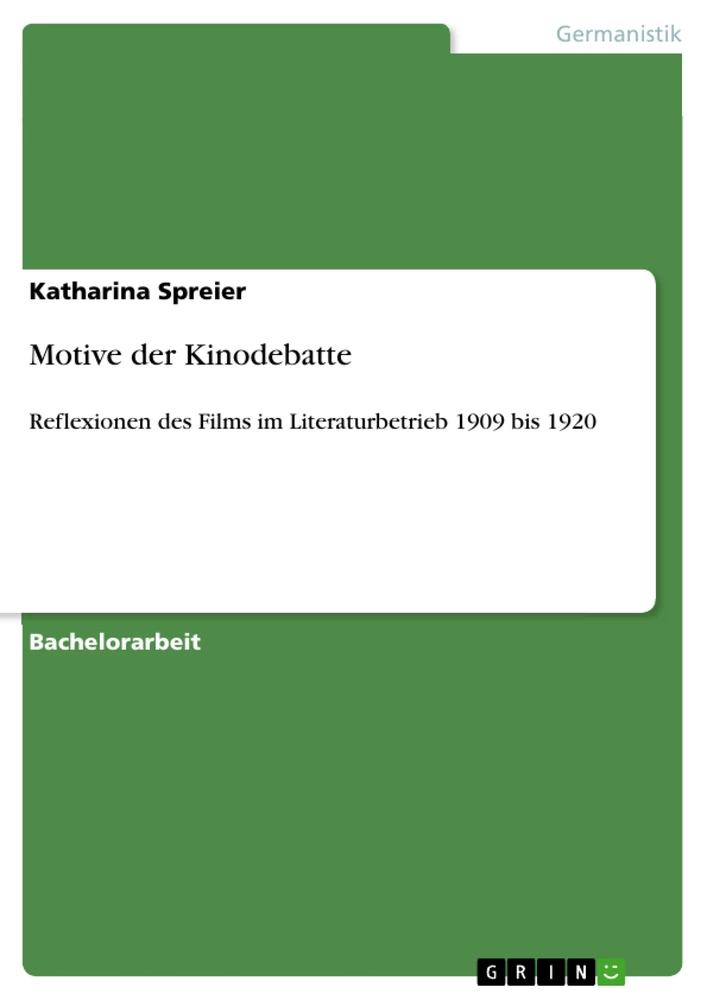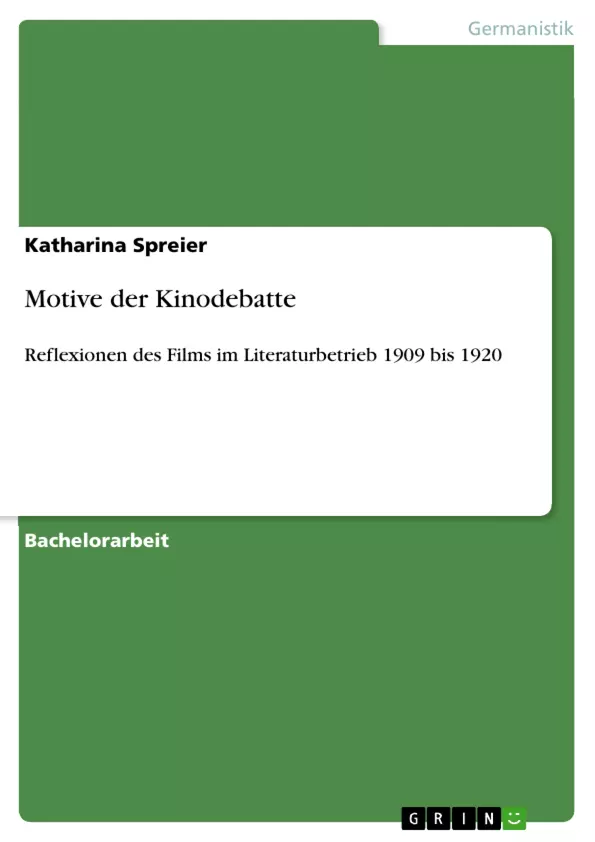Diese Arbeit soll diese Motive, unter denen diverse Autoren das Kino in der Zeit von 1909 bis etwa 1920 kritisierten, systematisch herausarbeiten und zueinander in Bezug setzen. Die zeitliche Eingrenzung wurde aus zwei Gründen in dieser Form gewählt. Erstens endet 1909 laut Anton Kaes die vorliterarische Zeit des Kinos und zweitens wurde durch den Übergang zum Langfilm und die somit veränderte Rezeptionsästhetik des Films erstmalig ernsthaft über den Kulturanspruch des Kinos als Solches diskutiert, während dies in vorigen Stufen der Auseinandersetzung mit dem neuen Medium höchstens zweitrangig war.
Die Kapitel zwei und drei werden zunächst eine theoretische Grundlage schaffen, indem im zweiten Kapitel Mediendiskurse sowie zugehörige Phänomene erklärt werden und im dritten Kapitel eine kurze filmhistorische Einordnung dargelegt wird. Im Kontext der Mediendiskurse werden außerdem die Phänomene der Medienangst, der Popularisierung und der Medienkarriere behandelt, wobei Letztere dafür verantwortlich ist, dass die Kino-Debatte heutzutage nicht nur beigelegt ist, sondern Filme zum Stellenwert eines höchsten Kulturgutes aufsteigen konnten.
Die Primärtextanalyse und Rekonstruktion des damaligen Mediendiskurses wird in zwei übergeordneten Kapiteln erfolgen. Kapitel vier ist den Aspekten der Kino-Debatte gewidmet, die man verallgemeinert als soziologisch kategorisieren kann. An dieser Stelle wird auf die Kommerzialisierung des Kinos, die Ästhetik der Großstadt und auf die Unterscheidung zwischen Hoch- und Populärkultur mit der Neigung dazu, letzterem die Legitimität abzusprechen, eingegangen werden. Im darauffolgenden Kapitel werden die ästhetischen Motive der Kino-Debatte dargestellt, wobei vor allem das durch den Übergang zum Langfilm aufgekommene Konkurrenzverhältnis zwischen Kino und Theater im Vordergrund der Analyse stehen wird. In diesem Zusammenhang wird die fehlende Sprache des Stummfilms sowie die damit einhergehende neue Visualität des Films thematisiert und schließlich die zeitgenössischen Versuche hinsichtlich einer autonomen Kinoästhetik, etwa in Form der sogenannten Autorenfilme, gesammelt, bevor die Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Mediendiskurse?
- Medienangst
- Medienkarrieren
- Popularisierung
- Der Film ab 1909 - eine historische Einordnung
- Soziologische Motive der Kinodebatte
- Die Ästhetik der Großstadt
- Hoch- versus Populärkultur
- Die Masse und der Versuch der Abgrenzung
- Die Angst vor der Trivialität
- Kunst als technische und profitable Massenware
- Ästhetische Motive der Kinodebatte
- Der Vergleich mit dem Theater
- Eine neue Bildlichkeit
- Ein internationales und demokratisches Medium
- Neue Erzählformen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Motive, die den Diskurs rund um das Kino in der Zeit von 1909 bis 1920 prägten. Sie analysiert die kritischen Auseinandersetzungen mit dem neuen Medium und seinen Einflüssen auf Gesellschaft und Kultur.
- Soziologische Aspekte der Kinodebatte, wie die Kommerzialisierung, die Ästhetik der Großstadt und die Unterscheidung zwischen Hoch- und Populärkultur
- Ästhetische Motive der Kinodebatte, insbesondere die Konkurrenz zum Theater, die spezifische Bildlichkeit des Films und die Suche nach einer eigenen Kinoästhetik
- Die Rolle der Medienangst und die Kontroverse um die Popularisierung des Films
- Die Entwicklung des Mediendiskurses und die Herausforderungen, die ein neues Medium für die Gesellschaft mit sich bringt
- Die Etablierung des Films als Kulturmedium und die Debatte um seinen Stellenwert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung bietet einen Überblick über die Themen und die Forschungsfrage der Arbeit. Sie stellt die Vielfältigkeit der Reaktionen auf das neue Medium Film dar und beschreibt die besondere Bedeutung der Kino-Debatte für die Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts.
- Was sind Mediendiskurse?: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Kino-Debatte. Es erklärt die Funktionsweise von Mediendiskursen, die verschiedenen Positionen innerhalb dieser Diskurse und die Rolle von Medienangst und Popularisierung.
- Der Film ab 1909 - eine historische Einordnung: Dieses Kapitel bietet eine kurze Übersicht über die filmhistorischen Entwicklungen, die die Entstehung der Kino-Debatte prägten. Es geht insbesondere auf den Übergang zum Langfilm und die damit einhergehende Veränderung der Rezeptionsästhetik ein.
- Soziologische Motive der Kinodebatte: Dieses Kapitel befasst sich mit den soziologischen Aspekten der Kino-Debatte. Es analysiert die Kritik an der Kommerzialisierung des Kinos, die Wahrnehmung der Großstadt als ästhetische Landschaft und die Unterscheidung zwischen Hoch- und Populärkultur.
- Ästhetische Motive der Kinodebatte: Dieses Kapitel beleuchtet die ästhetischen Motive der Kinodebatte. Es untersucht das Verhältnis von Kino und Theater, die spezifische Bildlichkeit des Films und die Versuche, eine eigene Kinoästhetik zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Kino-Debatte, Mediendiskurse, Filmgeschichte, Ästhetik, Soziologie, Kultur, Medienangst, Popularisierung, Hochkultur, Populärkultur, Kommerzialisierung, Großstadt, Theater, Bildlichkeit, Autorenfilm.
- Citar trabajo
- Katharina Spreier (Autor), 2021, Motive der Kinodebatte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1172380