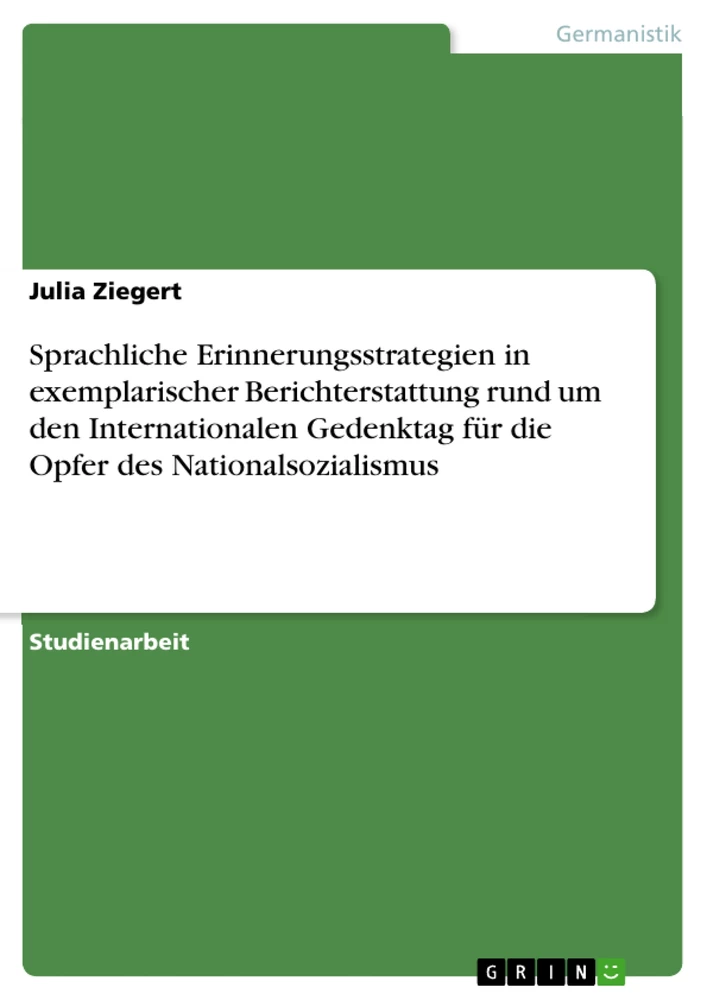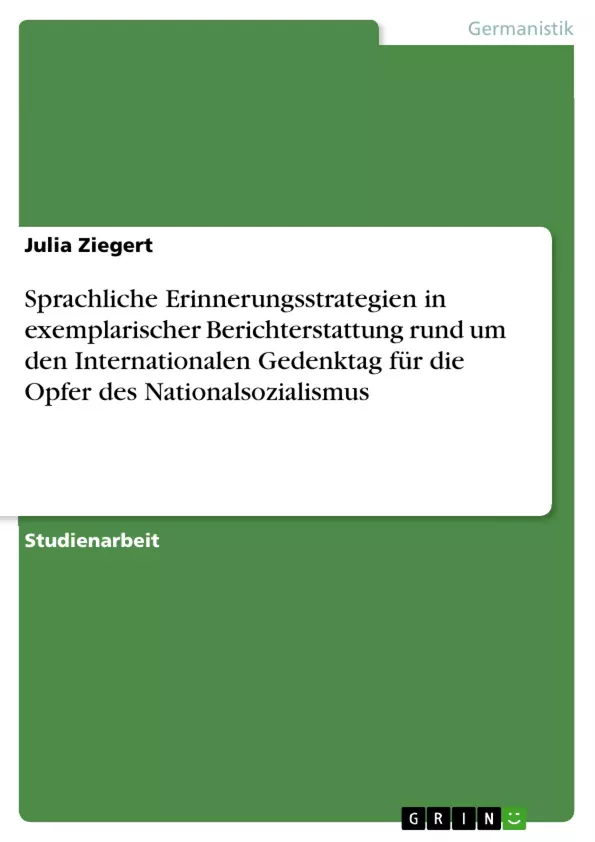Wie will Deutschland den Gräueltaten des Nationalsozialismus gedenken? Dies ist eine Frage, die in den letzten Jahren vermeintlich wieder vermehrt an Brisanz erlangt hat. Jedoch ist dies eine Problemstellung, die seit 1945 behandelt – oder eben aus geschwiegen – wird. So empfand man in Westdeutschland den Kniefall von Warschau (Warszawa) durch Willy Brandt, 60 Jahre nach dem Überfall auf Polen, durchaus noch als übertrieben und unpassend. Schließlich verspürte damals eine überwiegende Mehrheit der Deutschen keine Schuld, die eine solche Geste gerechtfertigt hätte. Heute stellt der Schriftsteller Per Leo die provokante These auf, dass in Deutschland oft maßlos in keinem Verhältnis zu Wissen und Problembewusstsein, zu Urteilskraft und Sorgfalt über den Nationalsozialismus gesprochen wird.
Um sich einen Eindruck über die Erinnerungskultur in Deutschland machen zu können, sind, neben der Betrachtung des aktuellen Zeitgeschehens natürlich auch theoriebezogene Ansätze wesentlich. Dabei prägen theoretische Strömungen u.a. zur Mentalitätsgeschichte die Einordnung von Gedächtnis und Erinnerung maßgeblich. Ferner ist zu untersuchen, in wie weit sich die Auffassung des Gedenkens gewandelt hat. Exemplarisch gehe ich im Folgenden auf den Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus ein. Hier ist insbesondere die Frage, welche Dynamik man der Vergangenheitsbewältigung bzw. der Bewahrung von Erinnerungskonstruktionen beimisst und welche Dynamiken sie tatsächlich erreicht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Annäherung an den Begriff des kulturellen Gedächtnisses
- Individuelle und kollektive Vergangenheitskonstruktionen
- Das individuelle Gedächtnis
- Das kollektive Gedächtnis
- Schlagwortanalyse nach Fritz Hermanns
- Erinnerungsort / Traumatischer Ort: Auschwitz als Symbol für den Holocaust
- Erinnerungsort Gedenkstätte / Traumatischer Ort
- Institutionalisierung und Repräsentation
- Analyse
- Text 1: Herzog: Aus der Erinnerung muß immer wieder lebendige Zukunft werden
- Text 2: Auschwitz
- Text 3: Knobloch: Ewiggestrige haben ihren Kampf vor 76 Jahren verloren...
- Analyseergebnis
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die sprachlichen Erinnerungsstrategien in der Berichterstattung rund um den Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Dabei geht sie der Frage nach, wie Deutschland mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus umgeht und welche Rolle die Erinnerungskultur in diesem Kontext spielt.
- Kulturelles Gedächtnis und seine verschiedenen Formen
- Der Erinnerungsort Auschwitz als Symbol für den Holocaust
- Sprachliche Signalwörter in der Berichterstattung
- Dynamik der Vergangenheitsbewältigung
- Die Rolle des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Sie beleuchtet die Brisanz der Frage nach dem Umgang mit der Vergangenheit in Deutschland und die unterschiedlichen Denkansätze zur Erinnerungskultur.
Kapitel 2 führt in das Konzept des kulturellen Gedächtnisses ein und unterscheidet zwischen individuellen und kollektiven Vergangenheitskonstruktionen. Es beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Gedächtnisses, vom biologischen bis zum symbolisch vermittelten Gedächtnis, und erklärt die Relevanz des individuellen und kollektiven Gedächtnisses für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen.
Kapitel 3 thematisiert den Erinnerungsort Auschwitz als Symbol für den Holocaust. Es beleuchtet die Bedeutung der Gedenkstätte als Ort des Erinnerns und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Zudem wird die Institutionalisierung und Repräsentation des Holocaust im öffentlichen Raum betrachtet.
Kapitel 4 analysiert drei thematisch passende Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die exemplarisch für die Berichterstattung rund um den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus stehen. Diese Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Signalwörter im Rahmen des internationalen Gedenktages für die Opfer des Holocaust.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den zentralen Begriffen wie kulturelles Gedächtnis, Erinnerungskultur, Erinnerungsorte, Traumatischer Ort, Sprachliche Erinnerungsstrategien, Nationalsozialismus, Holocaust, Internationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, Schlagwortanalyse und Gedächtnispolitische Debatten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind sprachliche Erinnerungsstrategien?
Es handelt sich um gezielte sprachliche Mittel und Signalwörter in der Berichterstattung, die dazu dienen, bestimmte Bilder der Vergangenheit im kollektiven Gedächtnis zu bewahren oder zu formen.
Was ist der Unterschied zwischen individuellem und kollektivem Gedächtnis?
Das individuelle Gedächtnis ist biologisch an die Person gebunden, während das kollektive Gedächtnis durch Symbole, Texte und Gedenktage einer ganzen Gesellschaft geteilt wird.
Warum gilt Auschwitz als zentraler „Erinnerungsort“?
Auschwitz ist zum universellen Symbol für den Holocaust geworden und dient als institutionalisierter Ort der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Gräueltaten.
Wie hat sich die deutsche Erinnerungskultur seit 1945 gewandelt?
Die Arbeit untersucht den Wandel von der frühen Verdrängung (z. B. Kritik am Kniefall von Warschau) hin zur heutigen, oft intensiven öffentlichen Auseinandersetzung.
Welche Rolle spielt der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus?
Der Gedenktag dient der Bewahrung von Erinnerungskonstruktionen und soll sicherstellen, dass aus der Erinnerung eine „lebendige Zukunft“ wird.
- Quote paper
- Julia Ziegert (Author), 2021, Sprachliche Erinnerungsstrategien in exemplarischer Berichterstattung rund um den Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1173986