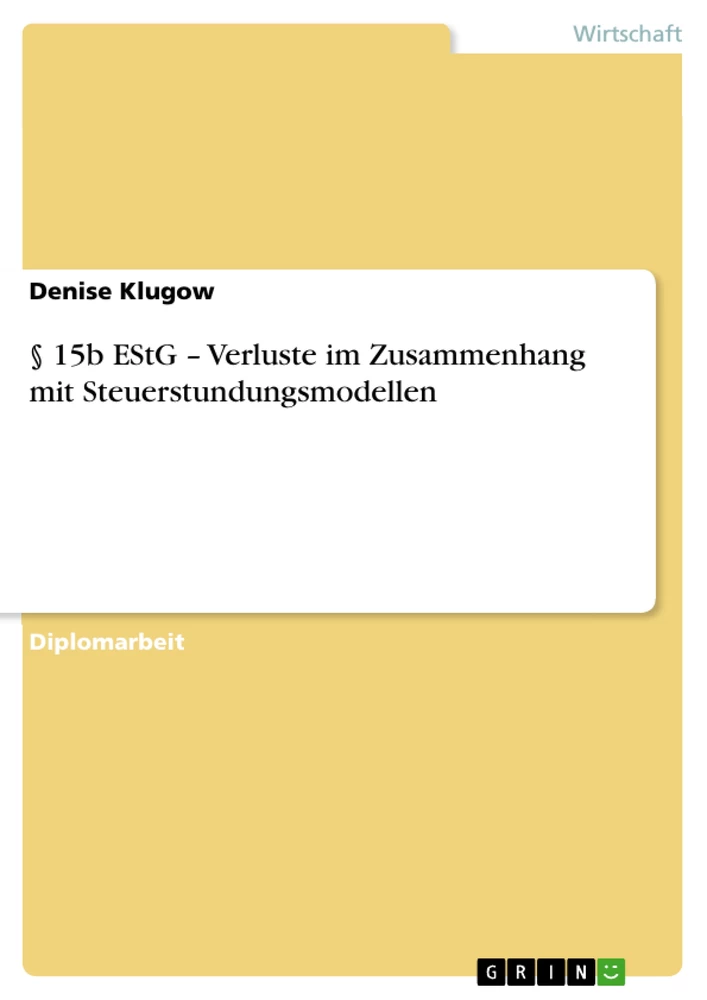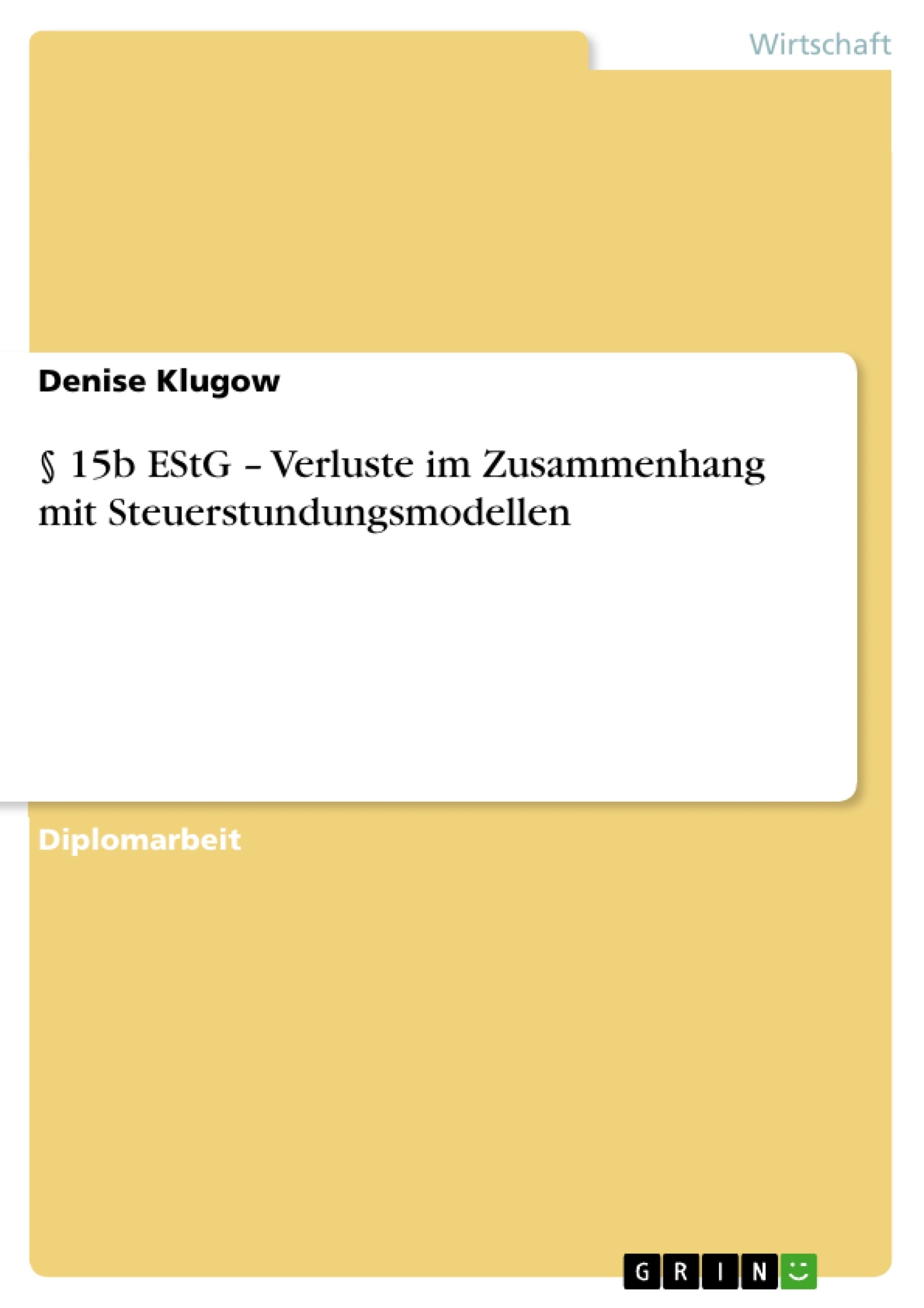Verlustzuweisungen durch Steuersparmodelle stellen für den Staat schon lange ein großes Problem dar, da sie die Staatseinkünfte mindern und das Prinzip der Steuergerechtigkeit verletzen. Findige Steuerpflichtige beteiligten sich an solchen Modellen primär, um ihr zu versteuerndes Einkommen künstlich zu mindern, anstatt es zu vermehren. Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, derartigen Steuersparmodellen entgegenzuwirken. Neben anderen Verlustverrechnungsbeschränkungen, wie z.B. § 2a und § 15a EStG, wurde im Jahre 1999 § 2b EStG eingeführt. Der sog. Fallenstellerparagraph hatte das erklärte Ziel, längerfristig zur Verminderung unerwünschter Steuersparmodelle beizutragen. All diese Regelungen haben jedoch nicht vermeiden können, dass aus Sicht des Gesetzgebers wirtschaftlich fragwürdige Investitionen mit hohen Anfangsverlusten weiterhin angeboten und vorgenommen wurden, so dass die Verrechnung der daraus entstandenen Verluste mit anderen Gewinnen zu Steuerstundungen führten. Aus diesem Grund wurde mit dem Gesetz zur Beschränkung der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen vom 22.12.2005 § 15b EStG eingeführt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich umfassend mit dem § 15b EStG und dessen praktischer Bedeutung. Ziel der Untersuchung ist es, zu prüfen, inwieweit § 15b EStG betriebswirtschaftlich wenig sinnvolle Investitionen die nur aufgrund der damit verbundenen steuerlichen Vorteile getätigt werden, verhindern kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundlegendes zum § 15b EStG
- I. Die Vorschrift als Fortentwicklung des § 2b EStG
- II. Zweck
- III. Anwendungsbereich
- a. Sachlicher Anwendungsbereich
- b. Persönlicher Anwendungsbereich
- c. Zeitlicher Anwendungsbereich
- d. Nichtanwendung des § 15b EStG
- IV. Verhältnis zu anderen Verlustverrechnungsbeschränkungsvorschriften
- a. Verhältnis zu § 15a EStG
- b. Verhältnis zu den übrigen Verlustverrechnungsbeschränkungen
- V. Rechtsfolgen
- VI. Verfassungsrechtliche Aspekte
- a. Bestimmtheitsgebot
- b. Objektives Nettoprinzip
- c. Rückwirkungsverbot
- C. Der Tatbestand des § 15b EStG
- I. Verlustverrechnungsbeschränkung (§ 15b I EStG)
- a. Allgemeines
- b. Einkunftsquelle
- c. Beispiel zur Auswirkung der Verlustverrechnungsbeschränkung
- II. Steuerstundungsmodell (§ 15b II EStG)
- a. Definition Steuerstundungsmodell
- b. Modellhafte Gestaltung
- c. Erzielung steuerlicher Vorteile in Form negativer Einkünfte
- d. Kapitalmäßige Beteiligung ohne Interesse an einem Einfluss auf die Geschäftsführung
- III. Nichtaufgriffsgrenze (§ 15b III EStG)
- a. Die Anfangsphase
- b. Die prognostizierten Verluste
- c. Das maßgebende Kapital
- d. Beispiel zur Berechnung der 10%-Grenze
- IV. Verfahrensrechtliche Regelungen (§ 15b IV EStG)
- V. Zusammenfassung
- D. Beispiele ausgewählter Steuerstundungsmodelle
- I. Fonds
- a. Geschlossene Fonds
- 1. Filmfonds
- 2. Geschlossene Immobilienfonds
- 3. Schiffsfonds
- 4. Neue-Energien-Fonds
- 5. Wertpapierhandelsfonds
- b. Mehrstöckige Personengesellschaften
- c. Zebragesellschaften
- II. Einzelinvestitionen
- a. Immobilieninvestitionen im Rahmen des § 15b EStG
- 1. Bauträgergestaltungen
- 2. Erwerb von Sanierungsobjekten und denkmalgeschützten Gebäuden mit Modernisierungszusage
- b. Rentenversicherungsmodelle gegen fremdfinanzierten Einmalbeitrag
- III. Fazit
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der steuerlichen Behandlung von Verlusten im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen im Rahmen des § 15b EStG. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen des § 15b EStG, untersucht die Funktionsweise von Steuerstundungsmodellen und präsentiert Beispiele für gängige Modelle. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des § 15b EStG zu vermitteln.
- Rechtliche Grundlagen des § 15b EStG
- Funktionsweise von Steuerstundungsmodellen
- Beispiele für gängige Steuerstundungsmodelle
- Wirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen des § 15b EStG
- Verfassungsrechtliche Aspekte des § 15b EStG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verlustverrechnungsbeschränkungen im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen ein und erläutert die Relevanz des § 15b EStG. Kapitel B befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen des § 15b EStG, inklusive seiner historischen Entwicklung, seinem Zweck, seinem Anwendungsbereich und seinem Verhältnis zu anderen Vorschriften. Kapitel C widmet sich dem Tatbestand des § 15b EStG und analysiert die Verlustverrechnungsbeschränkung, die Steuerstundungsmodelle und die Nichtaufgriffsgrenze. Kapitel D präsentiert Beispiele für ausgewählte Steuerstundungsmodelle, wie z.B. Fonds, Einzelinvestitionen und Rentenversicherungsmodelle. Das Kapitel beleuchtet die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten und die Anwendung des § 15b EStG in diesen Fällen.
Schlüsselwörter
§ 15b EStG, Steuerstundungsmodelle, Verlustverrechnungsbeschränkung, Verlustverrechnung, Einkunftsquelle, Nichtaufgriffsgrenze, Fonds, Immobilieninvestitionen, Rentenversicherungsmodelle, Bauträgergestaltungen, Sanierungsobjekte, denkmalgeschützte Gebäude, Gestaltungsmöglichkeiten, Rechtsfolgen, Verfassungsrechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der Paragraph § 15b EStG?
Er regelt die Beschränkung der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit sogenannten Steuerstundungsmodellen, um künstliche Einkommensminderungen zu verhindern.
Warum wurde § 15b EStG im Jahr 2005 eingeführt?
Der Gesetzgeber wollte damit wirtschaftlich fragwürdige Investitionen unterbinden, die primär zur Erzielung steuerlicher Vorteile durch hohe Anfangsverluste getätigt wurden.
Was versteht man unter einem Steuerstundungsmodell laut Gesetz?
Es handelt sich um modellhafte Gestaltungen, bei denen die Erzielung steuerlicher Vorteile in Form negativer Einkünfte im Vordergrund steht, oft bei kapitalmäßiger Beteiligung ohne Geschäftsführungseinfluss.
Welche Rolle spielt die 10%-Grenze bei § 15b EStG?
Die Nichtaufgriffsgrenze besagt, dass keine modellhafte Gestaltung vorliegt, wenn die prognostizierten Verluste in der Anfangsphase 10 % des maßgebenden Kapitals nicht übersteigen.
Welche Arten von Fonds sind häufig von dieser Regelung betroffen?
Typische Beispiele sind geschlossene Fonds wie Filmfonds, Schiffsfonds, Immobilienfonds und Neue-Energien-Fonds.
Wie verhält sich § 15b zu § 15a EStG?
Die Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen diesen beiden Verlustverrechnungsbeschränkungen und klärt deren jeweilige Anwendungsbereiche.
- Quote paper
- Denise Klugow (Author), 2008, § 15b EStG – Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117484