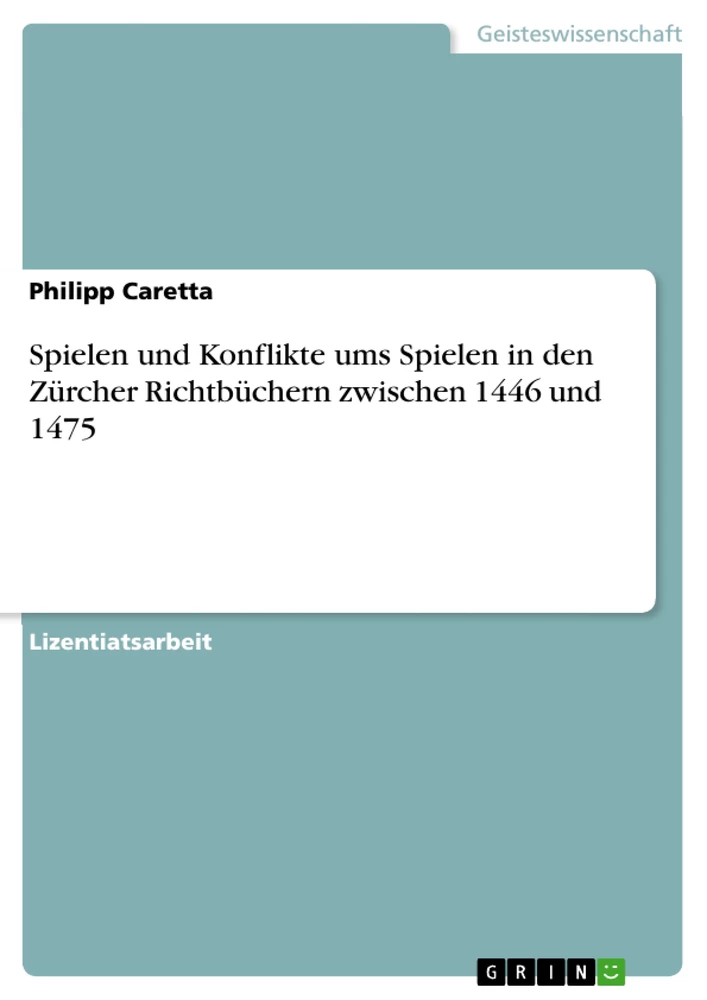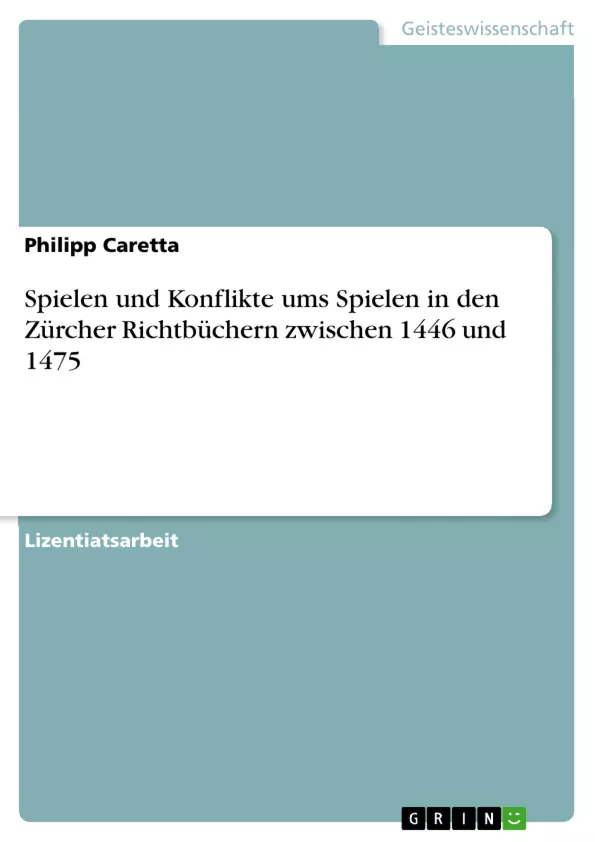In dieser Lizentiatsarbeit sollen das Spielen und Konflikte ums Spielen in den Zürcher Richtbüchern von 1446 bis 1475 untersucht werden. Hier scheint mir zuerst einmal eine Definition von Spielkonflikt notwendig. Darunter verstehe ich einen Rechtsfall, zu dem sämtliche Klagen, Gegen- und Nebenklagen sowie Nachgänge gezählt werden, die alle auf die gleiche Streitursache innerhalb einer Spielsituation zurückzuführen sind. Das gilt auch, wenn sich Nichtspieler einschalteten, indem sie zum Beispiel in ein Spiel dreinredeten oder zwischen zwei Parteien schlichten wollten, wodurch erst der eigentliche Rechtsstreit entstand. Natürlich gibt es auch Konflikte, die sich lediglich aus einer Klage oder – wenn eine obrigkeitliche Spielverordnung missachtet wurde – aus einem Nachgang ergaben. Vereinzelt sind in den Zürcher Rechtsfällen auch nur fragmentarische Zeugenaussagen aufgezeichnet. Sofern diese ebenfalls auf einen Streit zwischen Personen oder auf einen Konflikt mit der Obrigkeit hinweisen, werden sie ebenfalls als Spielkonflikt eingestuft.
Die zeitliche Eingrenzung ergibt sich daraus, dass zu dem Zeitpunkt, als ich mit dieser Arbeit begann, die Jahrgänge 1450 bis 1470 der Zürcher Steuer- und Richtbücher sowie Eingewinnerverzeichnisse im Rahmen des Nationalfondprojektes von Herrn Professor Gilomen Soziale Beziehungen im Alltag einer spätmittelalterlichen Stadt – Zürich im 15. Jahrhundert bereits transkribiert und in Form einer Projektdatenbank zur prosopographischen Recherche im Internet aufgeschaltet worden waren. Zwar waren die Jahre 1471-1475 noch nicht in die Datenbank integriert, aber schon transkribiert worden; speziell den Richtbüchern der Jahre 1446-1449 habe ich mich selber angenommen, was schliesslich den oben gewählten Zeitrahmen erklärt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- 1. Einführung
- 2. Themaeingrenzung und Fragestellung
- 3. Quellen – methodische Erläuterungen – Aufbau
- 4. Forschungsstand
- B. Spielen und Konflikte ums Spielen in den Zürcher Richtbüchern
- 5. Regelungen zum Spielen im spätmittelalterlichen Zürich
- 5.1 Spielverordnungen im Zürcher Richtebrief
- 5.2 Spielverordnungen in den Zürcher Stadtbüchern
- 6. Die Spiele in den Zürcher Rats- und Richtbüchern
- 6.1 Brettspiele
- 6.1.1 Spil im brett
- 6.1.2 Schachzabel
- 6.2 Würfelspiele
- 6.2.1 Spil/spilen
- 6.2.2 Würfeln
- 6.2.3 Im brett schit spilen
- 6.2.4 Passen
- 6.2.5 Fünflen
- 6.3 Kartenspiele
- 6.3.1 Unbekannte Kartenspiele
- 6.3.2 Inschlachen/Uff dem kartenspil lupffen
- 6.3.3 Zuo der nünden karten
- 6.3.4 Drissgen
- 6.3.5 Puren
- 6.3.6 Russen
- 6.3.7 Buffen
- 6.3.8 Mit der karten stechen
- 6.3.9 Zuo der achtenden karten
- 6.3.10 Sibendlis
- 6.3.11 Alrunen
- 6.3.12 Hunderten oder Eins und Hundert
- 6.3.13 Under faren
- 6.4 Bewegungsspiele
- 6.4.1 Kegeln
- 6.4.2 Schiessen
- 6.4.3 Steinstossen
- 6.4.4 Ballspiel
- 6.5 Diverse und ungeklärte Spiele
- 6.5.1 Wetten
- 6.5.2 Lüschlis spilen
- 6.5.3 Wis und schwartz
- 7. Die Spielorte
- 7.1 Zünfte und der Gesellen Trinkstuben
- 7.2 Wirtshäuser und Gesellschaftsstuben
- 7.3 Spielorte im Freien
- 7.4 Privathäuser
- 7.5 Verschiedene Lokalitäten
- 7.6 Nicht identifizierte Spielorte
- 7.7 Spielordnungen auf den Trinkstuben
- 8. Die Spieler
- 8.1 Anzahl und Schichtzugehörigkeit
- 8.2 Berufszugehörigkeit
- 8.3 Zusammensetzung der Spielrunden
- 9. Die Spielkonflikte
- 9.1 Konfliktstoffe
- 9.2 Die Austragung der Spielkonflikte
- 9.3 Das Zürcher Ratsgericht im Umgang mit Spiel und Delinquenz
- Spielverordnungen der Zürcher Obrigkeit und deren Absichten
- Erlaubte und verbotene Spiele im spätmittelalterlichen Zürich
- Spielorte und Spieler im Kontext der Zürcher Rechtsfälle
- Konflikte im Zusammenhang mit dem Spielen und deren Austragung
- Das Zürcher Ratsgericht im Umgang mit Spiel und Delinquenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lizentiatsarbeit beschäftigt sich mit dem Spielen und den daraus resultierenden Konflikten in den Zürcher Richtbüchern zwischen 1446 und 1475. Die Arbeit untersucht die Spielverordnungen der Zürcher Obrigkeit und deren Absichten sowie die erlaubten und verbotenen Spiele. Sie beleuchtet die Spielorte und die Spieler sowie die Art und Weise, wie Konflikte im Zusammenhang mit dem Spielen ausgetragen wurden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Lizentiatsarbeit vor und erläutert die Fragestellung, die Quellen, die methodischen Erläuterungen und den Aufbau der Arbeit. Der erste Teil befasst sich mit den Regelungen zum Spielen im spätmittelalterlichen Zürich und beleuchtet die Spielverordnungen im Zürcher Richtebrief und in den Zürcher Stadtbüchern.
Der zweite Teil widmet sich den verschiedenen Spielen, die in den Zürcher Rats- und Richtbüchern erwähnt werden. Es werden Brettspiele, Würfelspiele, Kartenspiele, Bewegungsspiele und diverse ungeklärte Spiele vorgestellt.
Der dritte Teil untersucht die Spielorte, wobei Zünfte und Gesellen Trinkstuben, Wirtshäuser und Gesellschaftsstuben, Spielorte im Freien, Privathäuser, verschiedene Lokalitäten, nicht identifizierte Spielorte und Spielordnungen auf den Trinkstuben beleuchtet werden.
Der vierte Teil beschäftigt sich mit den Spielern, wobei die Anzahl und Schichtzugehörigkeit, die Berufszugehörigkeit und die Zusammensetzung der Spielrunden analysiert werden.
Der fünfte Teil befasst sich mit den Spielkonflikten, wobei die Konfliktstoffe, die Austragung der Spielkonflikte und der Umgang des Zürcher Ratsgerichts mit Spiel und Delinquenz untersucht werden.
Schlüsselwörter
Spätmittelalter, Zürich, Richtbücher, Spiel, Spielverordnungen, Spielkonflikte, Spielorte, Spieler, Zürcher Ratsgericht, Delinquenz, Recht, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Zürcher Richtbücher?
Die Richtbücher sind historische Quellen des 15. Jahrhunderts aus Zürich, in denen Rechtsfälle, Klagen und Urteile des Ratsgerichts aufgezeichnet wurden.
Was versteht man unter einem „Spielkonflikt“?
Ein Rechtsstreit, der direkt aus einer Spielsituation resultiert, etwa durch Klagen über Betrug, Streitigkeiten beim Würfeln oder Konflikte mit der Obrigkeit wegen verbotener Spiele.
Welche Spiele waren im spätmittelalterlichen Zürich verbreitet?
Erwähnt werden Brettspiele (Schach), Würfelspiele, zahlreiche Kartenspiele (z.B. Russen, Buffen) sowie Bewegungsspiele wie Kegeln und Steinstoßen.
Wo wurde in Zürich im 15. Jahrhundert gespielt?
Typische Spielorte waren Zunfthäuser, Trinkstuben der Gesellen, Wirtshäuser, aber auch Privathäuser und öffentliche Plätze im Freien.
Warum erließ die Stadt Spielverordnungen?
Die Obrigkeit wollte exzessives Glücksspiel, Gotteslästerung und soziale Unruhen eindämmen und die öffentliche Ordnung sowie die moralische Disziplin wahren.
Wer waren die typischen Spieler in diesen Konflikten?
Die Spieler stammten aus verschiedenen Schichten, wobei Handwerker und Gesellen in den Trinkstuben besonders häufig in den Rechtsfällen auftauchen.
- Arbeit zitieren
- lic. phil. I Philipp Caretta (Autor:in), 2001, Spielen und Konflikte ums Spielen in den Zürcher Richtbüchern zwischen 1446 und 1475, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117500