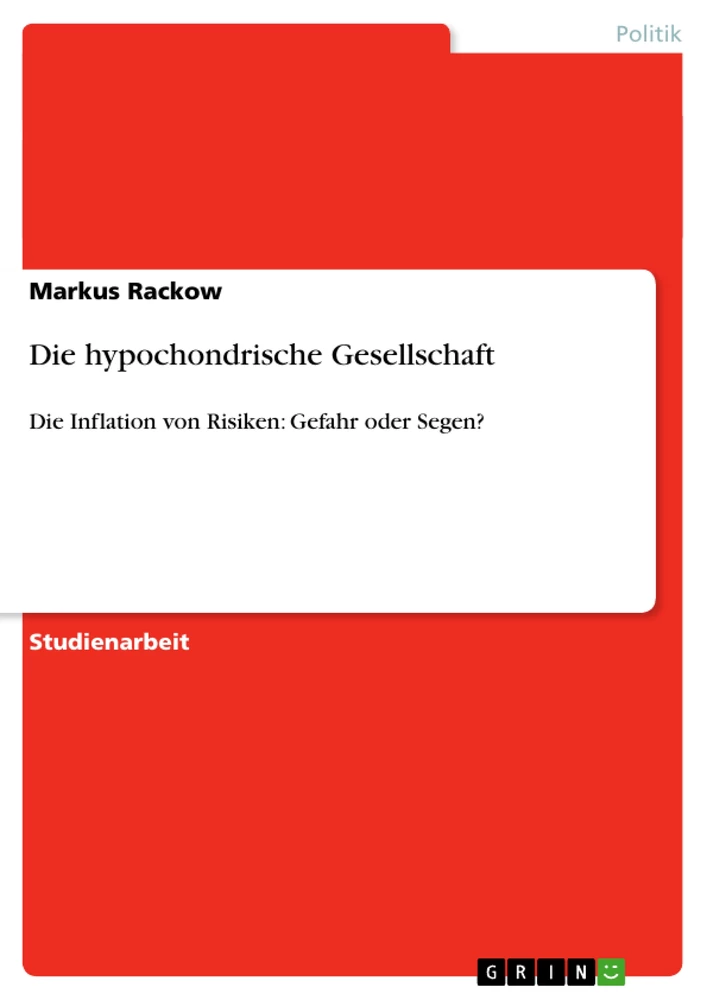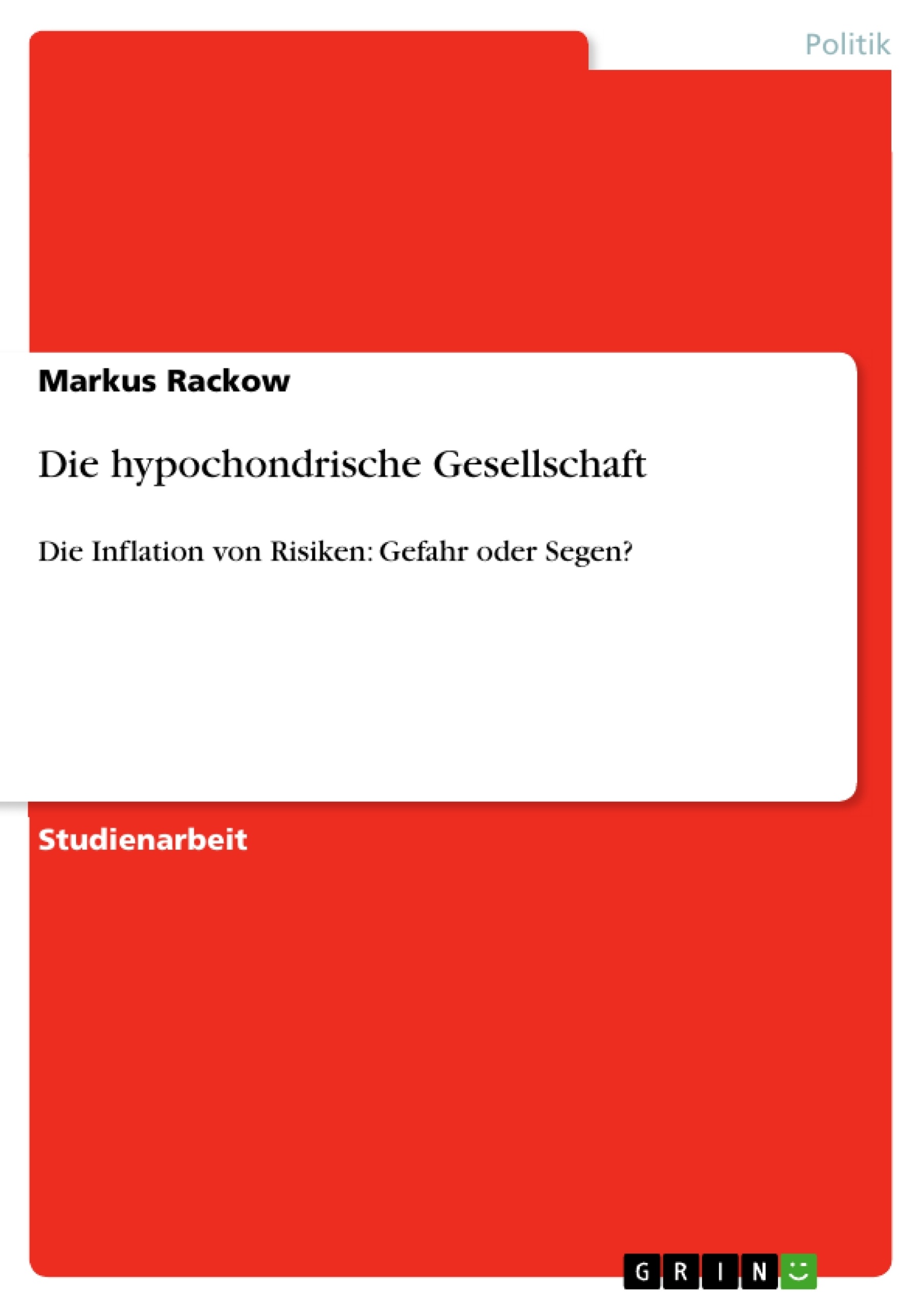Schon ein Blick in die Tagszeitungen offenbart einen ungemein ausgeprägten Risikofetischismus: über den allseits präsenten Klimawandel, Hollywoodfilme füllende Meteoriteneinschläge oder Atomwaffen als Risiko eines nuklearen Winters, Konjunkturrisiken, das Risiko der Altersarmut durch eine bis 2050 (man beachte: mehr als ein halbes Menschenleben!) prognostizierte demographische „Fehlentwicklung“ und Krise des Rentensystems, Atomreaktorunfälle á la Tschernobyl, das im Festtagsbraten lauernde BSE, H5-N1 alias „Vogelgrippe“, das mit gewisser Wahrscheinlichkeit von Mensch zu Mensch übertragbar ist, das unsichtbare Feinstaubrisiko, mit hoher Wahrscheinlichkeit geplanten Terroranschlägen, bis hin zu dem Ozonloch oder frittierten Kartoffelprodukten, die das Krebsrisiko steigen lassen – „eine Sau nach der anderen wird durchs Dorf getrieben“. Die offensichtliche Bedeutung von Risiken hat jedoch tiefer liegende Ursachen als nur den Hang zu Negativschlagzeilen, dem der Massenjournalismus seit jeher und zunehmend auch die Wissenschaft unterliegen. Den Sendern steht eine Masse an lauschenden Empfängern gegenüber. Risiko als Begriff, „den man heute bei jeder Gelegenheit benutzt“, scheint vielmehr ein Nebenprodukt des beständigen Seinsprozesses unserer Gesellschaft geworden zu sein, die ich als hypochondrisch zu entlarven versuchen werde, und die Veränderungen in einem allseits internalisierten Definitions- und Wahrnehmungsschema als Risiko interpretiert. Wie kam es zum Risikobegriff (I)? Steigt die Zahl der Risiken angesichts Zunahme an Gefahren (ungleich Risiko!) oder durch dem gesellschaftlichen System inhärente Neigungen und Dispositionen (I.2 & I.3)? Welche Mechanismen werden bemüht, um welchen Typen von Risiken zu begegnen oder vorzubeugen (II)? Wie hängen traditionelle und evolutionäre (Zivilisations-)Risiken zusammen? Ist die inflationäre Konstruktion von Risiken ein Segen, weil wir so Katastrophen abwenden, oder eine Gefahr, weil der Risikodiskurs Ängste schafft, die gesellschaftliches Leben und Werken lähmen (III)? Zu klären ist also, ob und inwieweit nicht Risiken, sondern das Konzept Risiko, durch das Veränderungsprozesse (die nicht gleich Gefahren sein müssen) definiert werden, Konsequenzen für das Handeln hat (III) und wieso dieses Konzept zur Erklärung herangezogen wird (I).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Vom Fatum der Antike zum Risiko der hypochondrischen Gesellschaft
- 1. Die historische Genese des Begriffs „Risiko“
- 2. Konservatismus als Nährboden der Risikokonstruktion.
- 3. Die hypochondrische Gesellschaft.
- II. Risikotypen und Mechanismen der Risikobewältigung
- 1. Traditionelle, versicherbare Risiken
- 2. Evolutionäre Risiken als Herausforderung für die Risikobewältigung
- 3. Theorie der Ableitbarkeit evolutionärer Risiken.
- III. Folgen und Chancen der Risikoinflation
- 1. Übersteigerter Risikodiskurs: Gefahr oder Segen?
- 2. Chance als alternatives Deutungsmuster?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des Risikokonzepts in der modernen Gesellschaft und beleuchtet die Gründe für die scheinbare Inflation von Risiken in unserer Zeit. Sie analysiert die historischen Wurzeln des Risikobegriffs, die Rolle des Konservatismus bei der Konstruktion von Risiken und die Auswirkungen der Risikoinflation auf das gesellschaftliche Leben.
- Die historische Entwicklung des Risikobegriffs von der Antike bis zur Moderne
- Der Einfluss des Konservatismus auf die Wahrnehmung und Konstruktion von Risiken
- Die Rolle der Wissenschaft und der Medien bei der Verbreitung von Risikodiskursen
- Die Auswirkungen der Risikoinflation auf das gesellschaftliche Handeln und die Entscheidungsfindung
- Die Frage nach den Chancen und Gefahren der Risikoinflation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die These auf, dass unsere Gesellschaft von einem ausgeprägten Risikofetischismus geprägt ist, der sich in den Medien und im öffentlichen Diskurs widerspiegelt. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen dieser Risikoinflation und stellt die zentrale Frage, ob das Konzept Risiko zu einem Instrument der Angst und Lähmung geworden ist.
I. Vom Fatum der Antike zum Risiko der hypochondrischen Gesellschaft
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Genese des Begriffs „Risiko“ und zeigt, wie sich der Umgang mit Gefahren im Laufe der Zeit verändert hat. Es wird die Rolle des Konservatismus bei der Risikokonstruktion und die Entwicklung der „hypochondrischen Gesellschaft“ diskutiert.
II. Risikotypen und Mechanismen der Risikobewältigung
Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Risikotypen und den Mechanismen, die zur Bewältigung von Risiken eingesetzt werden. Es werden traditionelle, versicherbare Risiken von evolutionären Risiken abgegrenzt und die Theorie der Ableitbarkeit evolutionärer Risiken vorgestellt.
III. Folgen und Chancen der Risikoinflation
Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen der Risikoinflation auf das gesellschaftliche Leben und die Entscheidungsfindung. Es werden die Chancen und Gefahren des Risikodiskurses diskutiert und die Frage nach alternativen Deutungsmustern gestellt.
Schlüsselwörter
Risiko, Risikoinflation, hypochondrische Gesellschaft, Konservatismus, Evolutionäre Risiken, Risikodiskurs, Angst, Lähmung, Chancen, Gefahren, Wissenschaft, Medien, Versicherung, Fatum, Moderne, Antike.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer "hypochondrischen Gesellschaft"?
Eine Gesellschaft, die durch einen ausgeprägten Risikofetischismus geprägt ist und dazu neigt, jeden Veränderungsprozess als potenzielle Gefahr oder Risiko zu interpretieren.
Wie hat sich der Begriff "Risiko" historisch entwickelt?
Die Arbeit zeichnet den Weg vom antiken Schicksalsglauben (Fatum) bis hin zum modernen, inflationär gebrauchten Risikokonzept nach, das heute in allen Lebensbereichen präsent ist.
Was ist der Unterschied zwischen Gefahr und Risiko?
Während Gefahren oft äußere Bedrohungen sind, wird Risiko als ein gesellschaftliches Konstrukt und Nebenprodukt des Seinsprozesses verstanden, das durch interne Wahrnehmungsschemata definiert wird.
Welche Rolle spielen Medien und Wissenschaft beim Risikodiskurs?
Beide tragen zur "Risikoinflation" bei, indem sie ständig neue Themen (Klimawandel, BSE, Terroranschläge) als akute Risiken thematisieren, was oft zu kollektiven Ängsten führt.
Was sind "evolutionäre Risiken"?
Im Gegensatz zu traditionellen, versicherbaren Risiken sind evolutionäre Risiken (Zivilisationsrisiken) schwerer greifbar und fordern neue Mechanismen der gesellschaftlichen Bewältigung heraus.
Ist der übersteigerte Risikodiskurs eher nützlich oder schädlich?
Die Arbeit diskutiert, ob er hilft, Katastrophen abzuwenden, oder ob er primär Ängste schafft, die das gesellschaftliche Handeln und die Innovationskraft lähmen.
- Citar trabajo
- Markus Rackow (Autor), 2008, Die hypochondrische Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117515