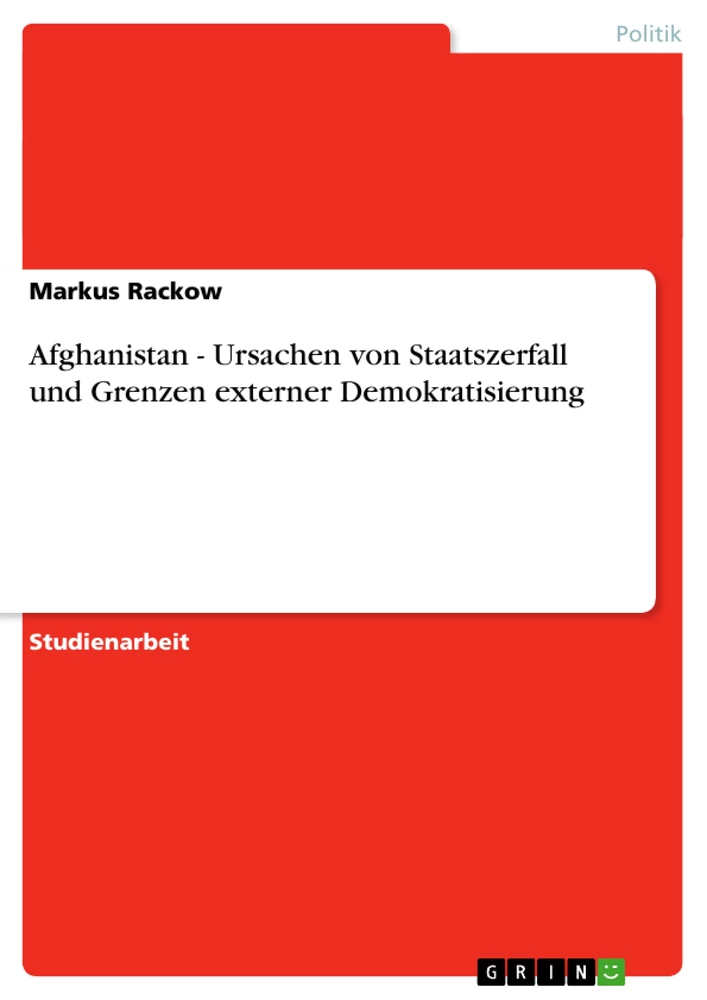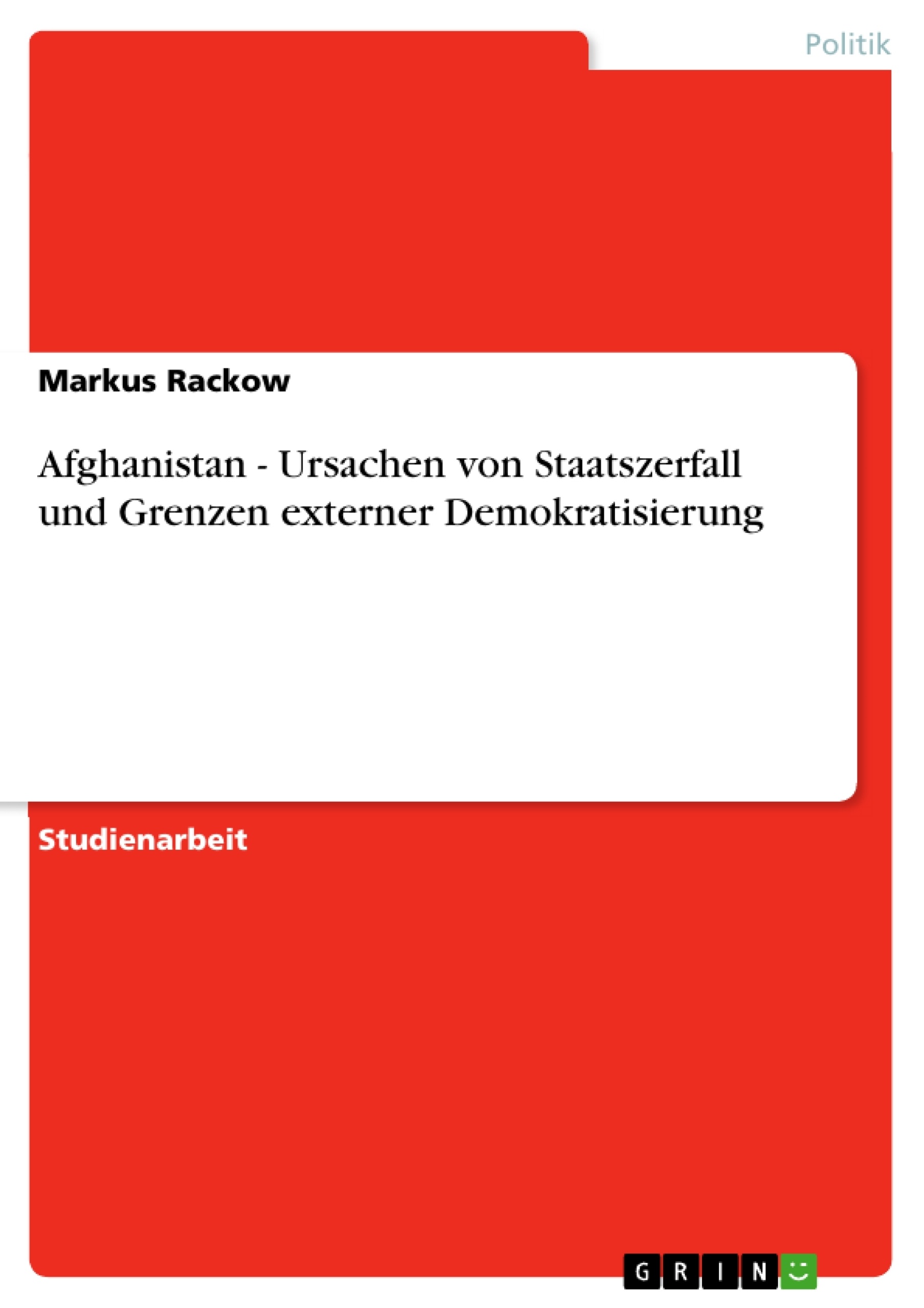Nach Immanuel Kant dienten Kriege quasi teleologisch dazu, die Menschen über den
Erdball zu verteilen, also auch auf unwirtliche Regionen wie Afghanistan. Eine auf
Afghanistan fokussierende Arbeit muss zu Beginn die Frage beantworten, wieso ein so
kleines, unfruchtbares, entferntes, ödes und anachronistisch anmutendes Land zum
Gegenstand einer wissenschaftlichen Arbeit werden sollte. Eine Antwort der 80er Jahre hätte
auf seine Rolle als „Sandwich“ zwischen West und Ost im Stellvertreterkrieg verwiesen, als
die USA hinter vorgehaltener Hand den Widerstand derer „Freiheitskämpfer“ gegen die
Sowjetunion unterstützen, welchen heute wiederum die Vereinigten Staaten und ihre
NATO-Partner in einem Kampf, den mancher Kommentator gar als „dritten Weltkrieg“
bezeichnet, gegenüberstehen. Dieses Beispiel verdeutlicht eine wichtige Tatsache, die bei der
Betrachtung Afghanistans im Hinterkopf verankert werden muss: Die hohe Relevanz seiner
Geschichte für seine heutige Bedeutung und seine aus der Perspektive westlicher Hybris
betrachet zurückgebliebene, vormoderne Gesellschaft3. Wie mächtig diese
Pfadabhängigkeiten sind, wird eine der Fragen dieser Arbeit sein.
Ein Bedeutungswandel aus westlicher Sicht hat also stattgefunden, seit die Taliban – jene
Warlords, Terroristen, Freiheitskämpfer oder wie auch immer man sie nennen will – nach
den Terroranschlägen des 11. September 2001 verdächtigt wurden, den islamischem
Terrorismus zu tolerieren. Mit dem mehr oder minder geglückten Sturz des „Taliban-
Regimes“ haben sich aber nicht nur neue Probleme für die Afghanen ergeben, sondern sind
auch fundamentale politikwissenschaftliche Fragestellungen aufgeworfen worden.
Nach zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit sieben Jahre andauerndem Krieg bzw.
Besatzung ist immer noch kein Ende der Besatzung und Beginn eines wirklich souveränen,
autonomen und befriedeten afghanischen Staates absehbar. Offenbar mangelt es ihm nach
wie vor an Legitimation, wenn weite Teile des Landes seiner herrschaftlichen
Durchdringung unzugänglich sind. Schlimmer noch aus Sicht der Koalitionstruppen: Das
Projekt Afghanistan droht zu scheitern. Zunehmende Gewalt, Terror, Anschläge,
Entführungen von Zivilisten und alarmierende Zahlen und Eindrücke vor allem aus
südlichen Landesteilen, eine nur auf die Hauptstadt Kabul beschränkte effektive
Regierungsgewalt lassen Forderungen nach und Entscheidungen für Truppenaufstockungen aufkommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Davids gegen Goliath in Afghanistan
- I. Theoretische Grundlagen
- I.1 Staatlichkeit und state-building.
- I.2 Demokratie und Regimehybridität im Kontext fragiler Staatlichkeit
- I.3 Zivilgesellschaft als nicht-normatives Konzept.
- I.4 Rentenökonomische Erklärungsansätze.
- I.5 Modernisierungs-, Dependencia- und kulturalistische Theorien
- I.6 Externe Demokratisierung als Sonderfall von Transition
- II. Afghanistan bis zum Ende der Talibanherrschaft
- II. 1 Interne, strukturelle Hindernisse für Staatlichkeit, Demokratie und Entwicklung
- a) Die Herausforderung mangelnder Infrastruktur.
- b) Die Herausforderung geographisch-klimatischer Benachteiligung.
- c) Die Herausforderung ethnischer und kultureller Heterogenität.
- d) Die Herausforderung starker tribaler Strukturen, fragmentierter Zivilgesellschaft und undemokratischer Tradition.
- e) Die Herausforderung sozioökonomischer Schwäche
- f) Die Herausforderung rentenbasierter Gewaltökonomie
- g) Die Herausforderung ideologischer Frustration und halber Modernisierung
- II.2. Externe Einflüsse und pfadabhängige Entwicklungen
- h) Afghanistan als Objekt konfligierender externer Interessen
- i) Pfadabhängige Entwicklungen.
- III. Afghanistan nach den Taliban: Vom „failed state“ zum „failing state“?
- III.1 Umkämpft, besetzt, im Wanken: Das „neue“ (?) Afghanistan
- III.2 Problematische Weichenstellungen der Verfassung
- IV. Schlussfolgerungen
- IV.1 Afghanistan: Ohnmächtiges Opfer struktureller und externer Einflüsse?
- IV.2 „Imperial Hubris“: Schmerzhafte Grenzen externer Demokratisierung.
- IV.3 Wieso überhaupt ein demokratischer, afghanischer Staat?
- V. Fazit und Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, warum der Aufbau eines demokratischen Staates in Afghanistan trotz externer Bemühungen so schwierig ist. Sie analysiert die strukturellen und historischen Hindernisse, die einer Modernisierung westlicher Art im Weg stehen, und untersucht die Auswirkungen von externen Einflüssen auf die politische Entwicklung Afghanistans.
- Staatlichkeit und State-Building im Kontext fragiler Staatlichkeit
- Externe Demokratisierung und deren Grenzen
- Die Rolle von strukturellen und historischen Faktoren für die politische Entwicklung Afghanistans
- Die Auswirkungen von Rentenökonomie und Gewaltökonomie auf die politische Stabilität
- Die Bedeutung von Pfadabhängigkeiten für die afghanische Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die historische und aktuelle Bedeutung Afghanistans im Kontext von internationalen Konflikten. Kapitel I stellt die theoretischen Grundlagen dar, die für die Analyse der afghanischen Situation relevant sind, darunter Konzepte von Staatlichkeit, Demokratie, Zivilgesellschaft und externe Demokratisierung. Kapitel II beleuchtet die internen und externen Faktoren, die die politische Entwicklung Afghanistans bis zum Ende der Talibanherrschaft geprägt haben. Kapitel III befasst sich mit der Situation in Afghanistan nach den Taliban und den Herausforderungen des Aufbaus eines neuen Staates. Kapitel IV zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse und beleuchtet die Grenzen externer Demokratisierung. Kapitel V fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen für Afghanistan.
Schlüsselwörter
Afghanistan, Staatlichkeit, State-Building, Demokratie, externe Demokratisierung, Fragile Staatlichkeit, Rentenökonomie, Gewaltökonomie, Pfadabhängigkeit, Zivilgesellschaft, Ethnische Heterogenität, Moderne, Tradition, Externe Einflüsse, Postkoloniale Gesellschaft, Modernisierung, Entwicklung, Krieg, Besatzung, Terrorismus, Taliban
- Citation du texte
- Markus Rackow (Auteur), 2008, Afghanistan - Ursachen von Staatszerfall und Grenzen externer Demokratisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117516