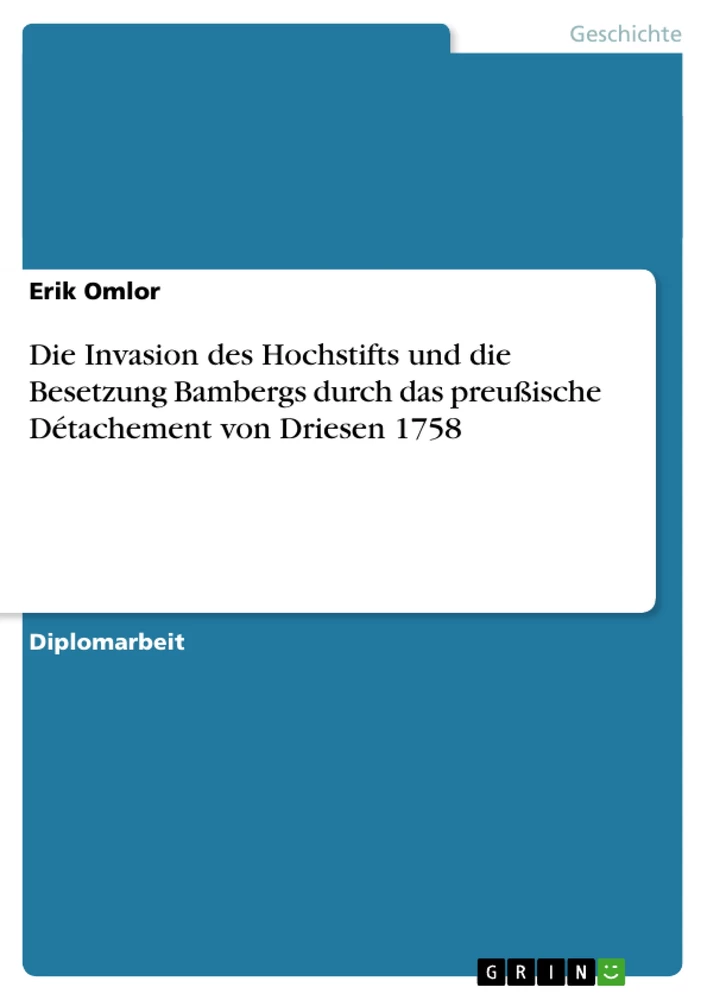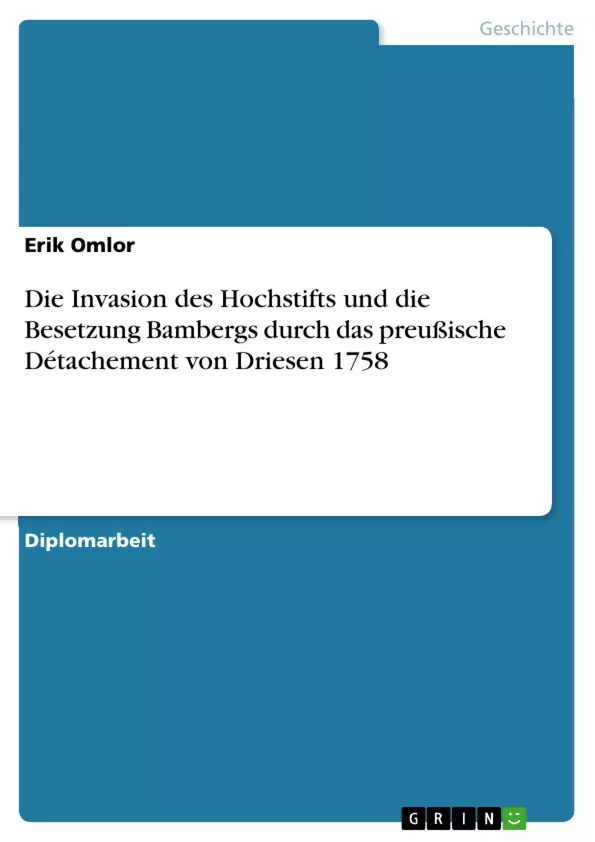Die gängigen Standardwerke zur Geschichte des Siebenjährigen Krieges thematisieren für gewöhnlich die bekannten Hauptschlachten (Roßbach, Leuthen, Kunersdorf etc.), Feldzüge und die Diplomatiegeschichte dieses für das entstehende europäische Mächtegleichgewicht äußerst bedeutsamen Konfliktes. Die vorliegende Diplomarbeit versucht hingegen die Perspektive der Feldherren und Staatsmänner zu verlassen und der Frage nachzuspüren, wie die Kriege des absolutistischen Zeitalters - wegen des Exklusivcharakters der Entscheidungsfindung und Lenkung auch häufig als Kabinettskriege bezeichnet - von den Untertanen der kriegführenden Fürsten erfahren wurden. Zugrundegelegt wird dabei ein der Kulturgeschichte entlehnter Erfahrungsbegriff. Was uns in den Quellen gegenübertritt ist nicht die Unmittelbarkeit des Geschehenen, sondern ein bereits durch den Prozess des Erlebens, der Deutung und Verarbeitung gefilterter Blick auf die Vergangenheit. Arbeitsgrundlage bilden dabei nahezu ausschließlich bislang unveröffentlichte archivalische Quellen der Bibliotheken und Archive Bambergs. Die Kriegserfahrungen der Bevölkerung werden dabei immer wieder mit dem Verlauf des Konfliktes verknüpft, so dass dem Leser ein lebendiger Eindruck, sowohl der hohen Politik, als auch des Alltags in einem Krieg des 18. Jahrhunderts vermittelt wird. Ausgehend von der Prämisse, dass das Geschichtsbild der Nachgeborenen - bei aller gebotenen kritisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Quellen - stets ein Konstrukt ist, fühlt sich die Arbeit einem narrativen Verständnis von Historiographie verpflichtet. Anders gesagt: Es wurde versucht das Postulat wissenschaftlicher Erkenntnis mit kurzweiliger, das Hintergrundwissen erhellender Lektüre in Einklang zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Kurzer Abriss der Militärgeschichtsschreibung in Deutschland
- I.2. Fragestellung der Arbeit und Verortung derselben im Rahmen einer „neuen“ Militärgeschichte
- II. Charakteristika der Kabinettskriegsführung
- II.1. Strukturelle Merkmale und Grundzüge des „Großen Krieges“
- II.2. Der Sonderfall des „,,Kleinen Krieges”
- III. Das Kriegsjahr 1757 in Franken und dem Hochstift Bamberg
- IV. Gesamtstrategische Lage im Frühjahr 1758 und preußische Kriegsziele
- V. Die Invasion des Hochstifts und die Besetzung Bambergs am 31. Mai 1758
- V.1. Die Truppenbewegungen im April / Mai 1758 und der preußische Vormarsch bis vor die Tore der Residenzstadt (20. – 30. Mai)
- V.2. Die Kampfhandlungen um die Residenzstadt und deren Übergabe am 31. Mai 1758
- VI. Kriegserfahrungen der Untertanen
- VI. 1. Die Einquartierungen im Stadtgebiet während der Besatzungsphase (1.-10. Juni 1758)
- VI.2. Formen der persönlichen Selbstbereicherung unter den Bedingungen des Krieges. Die vielen Varianten der „Plünderung“
- VI.3. Kontributionen. Logistische Zwänge als bedingender und leitender Faktor der Kabinettskriegsführung
- VI.4. Der Mensch als Pfandobjekt. Geiselnahmen und Kriegsgefangenschaft
- VI.5. Bewaffneter Widerstand und Selbstschutzmaßnahmen. Der Untertan als aktiver Part des Kriegsgeschehens
- VI.6 Profiteure des Krieges? Die Ausnahmesituation Krieg als Katalysator sozial destruktiver Devianz
- VII. Der Rückmarsch des preußischen Détachements von Driesen am 10. Juni 1758
- VII. 1. Bedingungen und strategische Hintergründe des Rückmarsches am 10. Juni
- VII.2. Allgemeine Überlegungen zu Intention und Quellenwert der Schadensspezifikationen
- VIII. Kurzer Ausblick auf den weiteren Kriegsverlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Invasion des Hochstifts Bamberg durch das preußische Détachement von Driesen im Jahr 1758. Sie analysiert die militärische Strategie der Preußen, die Auswirkungen der Besetzung auf die Stadt Bamberg und die Kriegserfahrungen der Bevölkerung. Die Arbeit untersucht zudem die Rolle des „Kleinen Krieges“ innerhalb der Kabinettskriegsführung.
- Militärstrategie der Preußen im Siebenjährigen Krieg
- Auswirkungen der Besetzung Bambergs auf die Stadt und ihre Bewohner
- Kriegserfahrungen der Bevölkerung: Einquartierungen, Plünderungen, Kontributionen, Geiselnahmen, Bewaffneter Widerstand
- Die Rolle des „Kleinen Krieges“ innerhalb der Kabinettskriegsführung
- Die Auswirkungen des Krieges auf die soziale Struktur der Stadt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Abriss der Militärgeschichtsschreibung in Deutschland und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Kapitel II beleuchtet die Charakteristika der Kabinettskriegsführung, insbesondere den „Großen Krieg“ und den „Kleinen Krieg“. Kapitel III behandelt das Kriegsjahr 1757 in Franken und dem Hochstift Bamberg. Kapitel IV analysiert die Gesamtstrategische Lage im Frühjahr 1758 und die preußischen Kriegsziele. Kapitel V schildert die Truppenbewegungen und die Besetzung Bambergs am 31. Mai 1758. Kapitel VI untersucht die Kriegserfahrungen der Untertanen, einschließlich Einquartierungen, Plünderungen, Kontributionen, Geiselnahmen und bewaffneten Widerstands. Kapitel VII analysiert den Rückmarsch des preußischen Détachements von Driesen am 10. Juni 1758. Kapitel VIII bietet einen kurzen Ausblick auf den weiteren Kriegsverlauf.
Schlüsselwörter
Siebenjähriger Krieg, Kabinettskriegsführung, „Großer Krieg“, „Kleiner Krieg“, Preußen, Bamberg, Besetzung, Kriegserfahrungen, Einquartierungen, Plünderungen, Kontributionen, Geiselnahmen, Bewaffneter Widerstand, soziale Auswirkungen, Militärgeschichte, Historiographie.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah am 31. Mai 1758 in Bamberg?
An diesem Tag wurde die Residenzstadt Bamberg im Rahmen des Siebenjährigen Krieges durch ein preußisches Détachement unter General von Driesen besetzt.
Was versteht man unter einem „Kabinettskrieg“?
Kabinettskriege des 18. Jahrhunderts waren Konflikte, die von Fürsten und ihren Kabinetten mit Berufsarmeen geführt wurden, wobei die Schonung der zivilen Ressourcen oft ein strategisches Ziel war.
Wie erlebte die Bamberger Bevölkerung die preußische Besatzung?
Die Bewohner litten unter Einquartierungen, hohen Kontributionszahlungen, Plünderungen und der Angst vor Geiselnahmen, die zur Absicherung der Zahlungen dienten.
Was ist der „Kleine Krieg“ in der Militärgeschichte?
Der „Kleine Krieg“ bezeichnet Operationen kleinerer, mobiler Einheiten zur Aufklärung, Versorgung oder Störung des Gegners, abseits der großen Hauptschlachten.
Welche Quellen wurden für diese historische Analyse genutzt?
Die Arbeit stützt sich primär auf unveröffentlichte archivalische Quellen aus Bamberger Bibliotheken und Archiven, die den Alltag während des Krieges dokumentieren.
- Citar trabajo
- Diplom-Historiker (Univ.) Erik Omlor (Autor), 2007, Die Invasion des Hochstifts und die Besetzung Bambergs durch das preußische Détachement von Driesen 1758, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117542