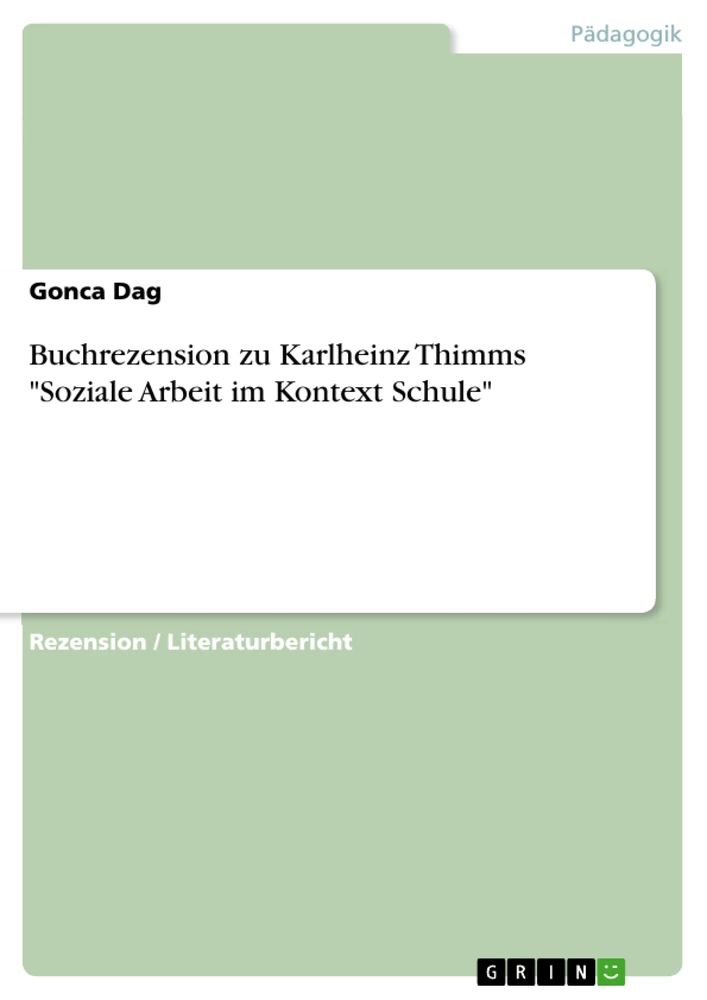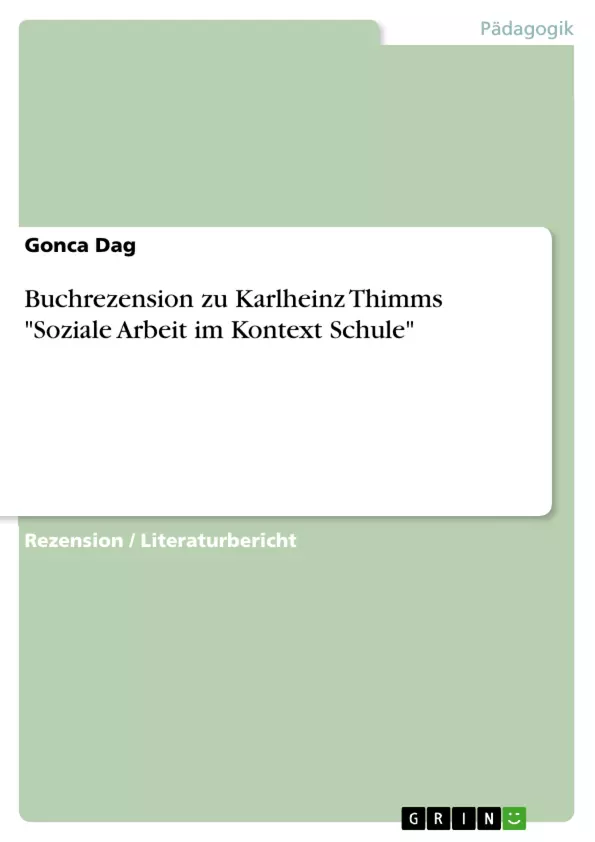Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Buchrezension zu Karlheinz Thimms Werk "Soziale Arbeit im Kontext Schule", das 2015 erschien.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Schule als System und Lebenswelt - Zielgruppe Schüler*innen
- Kapitel 2: Sozialarbeit an der (grund-)Schule
- Kapitel 3: Konfliktpädagogik in der Schule
- Kapitel 4: Auszeitgestaltung an Schule
- Kapitel 5: Schuldistanz - Erklärungsmodelle und Handlungsstrategien
- Kapitel 6: Vernetzung und Kooperation am Beispiel Schuldistanz
- Kapitel 7: Zusammenarbeit mit Eltern - Gestaltung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften
- Kapitel 8: Häusliche Gewalt und (grund-)Schule
- Kapitel 9: Berufsorientierung von Jugendlichen als Thema für Eltern und Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch von Karlheinz Thimm (2015) "Soziale Arbeit im Kontext Schule" untersucht die Herausforderungen der Sozialen Arbeit an Schulen im Kontext gesellschaftlichen Wandels. Es beleuchtet, wie Schulsozialarbeit auf die komplexen Bedürfnisse von Schüler*innen reagieren und effektiv unterstützen kann.
- Die Rolle der Schule im Wandel und die Erweiterung ihrer Funktionen über reine Bildung hinaus.
- Die Bedeutung von Schulsozialarbeit bei der Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Sozialisation, Teilhabe und Inklusion.
- Konfliktlösung und Prävention an Schulen.
- Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulsozialarbeit, Eltern und weiteren Institutionen.
- Handlungsansätze und Strategien im Umgang mit Schuldistanz und häuslicher Gewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Schule als System und Lebenswelt - Zielgruppe Schüler*innen: Dieses einführende Kapitel beschreibt den Wandel der Schule von einem Ort der rein kognitiven Bildung hin zu einer Institution, die auch Erziehungs-, Sozialisierungs- und Integrationsaufgaben übernimmt. Es werden aktuelle Herausforderungen wie Bildungsherausforderungen (partizipative Lernorganisationen), Akzeptanzherausforderungen (informelle Beziehungen) und die Notwendigkeit individueller Hilfen zur Lebensbewältigung aufgezeigt. Der Autor betont die Heterogenität von Schulen und die damit verbundene Notwendigkeit differenzierter Ansätze. Die Rolle der Sozialen Arbeit wird als essentiell für die Bewältigung dieser Herausforderungen hervorgehoben, wobei konkrete Maßnahmen allerdings nur angedeutet werden.
Kapitel 2: Sozialarbeit an der (grund-)Schule: Das Kapitel beleuchtet die Schulsozialarbeit an Grundschulen anhand eines Fallbeispiels zum Thema Mobbing. Es verdeutlicht, wie Schulsozialarbeit durch Konfliktlösung auf individueller und Systemebene (Entlastung des Lehrpersonals) einen wertvollen Beitrag leistet. Der Autor beschreibt das breite Tätigkeitsspektrum der Schulsozialarbeit, benennt aber auch mögliche Probleme wie strukturelle, konzeptionelle und Akzeptanzprobleme sowie die Notwendigkeit klarer Aufgabenabgrenzungen zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeitern. Die Relevanz des Themas wird durch den Bezug auf eine Studie des Deutschen Bundestages zum Thema Mobbing unterstrichen.
Kapitel 3: Konfliktpädagogik in der Schule: Dieses Kapitel analysiert Konflikte in der Schule als Teil der jugendlichen Entwicklungsphase. Der Autor zeigt anhand einer Studie, dass professionell Beschäftigte Konflikte häufiger wahrnehmen als Schüler*innen. Er formuliert daraus Konsequenzen für die Schulentwicklung, wie die Entwicklung eines Konfliktkonzepts und die Vernetzung von Fachkräften. Das Kapitel stellt vier Formate für die Konfliktlösung vor: Konfliktbeschreibungs- und -aufarbeitungsgespräche, ein idealtypisches Modell der Konfliktbearbeitung, Regelerstellung und Interventionen bei Regelverstößen.
Kapitel 4: Auszeitgestaltung an Schule: Das Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Auszeit an Schulen, sowohl als verordnete als auch als eigeninitiierte Maßnahme. Der Autor betont die primäre Funktion der Auszeit als Schaffung einer entspannteren Lernatmosphäre und nicht als alleiniges Mittel zur Verhaltensänderung. Es werden verschiedene Auszeitmodelle vorgestellt, darunter das Trainingsraumkonzept und die „Pädagogik des sicheren Ortes“, die besonders für Kinder mit psychischen Belastungen geeignet ist. Das Kapitel schließt mit Qualitätsstandards für die Prozessgestaltung.
Kapitel 5: Schuldistanz - Erklärungsmodelle und Handlungsstrategien: Dieses Kapitel analysiert Schuldistanz (Schulmüdigkeit, Schulschwänzen) und unterscheidet verschiedene Formen anhand von Häufigkeit und Dauer des Fehlens. Es werden Ursachen für Schuldistanzierung aus verschiedenen Kontexten (Schule, Peers, Familie, Person) dargestellt und durch tabellarische Zusammenfassungen visualisiert. Der Autor integriert Kommentare betroffener Jugendlicher, um einen persönlichen Einblick zu geben. Zentrale Bestandteile des Kapitels sind die Darstellung von Handlungsstrategien für Schule und Jugendhilfe sowie präventive Maßnahmen.
Kapitel 6: Vernetzung und Kooperation am Beispiel Schuldistanz: Aufbauend auf Kapitel 5 beleuchtet dieses Kapitel die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen (Schule, Jugendhilfe, etc.) im Umgang mit Schuldistanz. Anhand von Fallbeispielen werden Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation auf verschiedenen Ebenen (Prozessebene, Strukturebene, Kulturebene, Ergebnisebene) abgeleitet.
Kapitel 7: Zusammenarbeit mit Eltern - Gestaltung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften: Das Kapitel betont die Bedeutung der Eltern als Kooperationspartner im Bildungsprozess. Der Autor argumentiert für eine aktive und offene Haltung der Schulen gegenüber Eltern und beschreibt die Notwendigkeit, strukturelle Bedingungen und Kommunikationswege zu optimieren, um effektive Partnerschaften zu ermöglichen.
Kapitel 8: Häusliche Gewalt und (grund-)Schule: Dieses Kapitel beschreibt die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder und Jugendliche (Schulversagen, Konzentrationsschwierigkeiten, Rückzug etc.) und Möglichkeiten, häusliche Gewalt zu erkennen. Der Autor verdeutlicht die Herausforderungen für Pädagog*innen und betont die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Jugendamt, Frauenhaus etc.). Das Kapitel beinhaltet Informationen zu Gesprächstechniken und kollegialer Fallreflexion.
Kapitel 9: Berufsorientierung von Jugendlichen als Thema für Eltern und Schule: Das Kapitel behandelt die berufliche Orientierung von Jugendlichen und die komplexen Faktoren (Herkunftsmilieu, Lebenslagen etc.), die sie beeinflussen. Es werden wichtige Akteure (Jugendliche, Eltern, Schule, Berufsberatung etc.) und drei Angebotsniveaus für Schulen (Orientierungsgrundlagen, erweiterte Erfahrungsräume) beschrieben.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Schule, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Bildung, Sozialisation, Integration, Inklusion, Konfliktpädagogik, Schuldistanz, Häusliche Gewalt, Berufsorientierung, Elternarbeit, Kooperation, Vernetzung.
Soziale Arbeit im Kontext Schule: FAQ
Was ist der Inhalt des Buches "Soziale Arbeit im Kontext Schule" von Karlheinz Thimm (2015)?
Das Buch untersucht die Herausforderungen der Sozialen Arbeit an Schulen im Kontext gesellschaftlichen Wandels. Es beleuchtet die Reaktion und Unterstützung der Schulsozialarbeit auf die komplexen Bedürfnisse von Schüler*innen und behandelt Themen wie die Rolle der Schule im Wandel, die Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Sozialisation, Teilhabe und Inklusion, Konfliktlösung und Prävention, die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulsozialarbeit, Eltern und weiteren Institutionen sowie Handlungsansätze und Strategien im Umgang mit Schuldistanz und häuslicher Gewalt.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch gliedert sich in neun Kapitel: 1. Schule als System und Lebenswelt, 2. Sozialarbeit an der (Grund-)Schule, 3. Konfliktpädagogik in der Schule, 4. Auszeitgestaltung an Schule, 5. Schuldistanz – Erklärungsmodelle und Handlungsstrategien, 6. Vernetzung und Kooperation am Beispiel Schuldistanz, 7. Zusammenarbeit mit Eltern, 8. Häusliche Gewalt und (Grund-)Schule und 9. Berufsorientierung von Jugendlichen.
Worum geht es im Kapitel "Schule als System und Lebenswelt"?
Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der Schule zu einer Institution mit Erziehungs-, Sozialisierungs- und Integrationsaufgaben neben der kognitiven Bildung. Es thematisiert Herausforderungen wie Bildungsherausforderungen, Akzeptanzherausforderungen und die Notwendigkeit individueller Hilfen und betont die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.
Was wird im Kapitel zur Sozialarbeit an der (Grund-)Schule behandelt?
Das Kapitel beleuchtet die Schulsozialarbeit anhand eines Fallbeispiels zum Thema Mobbing und zeigt deren Beitrag zur Konfliktlösung auf individueller und Systemebene. Es beschreibt das breite Tätigkeitsspektrum, benennt aber auch strukturelle und konzeptionelle Probleme sowie die Notwendigkeit klarer Aufgabenabgrenzungen.
Wie wird Konfliktpädagogik in der Schule im Buch behandelt?
Das Kapitel analysiert Konflikte als Teil der jugendlichen Entwicklung, zeigt die Notwendigkeit eines Konfliktkonzepts und der Vernetzung von Fachkräften auf und stellt vier Formate für die Konfliktlösung vor: Konfliktbeschreibungs- und -aufarbeitungsgespräche, ein Modell der Konfliktbearbeitung, Regelerstellung und Interventionen bei Regelverstößen.
Was ist zum Thema Auszeitgestaltung im Buch zu finden?
Das Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Auszeit als Schaffung einer entspannteren Lernatmosphäre und stellt verschiedene Auszeitmodelle vor, darunter das Trainingsraumkonzept und die „Pädagogik des sicheren Ortes“. Es schließt mit Qualitätsstandards für die Prozessgestaltung.
Wie wird Schuldistanz im Buch behandelt?
Das Kapitel analysiert Schuldistanz, unterscheidet verschiedene Formen und zeigt Ursachen aus verschiedenen Kontexten (Schule, Peers, Familie, Person). Es stellt Handlungsstrategien für Schule und Jugendhilfe sowie präventive Maßnahmen vor und integriert Kommentare betroffener Jugendlicher.
Wie wird die Vernetzung und Kooperation im Umgang mit Schuldistanz dargestellt?
Aufbauend auf dem Kapitel zu Schuldistanz beleuchtet dieses Kapitel die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen (Schule, Jugendhilfe etc.) anhand von Fallbeispielen und leitet Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation ab.
Was ist zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern im Buch beschrieben?
Das Kapitel betont die Bedeutung der Eltern als Kooperationspartner und argumentiert für eine aktive und offene Haltung der Schulen gegenüber Eltern. Es beschreibt die Notwendigkeit, strukturelle Bedingungen und Kommunikationswege zu optimieren.
Wie geht das Buch mit dem Thema Häusliche Gewalt um?
Das Kapitel beschreibt die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder und Jugendliche und Möglichkeiten, diese zu erkennen. Es verdeutlicht die Herausforderungen für Pädagog*innen und betont die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Es beinhaltet Informationen zu Gesprächstechniken und kollegialer Fallreflexion.
Welchen Aspekt behandelt das Kapitel zur Berufsorientierung?
Das Kapitel behandelt die berufliche Orientierung von Jugendlichen und die komplexen Einflussfaktoren (Herkunftsmilieu, Lebenslagen etc.). Es beschreibt wichtige Akteure und drei Angebotsniveaus für Schulen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Buch?
Soziale Arbeit, Schule, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Bildung, Sozialisation, Integration, Inklusion, Konfliktpädagogik, Schuldistanz, Häusliche Gewalt, Berufsorientierung, Elternarbeit, Kooperation, Vernetzung.
- Citation du texte
- Gonca Dag (Auteur), 2022, Buchrezension zu Karlheinz Thimms "Soziale Arbeit im Kontext Schule", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1175675