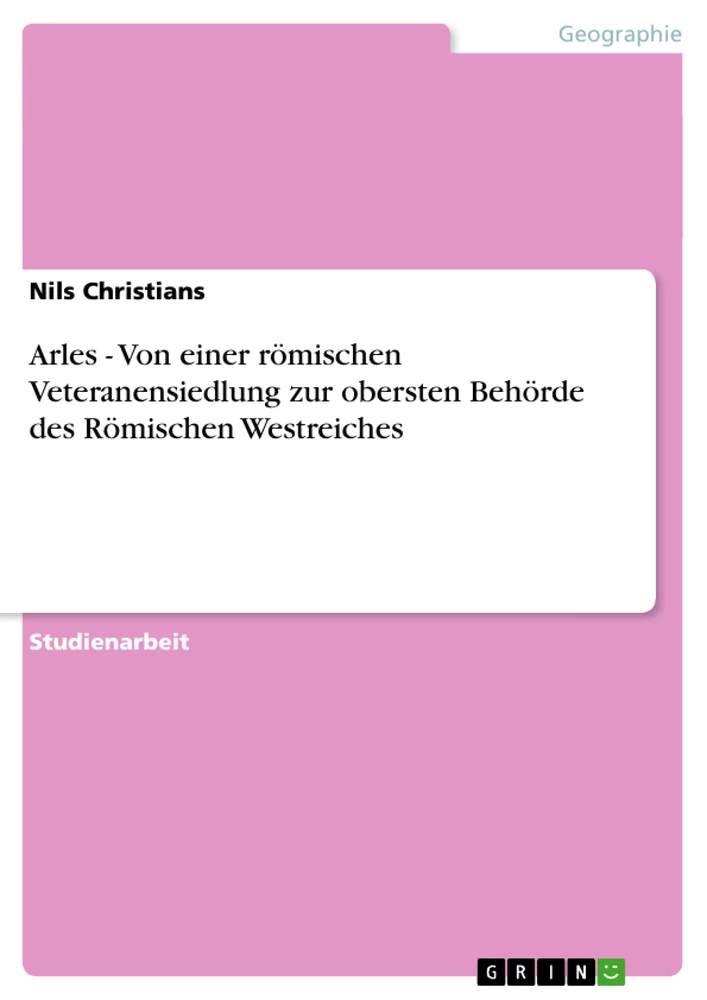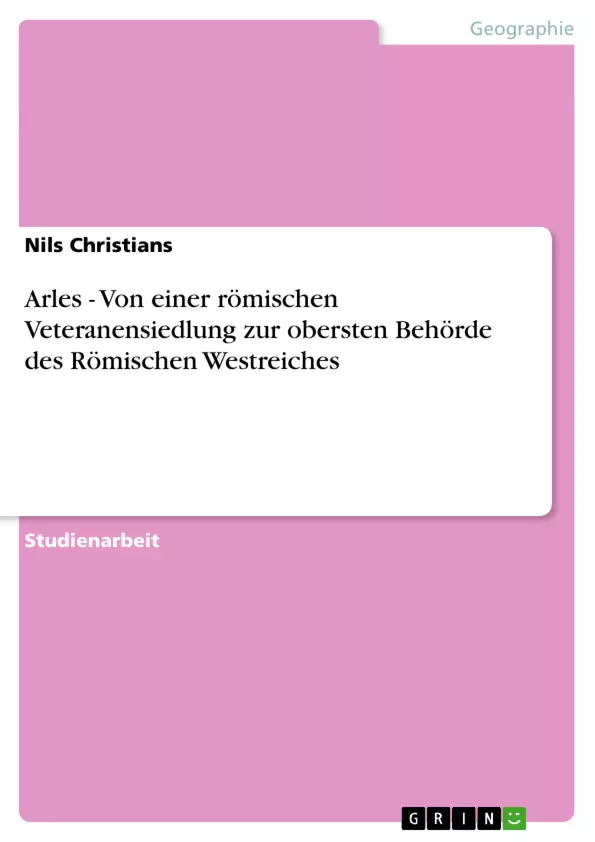„Die Frauen sind sehr schön hier. Das ist kein Schwindel. Hingegen ist das Museum von Arles schauderhaft und ein Schwindel. Es gibt auch ein Museum mit Altertümern. Die sind echt. […] Dreckig ist diese Stadt mit ihren alten Strassen. […] Das ändert nichts daran, dass es schön ist, sehr schön.“ So schreibt 1888 Vincent van Gogh aus Arles in einem Brief an seinen Bruder Theo.
Arles ist eine Arrondissement-Hauptstadt im französischen Departement Bouches-du-Rhône links der Rhône, 24 km vom Meer entfernt. Zu Arles gehört das Gebiet der gesamten Camargue. Arles ist deshalb mit ca. 760 km² flächenmäßig die größte Gemeinde Frankreichs. (FEESS 2003: 42 f.) Die Stadt liegt auf einem Hügel (Colline de Moleyrès) inmitten einer ehemals sumpfigen Gegend, was der Name schon sagt. Er stammt nämlich von dem keltischen Wort „arlaih“, das soviel heißt, wie auf feuchtem Boden gebaut (ar = darauf, oben und laih = feucht) (STÜBINGER 1909: 6).
Die momentane Einwohnerzahl beläuft sich nur auf etwa 52.000. Dennoch hat Arles eine bedeutende über 2000 Jahre alte Stadtgeschichte zu verzeichnen, die sich noch heute in zahlreichen Bauten der Antike und des Mittelalters widerspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das vorrömische Arles
3. Eroberung und Ausbau des römischen Arles
4. Blütezeit
5. Niedergang der römischen Herrschaft
6. Bedeutende Römische Bauwerke in Arles
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Die Frauen sind sehr schön hier. Das ist kein Schwindel. Hingegen ist das Museum von Arles schauderhaft und ein Schwindel. Es gibt auch ein Museum mit Altertümern. Die sind echt. […] Dreckig ist diese Stadt mit ihren alten Strassen. […] Das ändert nichts daran, dass es schön ist, sehr schön.“ So schreibt 1888 Vincent van Gogh aus Arles in einem Brief an seinen Bruder Theo.
Arles ist eine Arrondissement-Hauptstadt im französischen Departement Bouches-du-Rhône links der Rhône, 24 km vom Meer entfernt. Zu Arles gehört das Gebiet der gesamten Camargue. Arles ist deshalb mit ca. 760 km² flächenmäßig die größte Gemeinde Frankreichs. (Feess 2003: 42 f.) Die Stadt liegt auf einem Hügel (Colline de Moleyrès) inmitten einer ehemals sumpfigen Gegend, was der Name schon sagt. Er stammt nämlich von dem keltischen Wort „arlaih“, das soviel heißt, wie auf feuchtem Boden gebaut (ar = darauf, oben und laih = feucht) (Stübinger 1909: 6).
Die momentane Einwohnerzahl beläuft sich nur auf etwa 52.000. Dennoch hat Arles eine bedeutende über 2000 Jahre alte Stadtgeschichte zu verzeichnen, die sich noch heute in zahlreichen Bauten der Antike und des Mittelalters widerspiegelt.
2. Das vorrömische Arles
Der Ursprung von Arles ist nicht ganz eindeutig, da sich die Quellen widersprechen.
Etwa 1000 vor Christus begannen die Einwanderungen der Ligurer in das Gebiet der Provence. Später wanderten auch Kelten ein. Die daraus entstandene Bevölkerung nennt man auch kelto-ligurisch. Um 1500 v. Chr. sollen sich laut Stübinger (1909) schon Phönizier im späteren Arles niedergelassen haben. Andere Quellen sprechen eher vom 6.-7. Jh. v. Chr. (Wendt 1963; Collins 2007). Gewiss ist jedenfalls, dass um 600 v. Chr. ionische Griechen aus Phokäa im Rahmen der griechischen Kolonisation, die die Griechen zuvor schon an die Küsten Kleinasiens, Süditaliens und Siziliens führte, Massalia - das heutige Marseille gründeten. Kurze Zeit später entstand als wichtiger Filialplatz für Massalia die Kolonie Theline (späteres Arles) (Stübinger 1909: 10; Pletsch 1997: 119).
535 v. Chr. wurde Theline von den Saluviern, einem kelto-ligurischem Stamm zerstört und als Stadt „Arelate" neu aufgebaut (Collins 2007). Welche Beziehungen nun zur Stadt Massalia bestanden, ist nicht ganz klar. In einigen Quellen wird vom Handel mit den Griechen gesprochen.
In den zwanziger Jahren des 2. Jh. v. Chr. wurde von Domitius Ahenoborbus die Provinz Gallia Narbonensis (spätere Provence) gegründet. Dort ließen sich zunehmend mehr Römer in den alten Handelskontoren nieder oder lebten in losen Siedlungsverbänden neben den keltischen und hellenisierten Ureinwohnern (von Gladiss 1972: 18 f.).
Die Einfälle der germanischen Kimbrer und Teutonen zwangen Konsul Gaius Marius, seine afrikanischen Legionen in die Camargue zu verlegen und dort, bis es zu den Kämpfen mit den Eindringligen kam, seine Soldaten sinnvoll mit dem Bau eines Kanals, der Arles mit dem Meer verbindet, zu beschäftigen. Dieser 104 v. Chr. namens „Fossa Mariana“ entstandene Kanal machte Arelate zu einer Seehandelsstadt, die bald mit Massalia konkurrierte. Während Cäsar von 58 bis 51 v. Chr. in Gallien Krieg führte, hatte er gute Beziehungen zu Massilia, das allerdings immer mehr isoliert wurde. Als man sich aber auf die Seite des Feindes Pompejus schlug, griff er sie an. Dazu ließ er in Arelate innerhalb der Rekordzeit von 30 Tagen zwölf zusätzliche zu seinen siebzehn Schiffen bauen, womit er 49 v. Chr. Massalia eroberte und es in Massilia umbenannte (Tetzlaff 1985: 64 f.).
3. Eroberung und Ausbau des römischen Arles
Im Auftrage Cäsars nahm Tiberius Nero die (Neu)Gründung der Kolonie Arelate vor, indem er zunächst gegenüber der gallogriechischen Stadt auf dem rechten Rhôneufer, das heutige Trinquetaille, Veteranen der VI. Legion ansiedelte, die zuvor mit Cäsar in Gallien gekämpft hatten (von Gladiss 1972: 19). Das nun genannte Colonia Iulia Paterna Arelate Sextanorum wurde systematisch auf Kosten von Massilia vergrößert. Arelate blühte auf und Massilia verlor an Bedeutung. Cäsar verfolgte zu dieser Zeit eine planmäßige Kolonisationspolitik, um die Einwohner Roms von 320.000 auf 150.000 zu reduzieren und schuf daher 30 neue Kolonien, in denen er Siedlungsmöglichkeiten und Existenzen für über 80.000 Veteranen und Bürger ermöglichte (Christ 2000: 361, 400).
4. Blütezeit
Arles gewann seine Bedeutung als Straßenknotenpunkt der römischen Straßen (via Dominatia ab Arelate Nemausum, via Aurelia ab Arelate Avenionem et Lugudunum, via Aurelia ab Arelate Mediolanum per Alpes Cottias und die via Aurelia ab Arelate AquasSextias). Damit war Arelate wichtiger Verbindungspunkt zwischen Spanien und Italien (Stübinger 1909: 244). Die Via Agrippa verband Arles durch das Rhônetal mit dem Norden. Alle Schiffe, die von der Rhône aus ins Mittelmeer wollten oder umgekehrt, mussten durch den „Fossa Mariana“ Arles passieren (Wendt 1963). Diese Grafik (1) zeigt die günstige Verkehrslage seit dem 1. Jh.:
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand der Name der Stadt Arles?
Der Name leitet sich vom keltischen Wort „arlaih“ ab, was „auf feuchtem Boden gebaut“ bedeutet (ar = darauf, laih = feucht).
Welche Bedeutung hatte Arles für Julius Cäsar?
Cäsar nutzte Arles als Schiffbauplatz für seinen Kampf gegen Massalia (Marseille) und gründete dort später eine Veteranenkolonie.
Was war die "Fossa Mariana"?
Ein 104 v. Chr. von Gaius Marius erbauter Kanal, der Arles mit dem Meer verband und die Stadt zu einem wichtigen Seehandelszentrum machte.
Warum war Arles in der Römerzeit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt?
Die Stadt lag an der Kreuzung bedeutender römischer Straßen (z. B. Via Aurelia) und verband Italien mit Spanien und Nordgallien.
Was sagen die Bauwerke heute über die Geschichte von Arles aus?
Zahlreiche antike Monumente zeugen von der Blütezeit der Stadt als "oberste Behörde des Römischen Westreiches" und bedeutende Veteranensiedlung.
- Citation du texte
- Nils Christians (Auteur), 2008, Arles - Von einer römischen Veteranensiedlung zur obersten Behörde des Römischen Westreiches , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117752