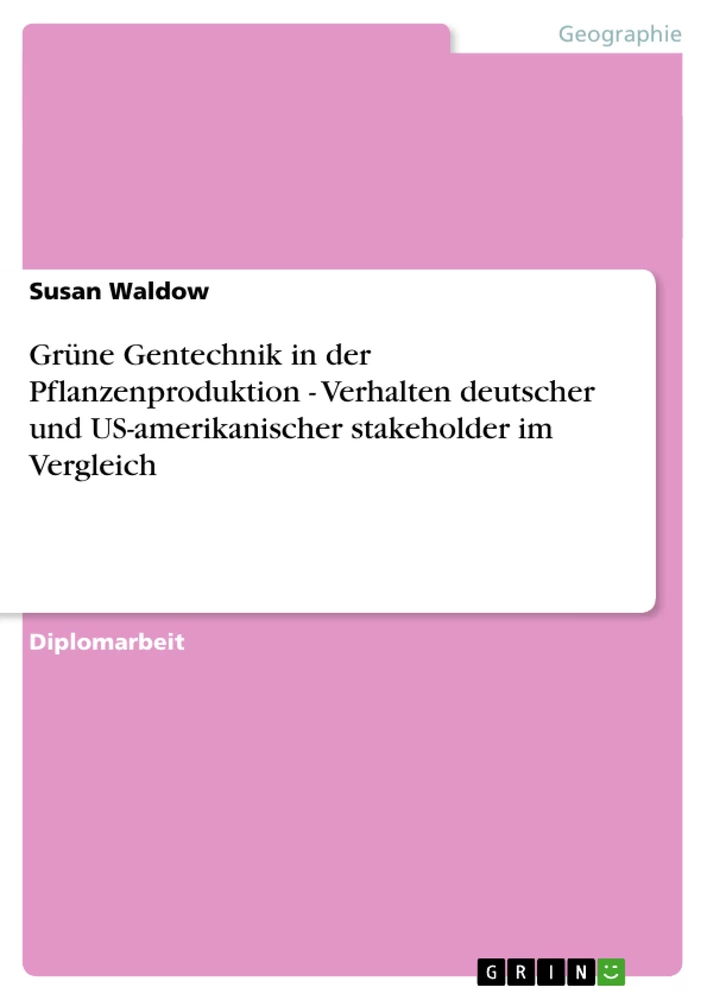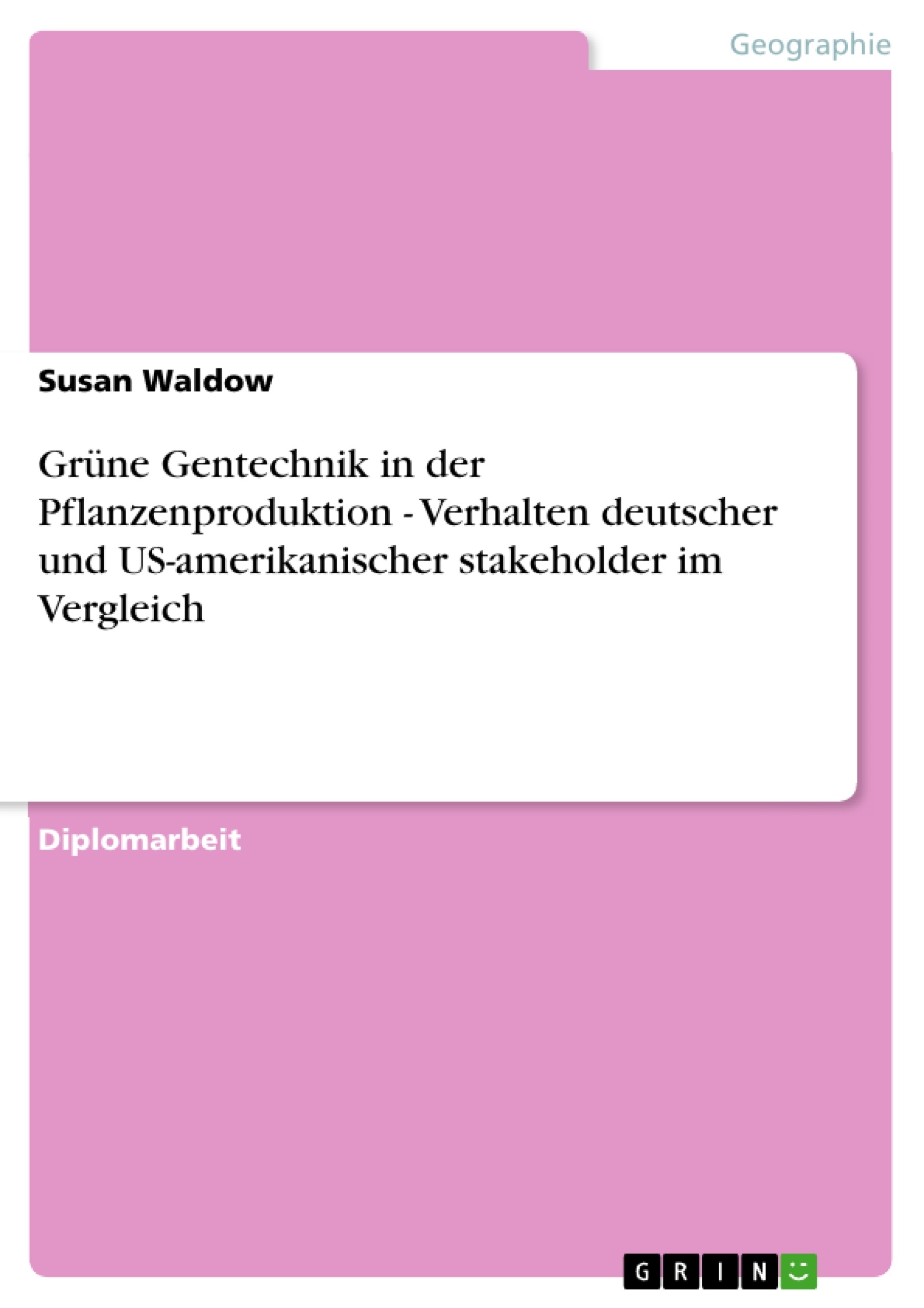Zu Beginn der Darstellung erfolgt eine Einführung in das Thema. Es werden Verfahren, mögliche Chancen und Risiken und der gegenwärtige Anbau transgener Pflanzen in den zwei Ländern erläutert. Im Hauptteil der Arbeit erfolgt die Darstellung des Verhaltens verschiedener Akteure, der sog. stakeholder. Darunter sind die an der neuen Technologie beteiligten und von ihr betroffenen Personen, Organisationen und Gruppen zu verstehen. Für die Auswahl der untersuchten stakeholder wurde auf Gruppierungen anderer Wissenschaftler zurückgegriffen, auf die an späterer Stelle noch näher eingegangen wird.
Dementsprechend wird im ersten Kapitel des Hauptteils das Verhalten der Regierungen und Wissenschaftler untersucht, die die Grüne Gentechnik objektiv bewerten sollen und aus dem Grund evaluators genannt werden. Im zweiten Kapitel erfolgt eine Darstellung der kritischen Beobachter der Gentechnik, der sog. watchdogs, wozu Medien und Umwelt- und Verbraucherorganisationen zählen. Diesen steht auch eine die Biotechnologie befürwortende Gruppe gegenüber, zu der die im dritten Kapitel des Hauptteils untersuchten Biotech-Firmen gehören, die sog. merchants. Da alle drei Gruppen zur Meinungsbildung bei Verbrauchern beitragen, soll im letzten Kapitel auf die consumers eingegangen werden. Hierzu wird auch ein Einblick in kulturwissenschaftliche Aspekte gegeben.
Die vier Kapitel betrachtend können vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Anwendung der Grünen Gentechnik in den beiden Ländern folgende Hypothesen getroffen werden:
1. Die Grüne Gentechnik bei Pflanzen ist in Deutschland strenger reglementiert als in den USA.
2. Die Medienberichterstattung ist in den USA eher positiv, während in Deutschland negative Berichte über die Grüne Gentechnik die Medien beherrschen. Umwelt- und Verbrauchergruppen sind in Deutschland im Bereich der Grünen Gentechnik stärker im Einsatz.
3. Der Einfluss der Biotech-Firmen ist in den USA größer als in Deutschland.
4. Die US-Amerikaner sind technik- und risikofreundlich, die Deutschen technik- und risikofeindlich.
Anhand zumeist chronologischer Darstellungen des Verhaltens der stakeholder soll das gegenwärtig vorhandene unterschiedliche Ausmaß des Anbaus transgener Pflanzen in den USA und Deutschland erklärt werden. Die Hypothesen dienen dabei als Leitfaden für die einzelnen Kapitel. In den Schlussbetrachtungen erfolgt eine Auswertung dieser Hypothesen auf der Basis der Erkenntnisse des Hauptteils.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Thematik der Grünen Gentechnik bei Pflanzen
- 1. Gentechnologie - ein Teil der Biotechnologie
- 2. Die Grüne Gentechnik
- 2.1 Verfahren
- 2.2 Möglichkeiten und Chancen
- 2.3 Risiken
- 2.4 Verbreitung
- III. Die Stakeholder der Grünen Gentechnik
- 1. Evaluators: Objektiv und unabhängig
- 1.1 Die Regulierung der Grünen Gentechnik durch Gesetze
- 1.2 Wissenschaftler und Experten
- 1.3 Zusammenfassung
- 2. Watchdogs: Kritische Beobachter
- 2.1 Medien
- 2.2 Umwelt- und Verbraucherverbände
- 3. Merchants: Die Befürworter
- 3.1 Lobbyismus - Definition und Unterschiede zwischen USA und Deutschland
- 3.2 Public Relations
- 3.3 Monsanto - Der Weg zum Marktführer
- 3.4 Reaktionen der Biotech-Industrie auf die Öffentliche Debatte
- 4. Consumers: Verbraucher und Öffentlichkeit
- 4.1 Einstellung der Bevölkerung in Deutschland und den USA
- 4.2 Vertrauen in die Akteure
- 4.3 Kulturelle Unterschiede
- 1. Evaluators: Objektiv und unabhängig
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Akzeptanz und Anwendung von grüner Gentechnik in der Pflanzenproduktion in Deutschland und den USA. Ziel ist es, die Verhaltensweisen verschiedener Stakeholdergruppen (Regierungen, Wissenschaftler, Medien, Umweltverbände, Industrie und Verbraucher) zu vergleichen und die Gründe für die bestehenden Unterschiede im Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen zu analysieren.
- Regulierung der Grünen Gentechnik im Vergleich zwischen Deutschland und den USA
- Rollen und Einflüsse verschiedener Stakeholdergruppen (Evaluatoren, Watchdogs, Merchants)
- Öffentliche Wahrnehmung und Meinungsbildung zum Thema Grüne Gentechnik
- Kulturelle Unterschiede in der Risikowahrnehmung und Technikakzeptanz
- Der Einfluss von Lobbyismus und Public Relations auf die öffentliche Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Grünen Gentechnik als globales Risiko im Kontext der Globalisierung ein. Sie verortet die Arbeit im wissenschaftlichen Diskurs um die Weltrisikogesellschaft nach Ulrich Beck und beschreibt den starken Gegensatz im Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen zwischen den USA und Deutschland. Die Arbeit stellt die zentralen Forschungsfragen und Hypothesen vor, die im weiteren Verlauf untersucht werden: strengere Regulierung in Deutschland, unterschiedliche Medienberichterstattung, unterschiedlicher Einfluss der Biotech-Firmen und unterschiedliche Risikowahrnehmung in beiden Ländern. Die Einleitung betont die Aktualität und Bedeutung des Themas und verweist auf die Notwendigkeit, die langfristigen Folgen der Grünen Gentechnik zu bedenken.
II. Die Thematik der Grünen Gentechnik bei Pflanzen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Grüne Gentechnik, ihre Verfahren, Chancen und Risiken sowie ihre Verbreitung in Deutschland und den USA. Es liefert das notwendige Grundlagenwissen, um die folgenden Kapitel über die Stakeholder zu verstehen. Die Darstellung der Verfahren dient als Grundlage für die spätere Analyse der jeweiligen Risikobewertungen der Stakeholdergruppen. Die Erläuterung der Chancen und Risiken bildet den Kontext für die unterschiedlichen Haltungen und Strategien der Akteure.
III. Die Stakeholder der Grünen Gentechnik: Dieses Kapitel analysiert das Verhalten verschiedener Stakeholdergruppen im Umgang mit Grüner Gentechnik. Es unterteilt die Akteure in Evaluatoren (Regierungen und Wissenschaftler), Watchdogs (Medien und Umweltverbände) und Merchants (Biotech-Firmen) sowie die Konsumenten. Die Kapitel beschreiben detailliert die Strategien und Handlungen der jeweiligen Gruppen, ihre unterschiedlichen Interessen und Einflüsse auf die öffentliche Meinung. Die Kapitel analysieren den Einfluss von Regulierung, Medienberichterstattung, Lobbyismus und Public Relations auf die Akzeptanz der Grünen Gentechnik in beiden Ländern.
Schlüsselwörter
Grüne Gentechnik, Biotechnologie, Stakeholderanalyse, USA, Deutschland, Risikowahrnehmung, Technikakzeptanz, Regulierung, Medienberichterstattung, Lobbyismus, Public Relations, Verbraucherverhalten, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Grüne Gentechnik in Deutschland und den USA
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Akzeptanz und Anwendung von grüner Gentechnik in der Pflanzenproduktion in Deutschland und den USA. Sie vergleicht das Verhalten verschiedener Stakeholdergruppen (Regierungen, Wissenschaftler, Medien, Umweltverbände, Industrie und Verbraucher) und analysiert die Gründe für die bestehenden Unterschiede im Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen.
Welche Stakeholdergruppen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Rolle folgender Stakeholdergruppen: Evaluatoren (Regierungen und Wissenschaftler, die die Grüne Gentechnik objektiv bewerten), Watchdogs (Medien und Umweltverbände, die kritisch beobachten), Merchants (Biotech-Firmen, die die Technologie befürworten) und Konsumenten (die Verbraucher und die Öffentlichkeit).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich der Regulierung der Grünen Gentechnik in Deutschland und den USA, die Rollen und Einflüsse verschiedener Stakeholdergruppen, die öffentliche Wahrnehmung und Meinungsbildung, kulturelle Unterschiede in der Risikowahrnehmung und Technikakzeptanz, sowie den Einfluss von Lobbyismus und Public Relations auf die öffentliche Debatte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Thematik der Grünen Gentechnik bei Pflanzen (mit Beschreibung der Verfahren, Chancen und Risiken) und ein Kapitel zur Analyse der verschiedenen Stakeholdergruppen und deren Verhalten im Umgang mit Grüner Gentechnik.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der Grünen Gentechnik als globales Risiko ein, verortet die Arbeit im wissenschaftlichen Diskurs um die Weltrisikogesellschaft, beschreibt den Gegensatz im Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen zwischen den USA und Deutschland, stellt zentrale Forschungsfragen und Hypothesen vor und betont die Aktualität und Bedeutung des Themas.
Was wird im Kapitel zur Grünen Gentechnik behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Grüne Gentechnik, ihre Verfahren, Chancen und Risiken sowie ihre Verbreitung in Deutschland und den USA. Es liefert das notwendige Grundlagenwissen für das Verständnis der folgenden Kapitel über die Stakeholder.
Was wird im Kapitel zu den Stakeholdern behandelt?
Dieses Kapitel analysiert detailliert die Strategien und Handlungen der verschiedenen Stakeholdergruppen, ihre unterschiedlichen Interessen und Einflüsse auf die öffentliche Meinung. Es untersucht den Einfluss von Regulierung, Medienberichterstattung, Lobbyismus und Public Relations auf die Akzeptanz der Grünen Gentechnik in beiden Ländern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Grüne Gentechnik, Biotechnologie, Stakeholderanalyse, USA, Deutschland, Risikowahrnehmung, Technikakzeptanz, Regulierung, Medienberichterstattung, Lobbyismus, Public Relations, Verbraucherverhalten, Kulturvergleich.
Welche zentralen Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem die strengere Regulierung in Deutschland im Vergleich zu den USA, die unterschiedliche Medienberichterstattung, den unterschiedlichen Einfluss der Biotech-Firmen und die unterschiedliche Risikowahrnehmung in beiden Ländern.
- Citation du texte
- Susan Waldow (Auteur), 2008, Grüne Gentechnik in der Pflanzenproduktion - Verhalten deutscher und US-amerikanischer stakeholder im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117825