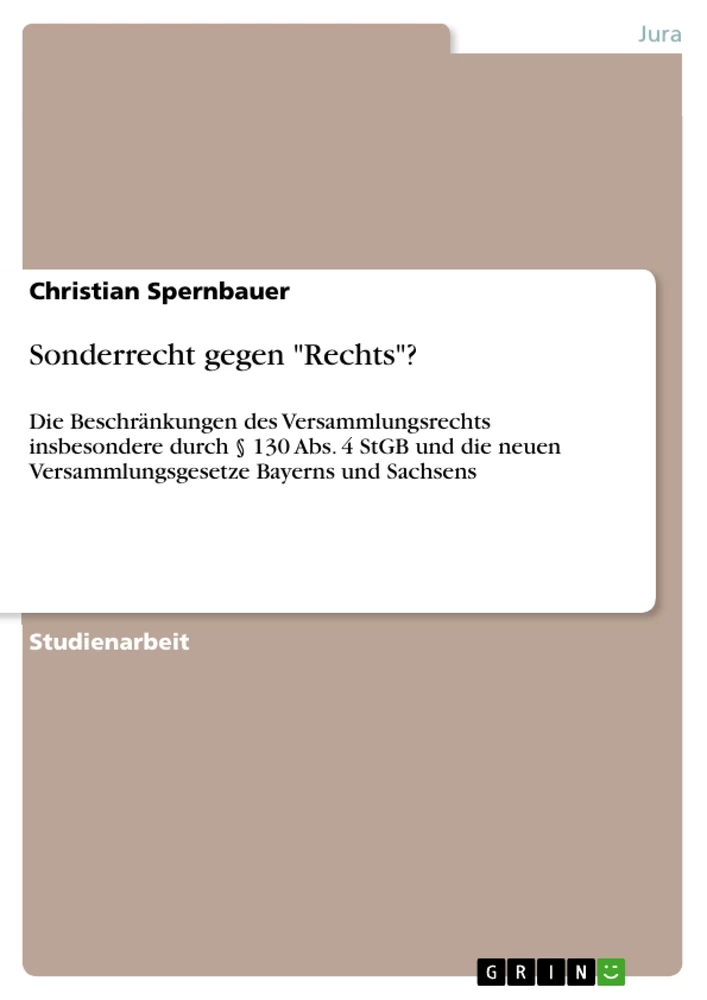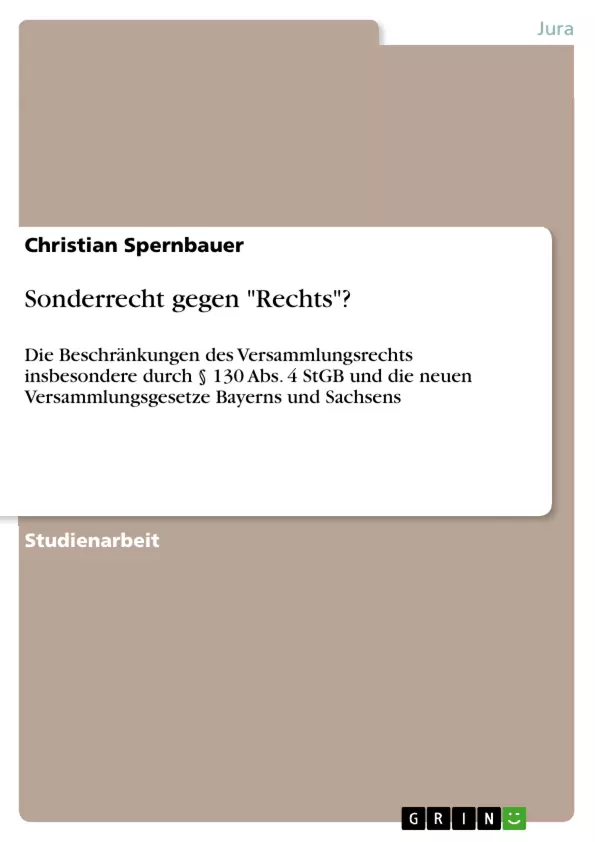Das Recht auf Versammlungsfreiheit kann neben dem Recht auf freie Meinungsäußerung als einer
der elementarsten Grundpfeiler der freiheitlichen Demokratie angesehen werden. Beschränkungen
und gar Verbote dieses Grundrechtes bedürfen gewichtiger Gründe. Die vorliegende Arbeit soll den
Beschränkungen und Verboten von Versammlungen nachspüren.
Zunächst wird das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 GG in seinen Grundelementen
wie der Charakterisierung von Versammlungen als kollektives Handeln, Friedlichkeit und
Waffenlosigkeit skizziert werden, bevor auf die Beschränkungen eingegangen wird. Hier wird
zunächst das Versammlungsgesetz betrachtet, welche die Unterscheidung in Versammlungen unter
freiem Himmel und Versammlungen in geschlossenen Räumen trifft. Desweiteren wird auf das
Uniform- und Vermummungsverbot sowie weitere Auflagen durch zuständige Behörden,
insbesondere das Verwenden von Fahnen und Symbolen, eingegangen. Unter 4.) werden
Einschränkungen durch § 130 IV StGB erörtert, genauer gesagt die Schutzgüter öffentlicher Friede
und Menschenwürde sowie die Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der
nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft. Weiter werden dann das neue bayerische
sowie das sächsische Versammlungsgesetz in ihren Grundzügen betrachtet, bevor einige
Schlussbemerkungen ein kurzes Fazit ziehen sollen.
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG
a) Versammlung als „kollektives Handeln“
b) Friedlichkeit
c) Waffenlosigkeit
3) Beschränkungen durch das Versammlungsgesetz
a) Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel
b) Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen
c) Uniformverbot
d) Vermummungsverbot
e) Auflagen durch zuständige Behörden
f) Exkurs: Verbote von Symbolen, Fahnen etc
4) Beschränkungen durch § 130 IV StGB
a) Schutzgut öffentlicher Frieden
b) Schutzgut Menschenwürde
c) Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der NS-Herrschaft
5) Das Bayerische Versammlungsgesetz
a) Problemstellung
b) Verschärfungen im Versammlungsrecht
6) Das Sächsische Versammlungsgesetz
7) Schlussbemerkungen
8) Anhang
9) Literaturverzeichnis
1) Einleitung
Das Recht auf Versammlungsfreiheit kann neben dem Recht auf freie Meinungsäußerung als einer der elementarsten Grundpfeiler der freiheitlichen Demokratie angesehen werden. Beschränkungen und gar Verbote dieses Grundrechtes bedürfen gewichtiger Gründe. Die vorliegende Arbeit soll den Beschränkungen und Verboten von Versammlungen nachspüren.
Zunächst wird das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 GG in seinen Grundelementen wie der Charakterisierung von Versammlungen als kollektives Handeln, Friedlichkeit und Waffenlosigkeit skizziert werden, bevor auf die Beschränkungen eingegangen wird. Hier wird zunächst das Versammlungsgesetz betrachtet, welche die Unterscheidung in Versammlungen unter freiem Himmel und Versammlungen in geschlossenen Räumen trifft. Desweiteren wird auf das Uniform- und Vermummungsverbot sowie weitere Auflagen durch zuständige Behörden, insbesondere das Verwenden von Fahnen und Symbolen, eingegangen. Unter 4.) werden Einschränkungen durch § 130 IV StGB erörtert, genauer gesagt die Schutzgüter öffentlicher Friede und Menschenwürde sowie die Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft. Weiter werden dann das neue bayerische sowie das sächsische Versammlungsgesetz in ihren Grundzügen betrachtet, bevor einige Schlussbemerkungen ein kurzes Fazit ziehen sollen.
2) Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG
Gem. Art. 8 I GG haben alle Deutschen „das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“. Dieses Recht kann nach Art. 8 II GG für Versammlungen unter freiem Himmel aufgrund eines Gesetzes oder durch ein Gesetz beschränkt werden.
Der Auslegung des Art. 8 GG gem. der liberalen und menschenrechtlichen Tradition folgend gilt die Versammlung als „unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit und als eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt“[1]. Durch die Tatsache, dass sowohl Form, Zeitpunkt und Bedingungen der Meinungsäußerung vom Anmelder selbst entschieden werden kann, gelten Versammlungen als „Ausdruck und Bedingung der freien Entfaltung der Persönlichkeit und verwirklichen zugleich die Menschenwürde“[2].
Nach der demokratischen Grundrechtsauslegung sind Versammlungen „ein unentbehrliches Element für die Funktionsfähigkeit der Demokratie“[3]. Dabei erfüllen Versammlungen mehrere Funktionen. Primär wirken sie „als Medium zur Verstärkung der individuellen Meinungsfreiheit in den öffentlichen Bereich hinein“, sie sind also auch das Medium derer, welche keine Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) selbst betreiben (können)[4]. Desweiteren erfüllen Versammlungen eine Korrektivfunktion, welche „den Repräsentativorganen Störpotentiale anzeige, Integrationsdefizite sichtbar und Kurskorrekturen der offiziellen Politik sichtbar mache“[5]. Auf diese Weise wirken sie an der Bildung der öffentlichen Meinung mit.[6] Durch ihre Artikulationsfunktion tragen Versammlungen „gerade unter den Bedingungen der repräsentativen Demokratie dazu bei, die Distanz zwischen Repräsentanten und Repräsentierten zu überbrücken“[7]. Auf diese Weise sind Versammlungen „Ausdruck der Volkssouveränität und demgemäß als demokratisches Bürgerrecht zur aktiven Teilnahme am politischen Prozeß“ (sic!) zu begreifen[8]. Versammlungen sind somit – unabhängig von den bei ihnen kundgegebenen Ansichten – ein Element des Pluralismus und Medium von Mehrheiten oder Minderheiten[9]. Damit ist die „Versammlungsfreiheit für die Staatsform der demokratischen Republik konstituierend“ (sic!)[10].
a) Versammlung als „kollektives Handeln“
Die Versammlungsfreiheit ist als mehr anzusehen als „ein bloßer Annex der Handlungsfreiheiten des einzelnen“[11]. Kollektives Handeln durch Versammlungen wirkt in zweifacher Weise: zum Einen wirkt es durch sein erhöhtes Aufmerksamkeitspotenzial am Ort der Veranstaltung selbst sowie durch verstärkte Medienpräsenz, zum anderen entstehen bei den Versammlungsteilnehmern Gemeinschaftserlebnisse, welche Einstellungen und Handlungen bestärken bzw. verändern können.[12] „Kollektives Handeln ist mehr und anderes als die Fortsetzung individuellen Handelns mit anderen“ (sic!), weshalb es besonderen Schutzes und besonderer Regelungen bedarf[13].
Als Versammlung bezeichnet man „das Zusammenkommen mehrerer Menschen zu gemeinsamer Zweckverfolgung, genauer gesagt: zu gemeinsamem Handeln“ (sic!)[14]. Dabei kann eine Versammlung bereits aus zwei Personen bestehen.[15] „Ein-Mann-Versammlungen“ hingegen gelten nicht als kollektives Handeln sondern fallen unter das jeweilige individuelle Grundrecht.[16] Ein weiterer Aspekt ist die Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes, der die Versammlung „von der bloß physischen Präsenz einer Vielzahl von Menschen (Neugierige an einem Informationsstand (…) u.a.) abgrenzen“ soll[17]. Es dürfen dabei „weder an die Konkretisierung des Zwecks noch an die Gemeinsamkeit des Zwecks hohe Anforderungen gestellt werden“[18]. Wer jedoch mit seiner Anwesenheit „erkennbar andere verfolgt, ist kein Versammlungsteilnehmer und kann sich für sein Verhalten nicht auf Art. 8 berufen“[19]. Der Zweck selbst wird in Art. 8 nicht näher erläutert, sodass der „Inhalt des gemeinsamen Zwecks der Teilnehmer (…) für die Qualifikation als Versammlung rechtlich gleichgültig“ (sic!) ist[20].
Von Versammlungen zu unterscheiden ist die bloße Ansammlung von Menschen, bei der jeder Anwesende „den eigenen Zweck ohne Rücksicht auf zufällig gleiche Zwecke anderer verfolgt“[21]. Unter Ansammlungen sind z.B. auch „bloßes Publikum“ zu verstehen, „wobei zwar alle denselben Zweck verfolgen, dieser aber kein gemeinsamer ist“[22]. Dabei ist eine Abgrenzung oft schwierig. Zuschauer/Publikum bei „rein kommerziellen Veranstaltungen, Triumphzügen und Beifallskundgebungen für Künstler und Sportler sind regelmäßig keine Versammlungen“[23]. Anders ist die Sachlage, wenn „die Anwesenheit des Publikums einen über bloße Kenntnisnahme hinausgehenden Gehalt aufweist (etwa: Solidarität oder Parteinahme bei Zuschauern eines Leichenzuges) oder die Zuschauer an der Zweckverfolgung durch die Veranstalter oder Mitwirkenden mittelbar beteiligt sind („Rock gegen rechts“)“[24].
Als weiterer Aspekt ist die gemeinsame Verfolgung des Zwecks nötig. Dabei muss nicht nur der Zweck gemeinsam sein, „sondern auch dessen Verfolgung muß durch mehrere Personen gemeinsam geschehen“ (sic!)[25]. Versammlungen sind prinzipiell als „unorganisiertes kollektives Handeln“ zu betrachten;[26] organisiertes kollektives Handeln (Vereine etc.) wird von Art. 9 GG geschützt.[27] Die Art des kollektiven Handelns ist dabei nicht näher spezifiziert.[28] So schützt Art. 8 GG „vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens bis hin zu nicht verbalen Ausdrucksformen“[29], so z.B. bis hin zum „gemeinsamen Schweigen, stummem oder beredtem Zeigen von Gegenständen, ortsgebunden oder sich fortbewegend, tanzend oder durch sonstige Formen“[30]. Eine Mindest- oder Höchstdauer ist dabei nicht vorgesehen.[31]
b) Friedlichkeit
Die erste Einschränkung der Versammlungsfreiheit ist bereits in Art. 8 I GG bereits selbst genannt: Friedlichkeit. Die zweite Einschränkung, Waffenlosigkeit, wird dabei mit der ersten als kumulativ angesehen.[32] So kann sich jemand, der sich „unfriedlich oder bewaffnet versammelt, (…) von vornherein nicht auf den Grundrechtsschutz berufen“[33]. Dennoch sind Versammlungen nicht umgehend als unfriedlich anzusehen, wenn gegen Normen des Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder Verwaltungsrecht verstoßen wird.[34] Als friedlich ist eine Versammlung anzusehen, „wenn weder ihr Zweck noch ihr Verlauf die Begehung oder den Versuch von Straftaten gegen Leib, Leben, Freiheit oder sonstige erhebliche Rechtsgüter Dritter oder der Allgemeinheit mit sich bringt“ (sic!)[35]. Somit ist weder Gewalt gegen Personen noch Gewalt gegen Sachen grundgesetzlich geschützt.[36] Dabei kann sowohl die Versammlung sowie das Verhalten einzelner oder aller Teilnehmer unfriedlich sein, v.a. bei „körperliche[n] Übergriffe[n] der Teilnehmer auf Rechtsgüter Dritter sowie der Aufruf zu ihrer unmittelbaren Begehung“[37]. Dritte sind dabei sowohl Außenstehende, Versammlungsteilnehmer als auch Teilnehmer anderer (gleichzeitig stattfindender) Versammlungen.[38] „Die Absicht, eine andere Versammlung notfalls gewaltsam sprengen zu wollen, begründet die Unfriedlichkeit der Gegendemonstration“[39].
Praktisch stellt sich die Frage, „unter welchen Voraussetzungen (…) das Auftreten unfriedlicher Versammlungsteilnehmer die (ganze) Versammlung unfriedlich“ macht[40]. So schließt „das Auftreten anderer, unfriedlicher Teilnehmer (…) die Versammlungsfreiheit der Friedlichen nicht aus“[41]. Vor allem gilt dies, „wenn die Unfriedlichen eine eigene Gegendemonstration bilden und die erste Versammlung von außen stören“[42]. Eine Versammlung gilt dann als unfriedlich, „wenn sich die Versammlungsleitung oder die Mehrzahl der Teilnehmer mit ihnen [den Unfriedlichen, Anm. d. Verf.] solidarisieren“[43]. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. So kann eine Versammlung auch dann als unfriedlich angesehen und damit verboten bzw. aufgelöst werden, „wenn die Unfriedlichkeit als »Panne« auftritt“[44]. Eine Blockade von Ein- und Ausgängen von Gebäuden, Grundstücken oder Straßen (Sitzblockade/Sitzstreik) „kann keine friedliche Versammlung sein“[45], sondern wird als Gewalttätigkeit i.S.d. § 125 I StGB begriffen[46]. Der Gewaltbegriff beschränkt sich dabei nicht nur auf „den sichtbaren Einsatz einer physischen Kraftentfaltung“[47].
Zur Abwägung von Friedlichkeit bzw. Unfriedlichkeit einer Versammlung zählt die Gefahrenprognose. Dabei sind drei Faktoren zu berücksichtigen:
„(1) der besondere grundrechtliche Schutz der Versammlungsfreiheit. Sie erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes bei der Abwägung vorhandener Gefahrenindizien; (2) die Höhe möglicher Schäden für die Rechtsgüter betroffener Dritter bzw. der Allgemeinheit; (3) die Wahrscheinlichkeit, daß sich jene möglichen Schäden im Verlauf der Versammlung realisieren könnten“ (sic!)[48].
Dabei ist sowohl das Verhalten der Teilnehmer und der Opfer als „auch die staatlichen Möglichkeiten, durch eigene Vorkehrungen das Entstehen von Gefahren zu verhindern bzw. Dritte zu schützen“ mit einzubeziehen[49].
c) Waffenlosigkeit
Wie bereits erwähnt, steht das Merkmal der Waffenlosigkeit in einem systematischen Kontext zur Friedlichkeit.[50] Eine Versammlung gilt als „ohne Waffen“, wenn „die Teilnehmer keine Gegenstände mit sich führen, welche ausschließlich oder überwiegend dem Zweck dienen, zur Begehung von Straftaten gegen Dritte angewendet zu werden“ (sic!)[51]. Dabei kommen sowohl Waffen i.S.d. § 1 WaffenG als auch Gegenstände, welche „ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur (erheblichen) Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind (§ 2 Abs. 3 VersG), wie etwa Eisenstangen oder Steine“, in Betracht[52]. Eiern, faulen Früchten oder Farbbeuteln fehlt diese Eigenschaft, weshalb sie nicht als Waffen angesehen werden.[53] Sie verursachen keine körperlichen Verletzungen, sondern geben den Betroffenen eher der Lächerlichkeit preis.[54] Diese Meinung ist jedoch höchst umstritten.[55] Strittig ist ebenso die Einordnung sog. „Schutzwaffen“ bzw. „Defensivwaffen“. Einerseits gelten sie nicht als Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, andererseits werden sie von § 17a I VersG erfasst und verboten.
[...]
[1] BVerfGE 69, 315, 344.
[2] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 9.
[3] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 11.
[4] ebd.
[5] ebd.
[6] ebd.
[7] ebd.
[8] ebd.
[9] vgl. ebd.
[10] ebd.
[11] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 9.
[12] vgl. Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 9, 10.
[13] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 10.
[14] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 15.
[15] vgl. ebd.
[16] vgl. ebd.
[17] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 16.
[18] ebd.
[19] ebd.
[20] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 17.
[21] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 19.
[22] ebd.
[23] ebd.
[24] ebd.
[25] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 20.
[26] vgl. ebd.
[27] vgl. ebd.
[28] vgl. ebd.
[29] ebd.
[30] ebd.
[31] ebd.
[32] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 22.
[33] ebd.
[34] vgl. ebd.
[35] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 23.
[36] vgl. ebd.
[37] ebd.
[38] vgl. ebd.
[39] ebd.
[40] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 24.
[41] ebd.
[42] ebd.
[43] ebd.
[44] Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 8 Rdnr. 4.
[45] ebd.
[46] vgl. ebd.
[47] vgl. ebd.
[48] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 25.
[49] ebd.
[50] vgl. Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 26.
[51] Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 8 Rdnr. 27.
[52] ebd.
[53] vgl. ebd.
[54] vgl. ebd.
[55] Wüstenbecker: Besonderes Ordnungsrecht, S. 13.
Häufig gestellte Fragen
Was schützt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG)?
Es schützt das Recht aller Deutschen, sich friedlich und ohne Waffen ohne Anmeldung oder Erlaubnis zu versammeln.
Wann gilt eine Versammlung als 'unfriedlich'?
Eine Versammlung ist unfriedlich, wenn Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen stattfinden oder wenn sie unmittelbar auf solche abzielt.
Was besagt das Uniformverbot?
Es untersagt das Tragen von Uniformen oder gleichartigen Kleidungsstücken als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung, um Einschüchterungseffekte zu vermeiden.
Welche Rolle spielt § 130 IV StGB bei Versammlungen?
Dieser Paragraph ermöglicht Einschränkungen, wenn die öffentliche Versammlung die Würde der Opfer des Nationalsozialismus verletzt oder die NS-Gewaltherrschaft billigt.
Dürfen Versammlungen unter freiem Himmel verboten werden?
Ja, ein Verbot ist als Ultima Ratio möglich, wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung besteht, die nicht durch Auflagen abgewehrt werden kann.
- Quote paper
- Christian Spernbauer (Author), 2008, Sonderrecht gegen "Rechts"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117835