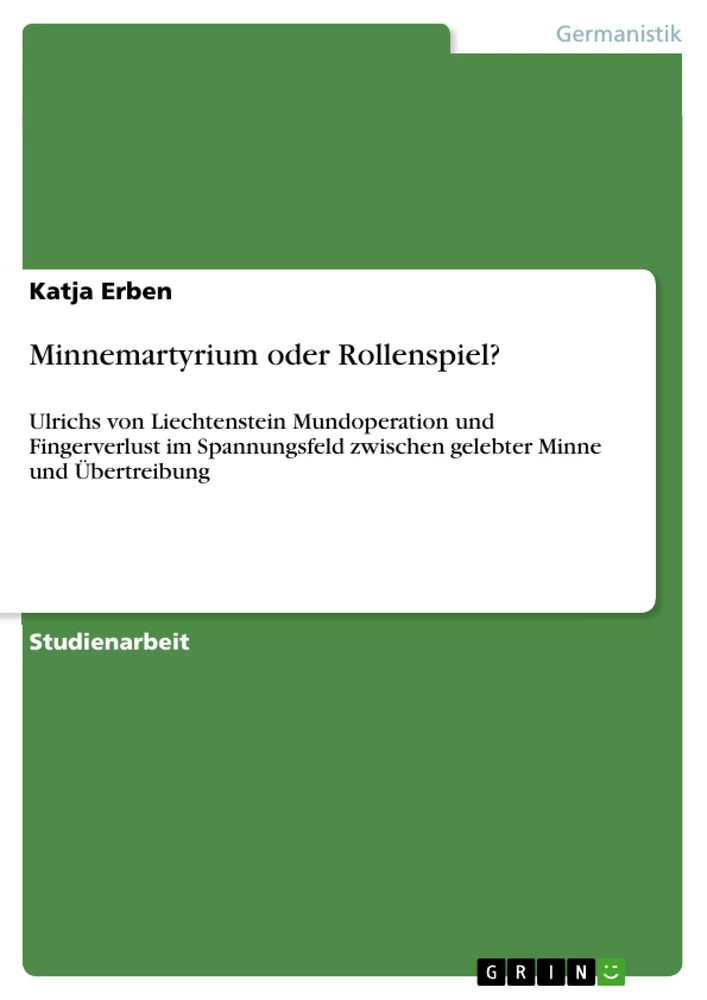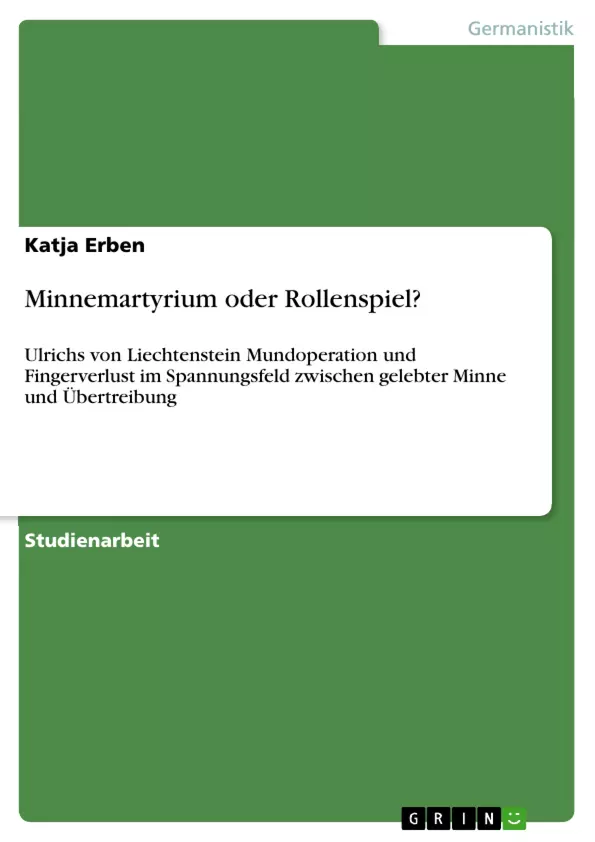Ulrichs von Liechtenstein pseudobiographischer Roman ‚Frauendienst’, der zeitlich um 1255 einzuordnen ist, ist der erste Ich-Roman in (mittelhoch)deutscher Sprache und erzählt von zwei Minnediensten, die die literarische Figur Ulrich erlebt.
Meine Arbeit beschäftigt sich mit einem wesentlichen Aspekt des ersten Dienstes, mit den Körperverstümmelungen, die Ulrich als Beweis seiner unbegrenzten Dienstbarkeit gegenüber seiner erwählten Minnedame über sich ergehen lässt. Diese Körpermanipulationen fügen sich innerhalb des ‚Frauendienstes’ in ein Minne- und Kommunikationskonzept ein, das sich aus drei miteinander verbundenen mittelalterlichen Gesellschaftskonstrukten zusammensetzt. Bei dieser Dreiteilung folge ich Sandra Linden , die zwischen Botenkommunikation, also der indirekten Auseinandersetzung zwischen Minnedame und Minneritter mittels eines Boten und der Wort- und Tat-Kommunikation, das heißt der Verbindung von körperlicher und geistiger (schriftlicher) Kommunikation im Minnedienst, unterscheidet. Als dritte Kategorie kommt der gesellschaftliche Aspekt des Minnens hinzu, der den Minnedienst als höfisches Spiel innerhalb (fester) Rollenmuster begreift.
Es wird zu untersuchen sein, inwieweit Ulrichs Verstümmelungen symptomatisch für die (fehlgeschlagene) Kommunikation zwischen ihm und seiner Dame sind.
Im Hauptteil meiner Arbeit werde ich dementsprechend auf die Kommunikationsformen und auf das „Ausdrucksdilemma“ eingehen und das Minnemartyrium Ulrichs beschreiben (unter II A), während unter B die Rollenhaftigkeit des ‚Minnespiels’ im Zentrum steht, in der die Fiktionalität des Dienstes hervorgehoben wird.
Innerhalb dieser Analyse werde ich versuchen die Nähe zum Text aufrechtzuerhalten und interpretiere daher punktiert die Szene der Mundoperation und des Fingerverlustes, wie es dazu kommt und wohin es führt. In meinem Fazit werde ich letztlich versuchen die im Titel der Arbeit gestellte Frage ‚Minnemartyrium oder Rollenspiel?’ zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung und Themeneingrenzung
II. Hauptteil:
A. Die gestörte Kommunikation zwischen Ulrich und seiner ersten Dame und die Konsequenzen dieses ‚Ausdrucksdilemmas’
1. Die Mundoperation
2. Der Verlust des Fingers
B. Rollenspiel – Ulrichs übertriebene Minnehandlungen als Kritik an der Hohen Minne
III. Fazit
IV. Literaturverzeichnis
I. Einleitung und Themeneingrenzung
Ulrichs von Liechtenstein pseudobiographischer Roman ‚Frauendienst’, der zeitlich um 1255[1] einzuordnen ist, ist der erste Ich-Roman in (mittelhoch)deutscher Sprache und erzählt von zwei Minnediensten, die die literarische Figur Ulrich erlebt.
Meine Arbeit beschäftigt sich mit einem wesentlichen Aspekt des ersten Dienstes, mit den Körperverstümmelungen, die Ulrich als Beweis seiner unbegrenzten Dienstbarkeit gegenüber seiner erwählten Minnedame über sich ergehen lässt. Diese Körpermanipulationen fügen sich innerhalb des ‚Frauendienstes’ in ein Minne- und Kommunikationskonzept ein, das sich aus drei miteinander verbundenen mittelalterlichen Gesellschaftskonstrukten zusammensetzt. Bei dieser Dreiteilung folge ich Sandra Linden[2], die zwischen Botenkommunikation, also der indirekten Auseinandersetzung zwischen Minnedame und Minneritter mittels eines Boten und der Wort- und Tat-Kommunikation, das heißt der Verbindung von körperlicher und geistiger (schriftlicher) Kommunikation im Minnedienst, unterscheidet. Als dritte Kategorie kommt der gesellschaftliche Aspekt des Minnens hinzu, der den Minnedienst als höfisches Spiel innerhalb (fester) Rollenmuster begreift.
Es wird zu untersuchen sein, inwieweit Ulrichs Verstümmelungen symptomatisch für die (fehlgeschlagene) Kommunikation zwischen ihm und seiner Dame sind.
Im Hauptteil meiner Arbeit werde ich dementsprechend auf die Kommunikationsformen und auf das „Ausdrucksdilemma“[3] eingehen und das Minnemartyrium Ulrichs beschreiben (unter II A), während unter B die Rollenhaftigkeit des ‚Minnespiels’ im Zentrum steht, in der die Fiktionalität des Dienstes hervorgehoben wird.
Innerhalb dieser Analyse werde ich versuchen die Nähe zum Text aufrechtzuerhalten und interpretiere daher punktiert die Szene der Mundoperation und des Fingerverlustes, wie es dazu kommt und wohin es führt. In meinem Fazit werde ich letztlich versuchen die im Titel der Arbeit gestellte Frage ‚Minnemartyrium oder Rollenspiel?’ zu beantworten.
II. Hauptteil
Ich benutze zum Zitieren aus dem Primärtext die Ausgabe[4], die von Reinhold Bechstein 1888 herausgegeben wurde. Dabei zitiere ich den Originaltext in einfachen Anführungsstrichen und gebe in runden Klammern und kursiv meine Übersetzung und jeweils Strophe und Vers(e) an.
A. Die gestörte Kommunikation zwischen Ulrich und seiner ersten Dame und die Konsequenzen dieses ‚Ausdrucksdilemmas’
1. Die Mundoperation
Die Episode der Mundoperation ereignet sich direkt zu Beginn des ersten Dienstes. Ulrich vertraut seiner Niftel (Nichte oder Tante) an, wer seine Minnedame ist (Strophe 62) und diese Niftel soll dann für ihn die ‚Liebesbotin’ spielen: ‚[…] sô soltu ir von mir des swern, / daz sî mir gar âne argen list / diu liebest in mînem herzen ist.’ ([…] so sollst du ihr von mir das schwören, dass sie mir ohne Falschheit die Liebste in meinem Herzen ist.; 63,6-63,8). Am Beginn des Dienstes und auch im weiteren Verlauf ist die Kommunikation über einen Boten kennzeichnend für die verbale Auseinandersetzung zwischen Ulrich und seiner Dame. Seine Niftel übernimmt dabei die Rolle der Botin, die die Botschaften der beiden eigentlich Handelnden überbringt. Sie bleibt dabei jedoch nicht nur passiv, sondern kommentiert die Nachrichten auch. Der externe Zuhörer beziehungsweise Leser des Romans ist anwesend, wenn Ulrich ihr den Auftrag gibt, einen Brief und das Geständnis des Minnedienstes an die Dame zu überbringen und dann erst wieder, wenn die Niftel Ulrich von ihrem Botendienst berichtet. Das Gespräch zwischen Botin und Dame bleibt sowohl Ulrich, als auch dem Publikum unbekannt. Ulrich (und auch der Zuhörer) muss sich also darauf verlassen, was die Botin berichtet. Sie pointiert das Gespräch mit Äußerungen, die ihre eigene Meinung repräsentieren. Schon der erste Satz aus ihrem Mund bezieht sich auf ihre passive Rolle ‚ich hân dir getân, / daz ich vil pillich hete lân […]’ (Ich habe für dich getan, was ich richtiger hätte gelassen […]; 70,5f.) und gibt nicht nüchtern wieder, was sie erfahren hat. Sicherlich ist das für jeden nachvollziehbar, denn man legt in jedem Gespräch subjektiv Schwerpunkte, lässt Dinge weg, die einem unwichtig erscheinen, für den anderen aber wichtig sein könnten, oder schmückt bestimmte Sachverhalte aus. Es ist dabei jedoch wichtig zu beachten, dass die Nachrichtenübermittlung über eine dritte Person immer das Risiko von Missverständnissen birgt, da die Lenkung des Gespräches in der Hand des Boten liegt.
So geschieht es dann auch, dass Ulrichs Niftel ihm mitteilt, dass seiner erwählten Herrin sein Mund nicht gefällt ‚[…] iedoch sô müest wol wesen leit / einem wîbe ze aller stunt / sîn ungefüege stênter munt.’ (jedoch so muss einer Frau zu jeder Zeit wohl leid sein, sein missgestaltet stehender Mund; 80,4-80-6), doch sie kann ihm nicht vermitteln, dass es sich dabei nur um einen Grund unter wahrscheinlich vielen handelt, warum die Minnedame seinen Dienst ablehnt. Ulrich sieht in der Kritik hingegen die Aufforderung sich einer schmerzhaften Operation zu unterziehen, damit die Dame seinen Dienst doch annehmen könnte. Die Niftel kann ihn nicht von diesem Schritt abhalten, in dem sie ihm Argumente der Herrin entgegensetzt (etwa, dass die Operation an der Situation nichts ändern würde), weil sie diese nicht kennt und sie nicht über soviel Weitsicht verfügt, diese zu antizipieren. Im Gegensatz antwortet sie auf das Vorhaben ihres Neve mit Trotz ‚Sô will ich niht wesen bot.’ (So will ich nicht der Bote sein; 83,1), beziehungsweise mit religiösen Äußerungen ‚Mit rehten triuwen sô rât ich, / daz dû sô iht verderbest dich. / leb als dich got hab heizen leben, / und hab, daz er dir hab gegeben, / von im vil willeclîch für guot.’ (Mit rechter Treue so rate ich dir, so verdirbst du etwas an dir. Lebe, wie Gott dein Leben schuf und halte, was er dir von sich gegeben hat, sehr entschlossen für gut.; 85,1-85-5).
Ulrich lässt sich seinen Mund entgegen der Warnungen operieren und nimmt als Zeugen einen Knecht der Herrin mit, der ihr die Nachricht überbringen will, dass er es tatsächlich gemacht hat und auch, wie manlîch er das ertragen hat.
Es wird also deutlich, dass sich die gestörte Kommunikation zwischen Dame und Ulrich einerseits auf der verbalen Ebene abspielt, die in seiner Fehlinterpretation mündet und andererseits dadurch auch die körperliche Ebene erreicht. Ausführlich beschreibt Ulrich die Operation und deren schmerzhafte Folgen. Er beschreitet damit den Pfad eines Minnemärtyrers, der für die Liebe auch körperliche Schmerzen auf sich nimmt und sie in ihrer ganzen Konsequenz erträgt. Verstärkt wird die Handlung, die an sich schon absurd genug ist, durch die Beschreibung des Heilungsprozesses. Seine Lippe schwillt auf die Größe eines Schlagballes an (97, 4) und wird mit einer, die Entzündung hemmenden grünen Salbe behandelt, ‚diu stanc alsam ein fûler hunt.’ (Die stank so wie ein fauler Hund, 103,8). Der Gestank greift über die Nahrung auf seinen ganzen Körper zu, aufgrund dessen er weder essen noch trinken kann. Ulrich vergleicht seine Lage mit ‚siechenden’ Kranken und steigert seine Martyriumsbeschreibung mit dem Satz ‚[…] sô tet ich, als die tuont, / die vor siechtum ouch ezent niht: / des wart mîn lîp vil gar enwiht (Ich tat so, wie die tun, die wegen Krankheit auch nichts essen: deshalb war mein Körper sehr kraftlos.; 104,6-104,8), um dann davon zu schweigen (105,1).
[...]
[1] vgl. Grubmüller, Klaus: Minne und Geschichtserfahrung. Zum ‚Frauendienst’ Ulrichs von Liechtenstein. in: Christoph Gerhardt (Hrsg.): Geschichtsbewußtsein in der deutschen Literatur des Mittelalters: Tübinger Colloquium 1983, Tübingen 1985, S. 37
[2] Linden, Sandra: Kundschafter der Kommunikation: Modelle höfischer Kommunikation im "Frauendienst" Ulrichs von Lichtenstein, Tübingen 2004
[3] Dies., S. 56
[4] vollständige bibliographische Angabe siehe Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ulrich von Liechtensteins „Frauendienst“?
Der Roman erzählt von den Minnediensten der literarischen Figur Ulrich und ist der erste Ich-Roman in mittelhochdeutscher Sprache.
Warum unterzog sich Ulrich einer Mundoperation?
Aufgrund einer Fehlinterpretation der Kritik seiner Dame an seinem Mund sah Ulrich die Operation als notwendigen Beweis seiner Dienstbarkeit an.
Was symbolisieren die Körperverstümmelungen im Roman?
Sie dienen als radikaler Beweis unbegrenzter Dienstbarkeit und sind Ausdruck einer gestörten Kommunikation zwischen Ritter und Dame.
Ist der Minnedienst ein ernsthaftes Martyrium oder ein Spiel?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen dem schmerzhaften Minnemartyrium und der Rollenhaftigkeit des höfischen Minnespiels.
Welche Rolle spielen Boten in der Kommunikation?
Die Botenkommunikation birgt Risiken für Missverständnisse, da Nachrichten subjektiv gefiltert und interpretiert werden, was im Roman zu fatalen Folgen führt.
- Citation du texte
- Katja Erben (Auteur), 2005, Minnemartyrium oder Rollenspiel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117876