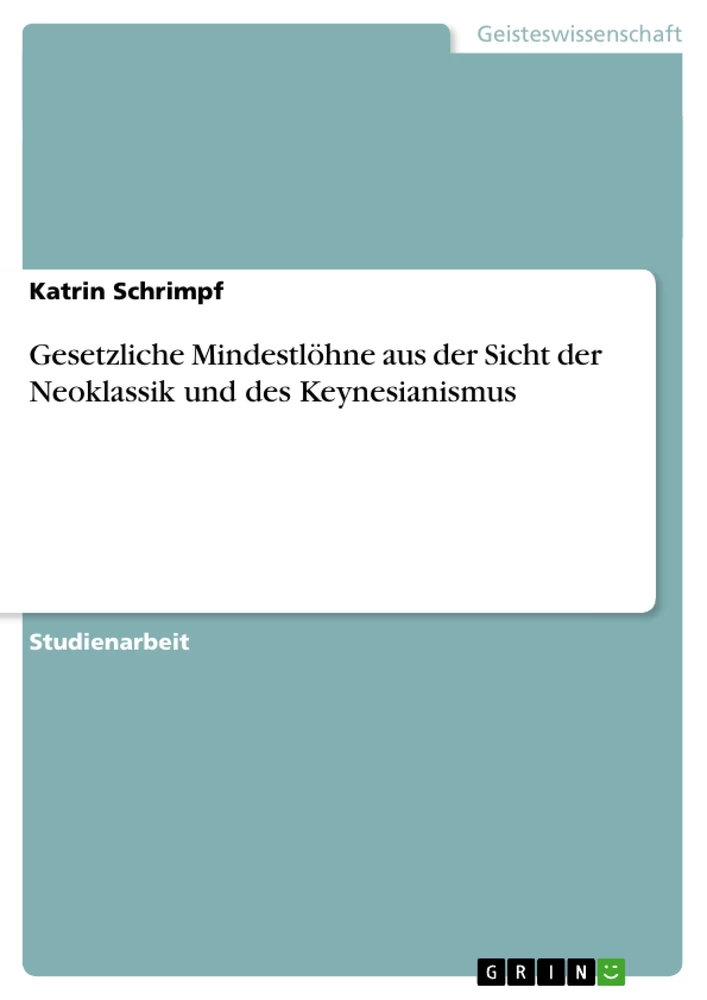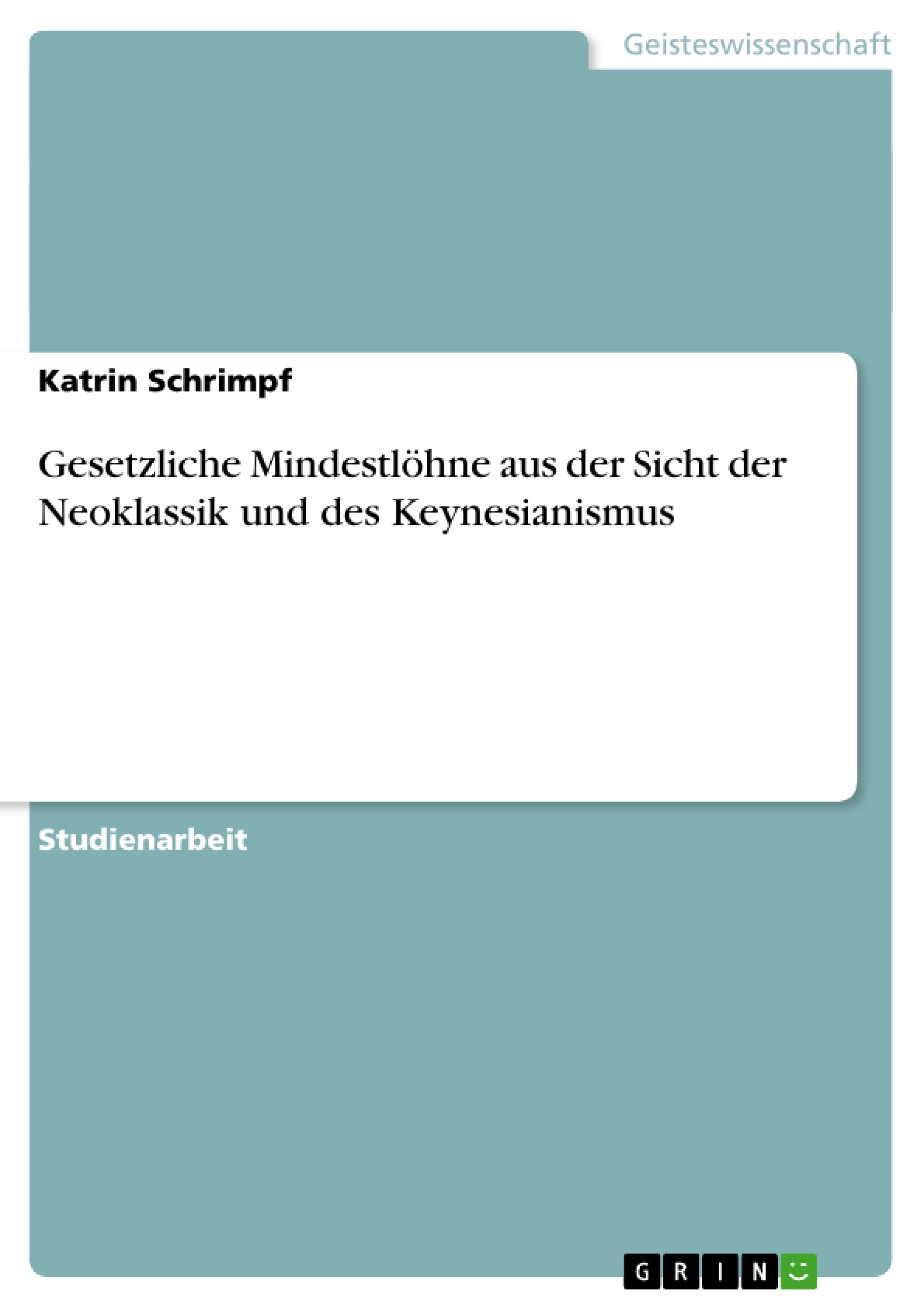Die hohe Arbeitslosigkeit sowie der seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich wachsende
Niedriglohnsektor in Deutschland drängt die Bundesregierung zum Handeln. Verschiedenste
Möglichkeiten zum Abbau der Arbeitslosigkeit werden derzeit diskutiert, unter anderem auch
die Einführung eines Mindestlohns, wobei dieser eher zur Erhaltung momentaner
Arbeitsplätze sowie zur Existenzsicherung dienen soll, anstatt zum Abbau von
Arbeitslosigkeit.
Ich möchte die Problematik des Mindestlohns in meiner Arbeit aus ökonomischer Sicht
betrachten. Dazu habe ich die Basismodelle der Neoklassik und des Keynesianismus
herangezogen. Diese beiden Arbeitsmarkttheorien haben jeweils andere Annahmen bezüglich
der Auswirkungen nach einer Einführung des Mindestlohns. Grund dafür ist die differenzierte
Vorstellung in Bezug auf das Zustandekommen eines Vollbeschäftigungsgleichgewichts im
jeweiligen Wirtschaftsmodell.
Ziel ist es, diese beiden Modelle und ihre theoretisch fundierten Annahmen bezüglich der
Mindestlohnproblematik darzustellen und zu erläutern. Die Weiterentwicklungen der
klassischen keynesianischen und neoklassischen Theorien kann ich nicht berücksichtigen, da
dies den Rahmen meiner Arbeit sprengen würde.
Einleitend werde ich kurz die Arbeitsmarktsituation Deutschlands mit Hilfe von empirischen
Daten der OECD erläutern und die Erfahrungen, welche bereits andere Länder mit der
Einführung eines Mindestlohns gemacht haben, skizzieren. Abschließend werde ich die
Kernaussagen meiner Ausführungen nochmals zusammenfassen und ein Fazit formulieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der gesetzliche Mindestlohn
- 2.1. Fakten zur Arbeitslosigkeit in Deutschland
- 2.2. Internationale Erfahrungen mit dem gesetzlichen Mindestlohn
- 3. Neoklassische Arbeitsmarkttheorie
- 4. Der Keynesianismus
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik des gesetzlichen Mindestlohns aus neoklassischer und keynesianischer Perspektive. Ziel ist die Darstellung und Erläuterung der jeweiligen Modelle und ihrer Annahmen bezüglich der Auswirkungen eines Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeit berücksichtigt dabei nicht die Weiterentwicklungen der klassischen Theorien.
- Arbeitslosigkeit in Deutschland
- Internationale Erfahrungen mit Mindestlöhnen
- Neoklassische Arbeitsmarkttheorie und Mindestlohn
- Keynesianismus und Mindestlohn
- Auswirkungen eines Mindestlohns
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die hohe Arbeitslosigkeit und den wachsenden Niedriglohnsektor in Deutschland dar und begründet die Untersuchung des Mindestlohns aus ökonomischer Sicht, unter Verwendung neoklassischer und keynesianischer Modelle. Die unterschiedlichen Annahmen beider Theorien bezüglich des Vollbeschäftigungsgleichgewichts werden hervorgehoben. Die Arbeit skizziert den Aufbau, beginnend mit der Darstellung der Arbeitsmarktsituation Deutschlands und internationalen Erfahrungen mit Mindestlöhnen, um schließlich zu einem Fazit zu gelangen.
2. Der gesetzliche Mindestlohn: Dieses Kapitel definiert den gesetzlichen Mindestlohn als ein festgelegtes Arbeitsendgeld und beschreibt sein Ziel, die Einkommenssituation der Arbeitnehmer zu verbessern und das Existenzminimum zu sichern. Es beleuchtet bestehende Mindestlöhne in bestimmten deutschen Branchen, die jedoch nicht gesetzlich, sondern tarifvertraglich geregelt sind. Die Problematik von Tariflöhnen unterhalb der Armutsgrenze und die geringe Tarifgebundenheit werden angesprochen.
2.1. Fakten zur Arbeitslosigkeit in Deutschland: Dieser Abschnitt präsentiert Daten zur hohen und verfestigten Arbeitslosigkeit in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten und den USA. Der hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen und die problematische Situation älterer und geringqualifizierter Arbeitsuchender werden im Detail beschrieben und international verglichen, wobei die schlechte Position Deutschlands hervorgehoben wird.
2.2. Internationale Erfahrungen mit dem gesetzlichen Mindestlohn: Dieser Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Mindestlohn-Systeme in Europa und den USA, wobei die Bandbreite der Mindestlöhne von über 1000 Euro pro Monat bis hin zu deutlich niedrigeren Beträgen in einigen osteuropäischen Ländern deutlich gemacht wird. Das Beispiel Frankreichs mit dem SMIC und seine Funktion als Teilhabesicherung an der wirtschaftlichen Entwicklung werden ebenso erläutert wie das differenzierte System Japans.
Schlüsselwörter
Gesetzlicher Mindestlohn, Arbeitslosigkeit, Neoklassik, Keynesianismus, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarkt, Vollbeschäftigung, Tariflöhne, internationale Vergleich, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Gesetzlicher Mindestlohn aus neoklassischer und keynesianischer Perspektive
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt aus neoklassischer und keynesianischer Perspektive. Sie analysiert die jeweiligen Modelle, deren Annahmen und deren Vorhersagen bezüglich der Auswirkungen eines Mindestlohns.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Arbeitslosigkeit in Deutschland, internationale Erfahrungen mit Mindestlöhnen, die neoklassische Arbeitsmarkttheorie und deren Anwendung auf den Mindestlohn, den Keynesianismus und seine Sichtweise zum Mindestlohn sowie die generellen Auswirkungen eines Mindestlohns.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum gesetzlichen Mindestlohn (inklusive Unterkapitel zu Arbeitslosigkeit in Deutschland und internationalen Erfahrungen), ein Kapitel zur neoklassischen Arbeitsmarkttheorie, ein Kapitel zum Keynesianismus und eine Schlussfolgerung.
Wie wird die Arbeitslosigkeit in Deutschland dargestellt?
Das Dokument präsentiert Daten zur hohen und anhaltenden Arbeitslosigkeit in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten und den USA. Es hebt den hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen und die besondere Problematik für ältere und geringqualifizierte Arbeitsuchende hervor.
Wie werden internationale Erfahrungen mit Mindestlöhnen dargestellt?
Der Text beschreibt verschiedene Mindestlohnsysteme in Europa und den USA, wobei die große Bandbreite der Mindestlohn-Höhen hervorgehoben wird. Beispiele wie Frankreich (SMIC) und Japan mit ihren unterschiedlichen Systemen werden erläutert.
Welche ökonomischen Perspektiven werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die neoklassische und die keynesianische Perspektive auf den Mindestlohn. Die unterschiedlichen Annahmen beider Theorien bezüglich des Vollbeschäftigungsgleichgewichts werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Gesetzlicher Mindestlohn, Arbeitslosigkeit, Neoklassik, Keynesianismus, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarkt, Vollbeschäftigung, Tariflöhne, internationaler Vergleich, Deutschland.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Darstellung und Erläuterung der neoklassischen und keynesianischen Modelle und ihrer Annahmen bezüglich der Auswirkungen eines Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt. Weiterentwicklungen der klassischen Theorien werden nicht berücksichtigt.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Daten zur Arbeitslosigkeit in Deutschland und im internationalen Vergleich, um die Situation zu veranschaulichen und die Diskussion über den Mindestlohn zu untermauern. Konkrete Zahlen werden im Text präsentiert, jedoch nicht im Detail in diesem Preview aufgeführt.
- Citar trabajo
- Katrin Schrimpf (Autor), 2007, Gesetzliche Mindestlöhne aus der Sicht der Neoklassik und des Keynesianismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117912