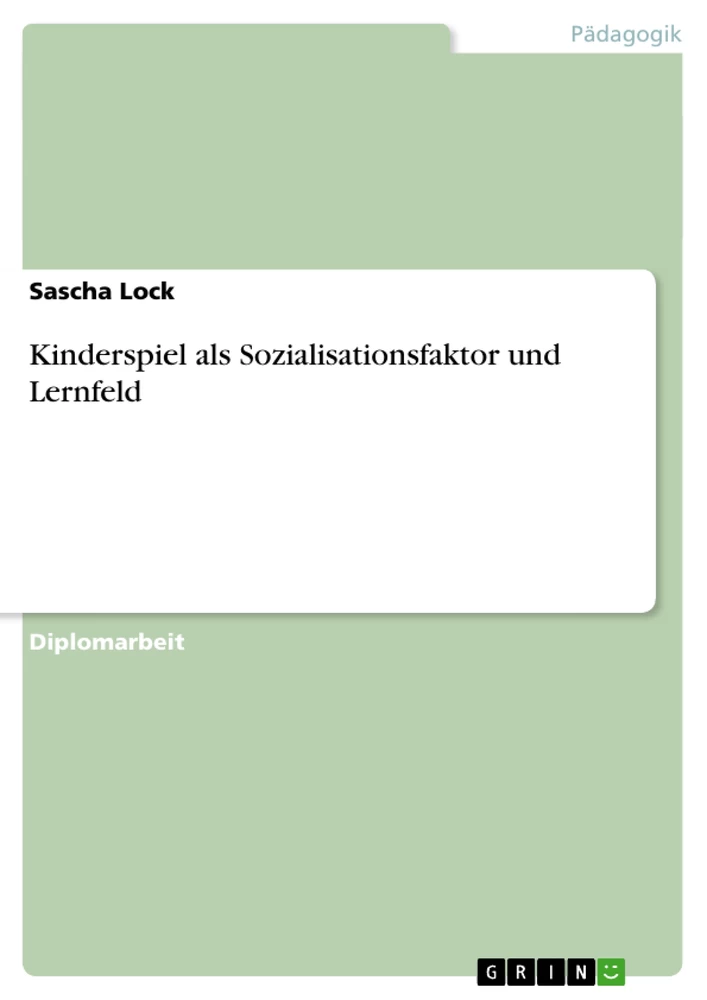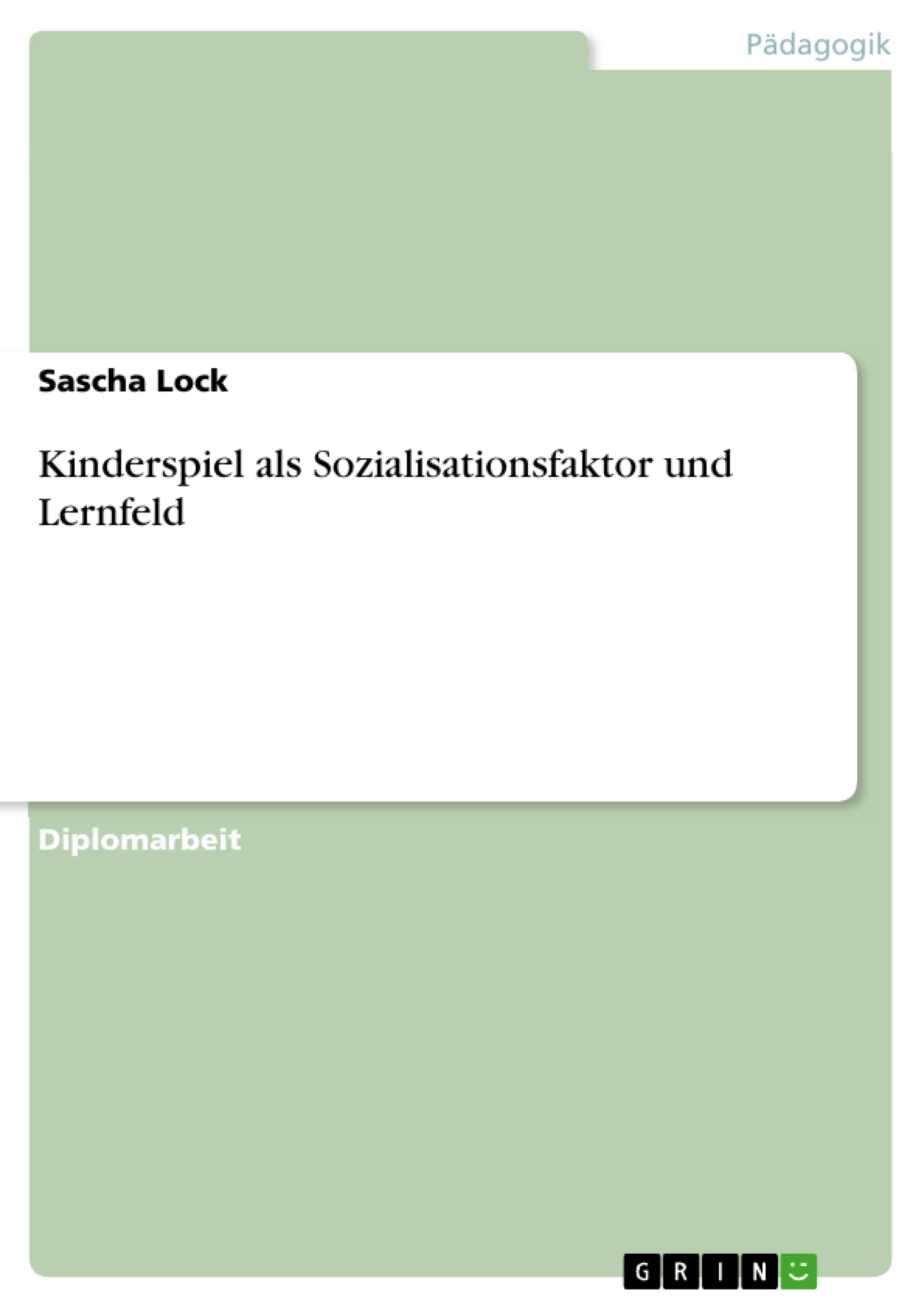Einleitung
In dieser Diplomarbeit beschäftige ich mich mit dem Kinderspiel. Mein Interesse dafür entstand zu Anfang meines Pädagogikstudiums im Oktober 1996. Damals sah ich kurz vor Beginn meines ersten Semesters in der philosophischen Fakultät einen Aushang der Jugendförderung Kirchhain, die eine Honorarkraft für ihren „Spielepool“ suchten. Da ich neben dem Studium pädagogisch tätig sein wollte und mich die Ausschreibung der Jugendförderung ansprach, erkundigte ich mich dort hinsichtlich der Mitarbeit als Spielpool – Betreuer. Ich vereinbarte telefonisch einen Termin mit dem Stadtjugendpfleger und wurde von ihm einige Wochen später zu einem Treffen ins Jugendkulturzentrum in Kirchhain eingeladen. Bei diesem Treffen zeigte er mir den „Spielepool“, der aus einer Sammlung von über 150 Tisch-, Brett- und Kartenspielen bestand. Er erklärte mir, dass die Aufgabe des künftigen, nebenamtlichen Mitarbeiters darin bestand, mit den im Stadtjugendring angeschlossenen Jugendgruppen und den Jugendklubs Spielnachmittage, bzw. Spielabende zu veranstalten, sowie die Ausleihe der Spiele zu verwalten. Ich zeigte Interesse an dieser Arbeit und bekam die Zusage für den Job. In den folgenden Monaten stellte sich jedoch heraus, dass das Spielangebot bei den Jugendgruppen nur geringe Resonanz fand. Daher beschloss die Jugendförderung, Spielnachmittage für Kinder im Jugendkulturzentrum anzubieten. Es entstand der „Spieleladen“, der Spielenachmittag für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Dieses Angebot hielt sich lange als Dauerprogramm des Spielepools, das ich insgesamt 3 ½ Jahre machte. Als Spielebetreuer führte ich im Laufe der Zeit auch verschiedene Sonderveranstaltungen durch, darunter die Siedler – Turniere und die Kirchhainer Kinderspielejury – Testtage. Die Idee zur Kinderspielejury kam mir, als ich bemerkte, dass einige neue, von Erwachsenen empfohlene Gesellschaftsspiele, die wir jährlich für den Spielepool anschafften, unseren Kindern keinen Spaß bereiteten. Deshalb luden wir Kinder aus Kirchhain und den Stadtteilen ein, neue Brett – und Kartenspiele selbst auszuprobieren und anschließend zu bewerten. Die benötigten Spiele liehen wir zunächst von einem Spielwarengeschäft aus. Anschließend kauften wir die beliebtesten Spiele ein. Die Kinderspielejury war zugleich der Vorläufer der im Jahr 2000 entstandenen Kinderspielecrew, in der Kinder an verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum zusammenkommen, um Gesellschaftsspiele zu testen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Ansätze zum Kinderspiel
- Vorüberlegungen zu den Ansätzen
- Das Kinderspiel aus einer motivationspsychologischen Perspektive
- Das Kinderspiel aus einer interaktionistischen Perspektive
- Das Kinderspiel aus einer psychoanalytischen Perspektive
- Das Kinderspiel aus einer ökopsychischen und sozialkulturellen Perspektive
- Zusammenfassung
- Die Entwicklung des Kinderspiels
- Die Klassifikation der Kinderspiele nach Einsiedler
- Die psychomotorischen Spiele
- Die Phantasie- und Rollenspiele
- Die Bauspiele
- Die Regelspiele
- Die Klassifikation der Kinderspiele nach Einsiedler
- Fazit: Bedeutung des Kinderspiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht und aus der Perspektive von Kindern
- Spielen pädagogisch fördern und initiieren
- Einführung in die Spielpädagogik
- Voraussetzung für das Kinderspiel
- Aufgabenbereiche der Spielpädagogik
- Spielpädagogische Planung, Durchführung und Reflexion von Regelspielen in Gruppen
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Funktionen des Kinderspiels und Möglichkeiten seiner spielpädagogischen Förderung und Initiierung. Sie beleuchtet die Wirkungen des Spiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht sowie aus der Perspektive der Kinder selbst. Zusätzlich werden die Rahmenbedingungen, Spieltypen und die Entwicklung des Spielverhaltens im Laufe des Kinderalters betrachtet.
- Funktionen des Kinderspiels aus verschiedenen Perspektiven (entwicklungspsychologisch, sozialisationstheoretisch, kindliche Perspektive)
- Typen und Merkmale von Kinderspielen
- Entwicklung des Spielverhaltens im Kindesalter
- Rahmenbedingungen für das Kinderspiel
- Spielpädagogische Förderung und Initiierung von Kinderspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den persönlichen Werdegang des Autors im Bereich der Spielpädagogik und begründet die Wahl des Themas. Sie führt die Forschungsleitfrage ein: Welche Funktionen hat das Kinderspiel, und wie kann es spielpädagogisch gefördert und initiiert werden? Der Umfang und die Komplexität des Themas werden angesprochen, und die wichtigsten Forschungsfragen werden skizziert.
Theoretische Ansätze zum Kinderspiel: Dieses Kapitel analysiert verschiedene theoretische Perspektiven auf das Kinderspiel, einschließlich motivationspsychologischer, interaktionistischer, psychoanalytischer und ökopsychisch-soziokultureller Ansätze. Die Kapitel untersucht die verschiedenen theoretischen Ansätze und ihre jeweiligen Erklärungen für die Bedeutung des Kinderspiels. Der Vergleich der Ansätze und die daraus resultierenden unterschiedlichen Interpretationen des Kinderspiels werden hervorgehoben, um ein breites Verständnis zu schaffen.
Die Entwicklung des Kinderspiels: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Kinderspiels anhand der Klassifikation von Einsiedler. Es werden verschiedene Spieltypen (psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele) detailliert beschrieben, ihre Entwicklungsphasen im Kindesalter analysiert und deren Funktionen beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Veränderungen im Spielverhalten im Laufe der Entwicklung und dem Zusammenhang mit der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes.
Spielen pädagogisch fördern und initiieren: Dieses Kapitel befasst sich mit der spielpädagogischen Förderung und Initiierung des Kinderspiels. Es werden Voraussetzungen für das Kinderspiel geschaffen, spieldidaktische und methodische Aspekte der Spielanleitung erläutert und die Rolle der Spielpädagogik im Allgemeinen diskutiert. Praktische Beispiele, wie das Geländespiel „Outback“, veranschaulichen die Konzepte der Spielplanung und -durchführung. Der Abschnitt behandelt konkrete Aufgabenbereiche der Spielpädagogik, z.B. die Gestaltung geeigneter Spielräume und die Auswahl passender Spielmittel.
Schlüsselwörter
Kinderspiel, Spielpädagogik, Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Spielverhalten, Spieltypen, psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele, Spielförderung, Spielinitiierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Funktionen des Kinderspiels und Möglichkeiten seiner spielpädagogischen Förderung und Initiierung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Funktionen des Kinderspiels und Möglichkeiten seiner spielpädagogischen Förderung und Initiierung. Sie beleuchtet die Wirkungen des Spiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht sowie aus der Perspektive der Kinder selbst. Zusätzlich werden die Rahmenbedingungen, Spieltypen und die Entwicklung des Spielverhaltens im Laufe des Kinderalters betrachtet.
Welche theoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Perspektiven auf das Kinderspiel, darunter motivationspsychologische, interaktionistische, psychoanalytische und ökopsychisch-soziokulturelle Ansätze. Es wird ein Vergleich der Ansätze und deren unterschiedliche Interpretationen des Kinderspiels vorgenommen.
Wie wird die Entwicklung des Kinderspiels beschrieben?
Die Entwicklung des Kinderspiels wird anhand der Klassifikation von Einsiedler beschrieben. Es werden verschiedene Spieltypen (psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele) detailliert beschrieben, ihre Entwicklungsphasen im Kindesalter analysiert und deren Funktionen beleuchtet.
Was beinhaltet der Abschnitt zur spielpädagogischen Förderung?
Dieser Abschnitt befasst sich mit der spielpädagogischen Förderung und Initiierung des Kinderspiels. Es werden Voraussetzungen für das Kinderspiel geschaffen, spieldidaktische und methodische Aspekte der Spielanleitung erläutert und die Rolle der Spielpädagogik im Allgemeinen diskutiert. Praktische Beispiele veranschaulichen die Konzepte der Spielplanung und -durchführung. Der Abschnitt behandelt konkrete Aufgabenbereiche der Spielpädagogik, z.B. die Gestaltung geeigneter Spielräume und die Auswahl passender Spielmittel.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Funktionen hat das Kinderspiel, und wie kann es spielpädagogisch gefördert und initiiert werden?
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderspiel, Spielpädagogik, Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Spielverhalten, Spieltypen, psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele, Spielförderung, Spielinitiierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Ansätze zum Kinderspiel, Die Entwicklung des Kinderspiels, Spielen pädagogisch fördern und initiieren, und Schlussgedanken. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind.
Welche Perspektiven werden auf das Kinderspiel eingenommen?
Die Arbeit betrachtet das Kinderspiel aus verschiedenen Perspektiven: entwicklungspsychologisch, sozialisationstheoretisch und aus der Perspektive der Kinder selbst.
- Citation du texte
- Sascha Lock (Auteur), 2002, Kinderspiel als Sozialisationsfaktor und Lernfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11793