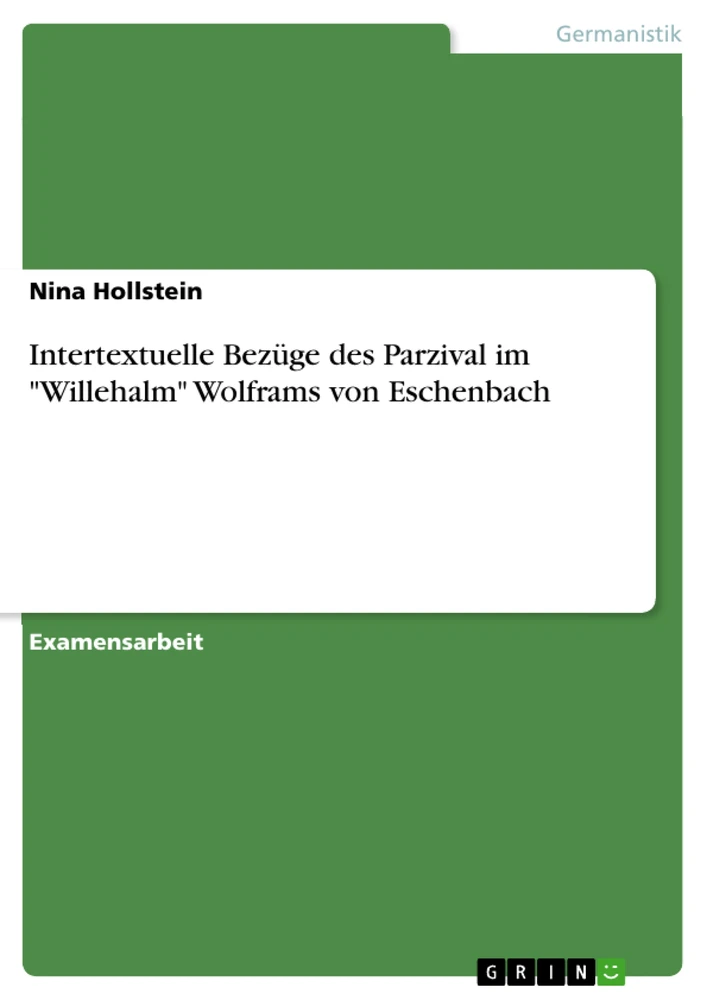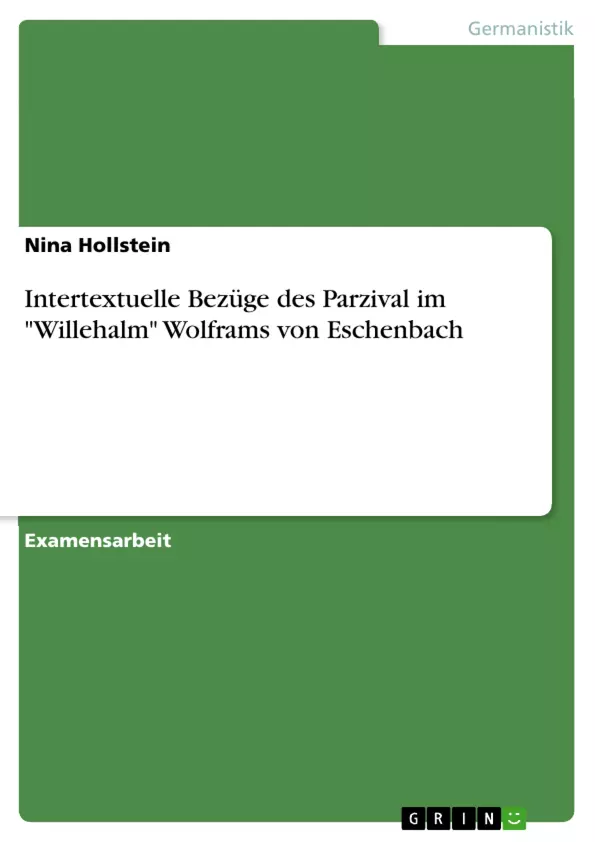Die vorliegende Examensarbeit befasst sich mit den beiden Werken Wolframs von Eschenbach, dem Parzival (~1200/10) und dem unvollendeten Willehalm (~1210/20). Doch nicht nur den Autor haben diese beiden Dichtungen gemeinsam, sondern Wolfram stellt im Verlauf der jüngeren Dichtung auch intertextuelle Bezüge zwischen ihnen her.
Dass sich mittelalterliche Texte auf andere beziehen, ist bekannt, seit sich die Forschung mit diesen Werken auseinandergesetzt hat. Doch zunächst zeigten eine Vielzahl von Untersuchungen lediglich die Quellen und die Einflüsse auf, welche den Übernahmen und Verweisen zu entnehmen waren. Erst in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts - und damit relativ spät - hat die Frage nach dem Sinn der Anspielungen auf ein vorangegangenes Werk, und damit überhaupt erst der Intertextualitätsbegriff, Einzug in die mediävistische Forschung gefunden .
Eben dieser Frage nach dem Grund für die intertextuelle Bezugnahme seitens des Autors wird diese Arbeit nachgehen. Auf der Basis einer Analyse der Intertextualitäten wird sich vor allem mit der Frage nach deren Bedeutung und Funktion für die Texte und die Rezipientenschaft beschäftigt.
Doch vor einer interpretatorischen Auseinandersetzung mit diesem zentralen Untersuchungsgegenstand der Arbeit soll in einem ersten Teil die Frage nach der Rezeption der beiden Werke Wolframs relevant werden. Denn nur, wenn von der Kenntnis des älteren Werkes seitens der Rezipientenschaft auszugehen ist, können die Verweise innerhalb der neueren Dichtung verstanden werden.
Danach erscheint es sinnvoll, kurz den theoretischen Standort zu skizzieren, von dem diese Analyse ausgeht. Die Bandbreite der Veröffentlichungen, die sich mit dem Intertextualitätsbegriff auseinandersetzen, ist sehr groß und der Begriff selbst dementsprechend diffus geworden. Aus diesem Grund wird auf einen umfassenden Überblick über die Intertextualitätsforschung verzichtet, da es Aufgabe und Ziel dieser Arbeit sein wird, einen eigenen, spezifischen Intertextualitätsbegriff für die Beziehung zwischen den beiden Werken Wolframs zu erarbeiten. Nach einer kurzen Skizzierung der möglichen Funktionen von intertextuellen Bezügen wird das Hauptaugenmerk auf der eigentlichen Analyse der einzelnen Willehalm-Textstellen liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstandsbestimmung
- Die Werke - Zeitgenössische Rezeption und Publikum
- Intertextualität
- Das zugrunde gelegte Intertextualitätskonzept
- Funktionen intertextueller Bezüge
- Exkurs: Zum Problem der Mündlichkeit in der mediävistischen Intertextualitätsforschung
- Intertextuelle Bezüge des Parzival im Willehalm
- Der Willehalm vor dem Hintergrund des Parzival
- Intertextuelle Bezugnahmen auf Parzival-Figuren
- Anfortas
- Feirefiz und Secundille
- Gahmuret
- Parzival
- Parallelen zwischen Rennewart und Parzival
- Parzival als Folie für Rennewart?
- Gawan
- Die Besiegten im Kampf mit Feirefiz
- Alîze
- Intertextuelle Bezugnahmen auf nicht personenbezogene Parzival-Elemente
- Artushof und Gralswelt
- Der Wald Lignaloe
- Die Lanzenschäfte aus Oraste Gentesîn
- Bezugnahmen auf Themen und Handlungsmotive des Parzival
- Funktionen der intertextuellen Bezüge des Parzival im Willehalm
- Der Willehalm - Weiterführung oder Kontrastbildung zum Frühwerk?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Examensarbeit setzt sich mit der Intertextualität zwischen Wolframs von Eschenbachs "Parzival" und "Willehalm" auseinander. Der Fokus liegt auf der Analyse der intertextuellen Bezüge, um deren Bedeutung und Funktion für die Texte und die Rezipientenschaft zu erforschen. Die Arbeit zielt darauf ab, den Sinn und die Gründe für die intertextuellen Bezugnahmen Wolframs zu beleuchten und deren Einfluss auf die Interpretation der beiden Werke zu untersuchen.
- Die Rezeption der beiden Werke Wolframs von Eschenbachs
- Der Einfluss des "Parzival" auf den "Willehalm"
- Die Funktionen der intertextuellen Bezüge zwischen den beiden Werken
- Die Bedeutung der Intertextualität für die Interpretation der Werke
- Die Frage, ob der "Willehalm" eine Weiterführung oder Kontrastbildung zum "Parzival" darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Werke Wolframs von Eschenbach, "Parzival" und "Willehalm", vor und beleuchtet die Forschungsgeschichte der Intertextualität im Mittelalter. Die Gegenstandsbestimmung behandelt die Werke im Kontext der zeitgenössischen Rezeption und definiert den verwendeten Intertextualitätsbegriff. Des Weiteren werden die Funktionen intertextueller Bezüge und das Problem der Mündlichkeit in der mediävistischen Intertextualitätsforschung diskutiert. Kapitel 3 analysiert die intertextuellen Bezüge des "Parzival" im "Willehalm", wobei die Analyse die Beziehung zwischen den beiden Werken im Hinblick auf Figuren, Handlungselemente und Themen beleuchtet. Kapitel 4 erforscht die Funktionen dieser Bezüge und Kapitel 5 untersucht, ob der "Willehalm" eine Weiterführung oder Kontrastbildung zum "Parzival" darstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Intertextualität, der Rezeption von mittelalterlichen Texten, den Funktionen und Bedeutungen von literarischen Anspielungen, den Werken Wolframs von Eschenbachs "Parzival" und "Willehalm" sowie der Frage nach der Weiterführung oder Kontrastbildung zwischen diesen beiden Werken.
Häufig gestellte Fragen
Welche Verbindung besteht zwischen Wolframs von Eschenbach „Parzival“ und „Willehalm“?
Wolfram stellt im „Willehalm“ zahlreiche intertextuelle Bezüge zum „Parzival“ her, indem er Figuren, Themen und Motive aus dem früheren Werk aufgreift.
Was versteht man unter Intertextualität in der Mediävistik?
In der Erforschung mittelalterlicher Texte bezeichnet Intertextualität das bewusste Verweisen eines Werkes auf ein anderes, um Sinnzusammenhänge für das Publikum zu schaffen.
Welche Funktionen haben die Anspielungen auf den „Parzival“ im „Willehalm“?
Sie dienen der Charakterisierung von Figuren, der Einordnung der Handlung in einen größeren Kontext und setzen die Kenntnis des Publikums über das Vorwerk voraus.
Welche Figuren aus dem „Parzival“ werden im „Willehalm“ referenziert?
Es werden Bezüge zu Figuren wie Anfortas, Feirefiz, Gahmuret, Gawan und insbesondere Parzival selbst hergestellt, oft als Folie für neue Charaktere wie Rennewart.
Stellt der „Willehalm“ eine Fortsetzung des „Parzival“ dar?
Die Arbeit untersucht, ob der „Willehalm“ eher als Weiterführung oder als bewusste Kontrastbildung zum „Parzival“ zu verstehen ist.
Warum ist die zeitgenössische Rezeption für die Analyse wichtig?
Verweise funktionieren nur, wenn das Publikum das ältere Werk kennt. Daher ist die Untersuchung der Bekanntheit des „Parzival“ zur Zeit der Entstehung des „Willehalm“ essenziell.
- Quote paper
- Nina Hollstein (Author), 2008, Intertextuelle Bezüge des Parzival im "Willehalm" Wolframs von Eschenbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117959