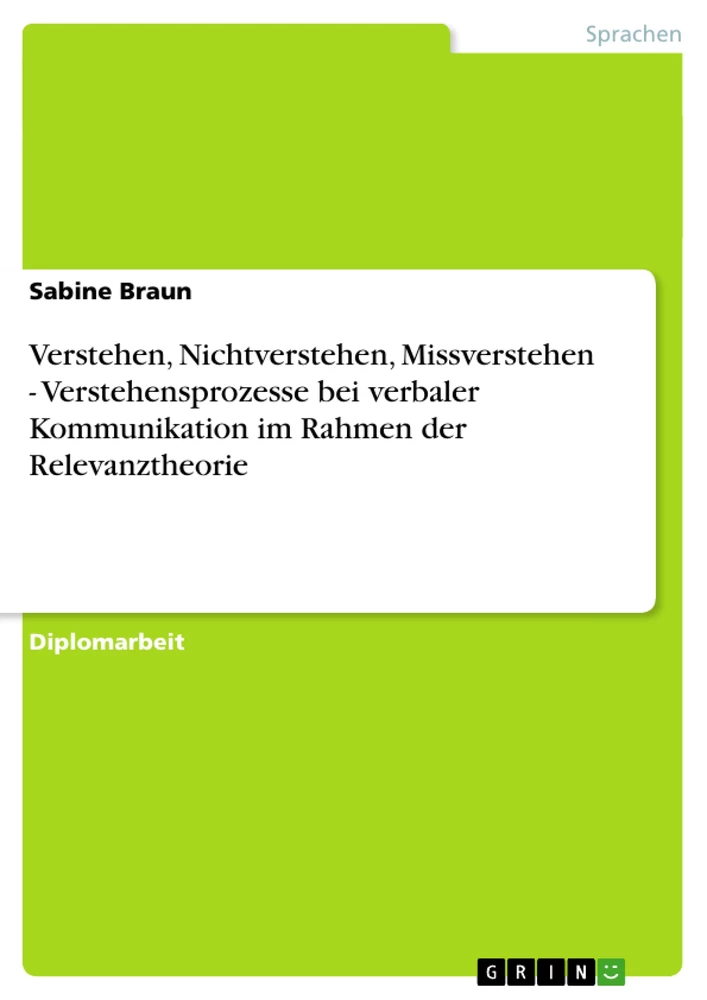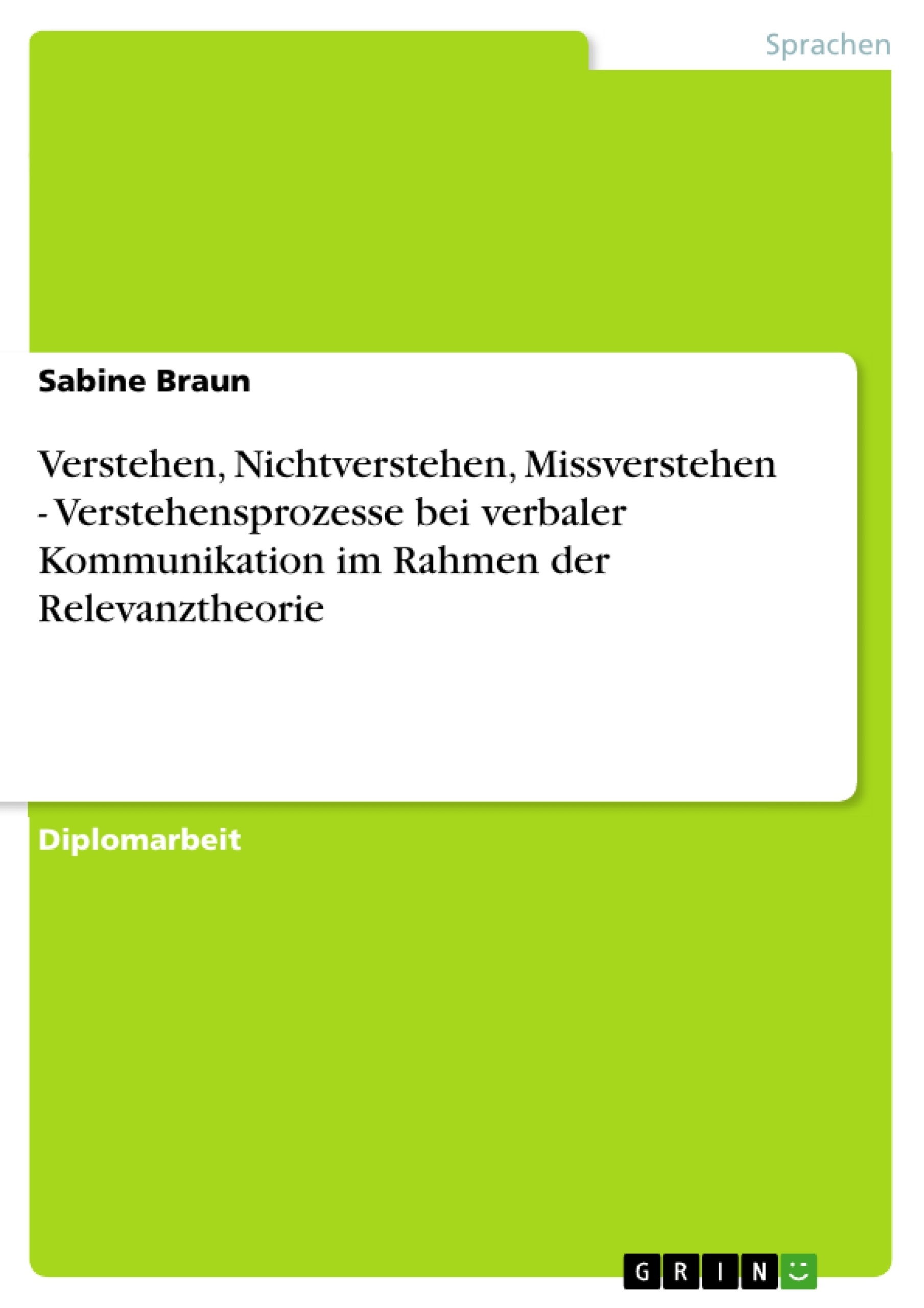In the present paper the following questions will be raised and discussed: What do we understand if we understand? How do we understand what we understand? And how do we manage to understand at all? Why do we sometimes fail to understand each other? Should misunderstandings be seen as avoidable exceptions in the process of understanding or are they a common place phenomenon? And who or what is to blame for their occurrence?
That is to say this paper is supposed to deal with the question whether understanding of verbal utterances can be considered as usual case or whether it is more likely for communication to fail. Accordingly it will be tried to answer how successful communication might come into being as well as how the occurrence of non-understanding and misunderstanding(s) could be explained.
This paper is divided into three parts. The first one captures the definitions of understanding, non-understanding and misunderstanding(s) as they are essential notions to the overall paper.
The second part is aimed to giving a focused overview over existing studies in the wide sphere of misunderstanding research.
The third part treats the relation between Grice's ideas and the Relevance-Theoretic-approach to communication. In 1967 Herbert Paul Grice made an important contribution to modern pragmatics: Based on the observation that an utterance communicates much more information than just its semantic content, he established the fact that human communication is governed by general principles on the assumption of which the hearer is able to recover the implicated content of an utterance. But although Grice's basic ideas are very convincing, he has left many problems open for further elaboration. The Relevance Theory (RT) of Dan Sperber and Deirdre Wilson can be seen as having achieved this task by further developing Grice's basic ideas into a powerful explanatory model of communication and cognition.
After pointing out the impact of Grice's approach on RT, it will be shown how RT emerged out of a critical reassessment of Grice's ideas. As a result it should become clear how it exceeds Grice's rather sketchy model of communication and what benefits the RT-approach is able to provide for linguistic analysis concerning successful understanding of verbal utterances as well as the occurrence of communication failures such as non- and
misunderstanding(s).
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung: Wie verstehen wir, was wir verstehen?
- Verstehensprozesse im Modell
- Der Verstehensprozess aus Sicht des Sprechers
- Der Verstehensprozess aus Sicht des Hörers
- Zum Verhältnis von Verstehen, Missverstehen und Nichtverstehen
- Verstehen und Nicht(s)verstehen: zwei Seiten der gleichen Medaille?
- Missverstehen: Erscheinungsform von Verstehen oder eigenständiges Phänomen?
- Einordnung der Fragestellung in den aktuellen Forschungsstand
- Die Bedeutung der Sprechakttheorie (SAT) für die Erklärung von Verstehensprozessen
- Die pragmatische Perspektive auf Prozesse des Verstehens
- Verstehensprozesse aus relevanztheoretischer Sicht
- Die Relevanztheorie (Sperber/Wilson 1986/1995)
- Kommunikation im Modell: Code-Modelle und Inferenz-Modelle
- Das semiotische Code-Modell und seine Grenzen
- Das Modell ostentativ-inferentieller Kommunikation
- Herbert P. Grice: Konversationsmaximen und Implikaturentheorie
- Kritik an Grices Ideen
- Die Relevanztheorie (RT)
- Die verbale Äußerung als ostentativer Stimulus
- Der Begriff der Relevanz
- Die Rolle des Kontextes
- Das Konzept der mutual manifestness of assumptions
- Zusammenfassung am konkreten Beispiel
- Gründe für das Misslingen einer Kommunikation aus Sicht der RT
- Einschränkung der Relevanz
- Probleme bei der Etablierung eines mutual cognitive environment
- Begrenzte Möglichkeiten bei Stimuluswahl und -gestaltung
- Innere und äußere Zwänge
- Mangelnde Sprachkompetenz
- Lärmquellen
- Negative psycho-physische Umstände
- Einschränkung der Relevanz
- Kommunikation im Modell: Code-Modelle und Inferenz-Modelle
- Schlussgedanke: Verstehen: ein gradueller Prozess zwischen Gelingen und Misslingen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prozesse des Verstehens, Nichtverstehens und Missverstehens verbaler Kommunikation im Rahmen der Relevanztheorie. Ziel ist es, die Bedingungen für erfolgreiches Verstehen zu analysieren und die Ursachen für Kommunikationsstörungen zu identifizieren. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Verstehen der Regelfall oder eher die Ausnahme ist.
- Definition und Abgrenzung von Verstehen, Nichtverstehen und Missverstehen
- Analyse von Verstehensprozessen aus der Perspektive von Sprecher und Hörer
- Einordnung der Fragestellung in den aktuellen Forschungsstand, insbesondere die Sprechakttheorie
- Detaillierte Betrachtung der Relevanztheorie und ihrer Anwendung auf Kommunikationsprozesse
- Erklärung von Kommunikationsstörungen im Lichte der Relevanztheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Wie verstehen wir, was wir verstehen?: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Komplexität des Verstehensprozesses und die Ambivalenz zwischen gelingendem und misslingendem Verstehen. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, ob erfolgreiches Verstehen der Normalfall oder eher eine Ausnahme ist, und untersucht die Rolle von Nichtverstehen und Missverstehen in diesem Zusammenhang. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Definition der zentralen Begriffe, Überblick über den Forschungsstand und die Anwendung der Relevanztheorie.
Verstehensprozesse im Modell: Dieses Kapitel präsentiert ein Modell zur Beschreibung von Verstehensprozessen, getrennt nach der Perspektive des Sprechers und des Hörers. Es analysiert die kognitiven und kommunikativen Aspekte, die zum erfolgreichen Verstehen beitragen. Die unterschiedlichen Rollen und Perspektiven werden beleuchtet und die Herausforderungen bei der gegenseitigen Interpretation von Botschaften werden diskutiert. Hier wird der Grundstein für das Verständnis der Schwierigkeiten und Komplexitäten der Kommunikation gelegt.
Zum Verhältnis von Verstehen, Missverstehen und Nichtverstehen: Dieses Kapitel beleuchtet das Verhältnis zwischen den drei zentralen Begriffen. Es analysiert die Frage, ob Nichtverstehen als ein Gegenpol zum Verstehen gesehen werden kann oder ob es lediglich eine Ausprägung desselben Prozesses darstellt. Des Weiteren wird untersucht, inwiefern Missverständnisse als eigenständige Phänomene oder als Erscheinungsformen des Verstehensprozesses betrachtet werden können. Der Fokus liegt auf der Klärung der begrifflichen Abgrenzungen und den komplexen Interaktionen zwischen den verschiedenen Verständnisherausforderungen.
Einordnung der Fragestellung in den aktuellen Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Verständnisprozessen, wobei der Schwerpunkt auf der Sprechakttheorie und der pragmatischen Perspektive liegt. Es bereitet den Weg zur detaillierten Betrachtung der Relevanztheorie, indem es die Vorläufer und den Kontext einordnet. Die Bedeutung der bestehenden Theorien für das Verständnis der Fragestellung wird herausgearbeitet, bevor die Relevanztheorie als wichtiger Ansatzpunkt präsentiert wird.
Die Relevanztheorie (Sperber/Wilson 1986/1995): Dieses Kapitel stellt die Relevanztheorie von Sperber und Wilson als theoretischen Rahmen vor. Es erläutert die zentralen Konzepte der Theorie, wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Code- und Inferenzmodellen, den Begriff der Relevanz und die Rolle des Kontextes. Es wird detailliert auf die Konversationsmaximen von Grice eingegangen und diese kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Relevanztheorie zur Erklärung sowohl von erfolgreichem Verstehen als auch von Kommunikationsstörungen wie Nichtverstehen und Missverstehen. Konkrete Beispiele illustrieren die Anwendung der Theorie.
Schlüsselwörter
Verstehen, Nichtverstehen, Missverstehen, verbale Kommunikation, Relevanztheorie, Sprechakttheorie, Pragmatik, Inferenz, Implikatur, Kontext, Kommunikationsstörungen, kognitive Prozesse.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Verstehensprozessen verbaler Kommunikation im Rahmen der Relevanztheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Prozesse des Verstehens, Nichtverstehens und Missverstehens verbaler Kommunikation, insbesondere im Rahmen der Relevanztheorie. Sie analysiert die Bedingungen für erfolgreiches Verstehen und identifiziert Ursachen für Kommunikationsstörungen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob erfolgreiches Verstehen eher der Regelfall oder die Ausnahme ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung der zentralen Begriffe (Verstehen, Nichtverstehen, Missverstehen), analysiert Verstehensprozesse aus Sprecher- und Hörerperspektive, ordnet die Fragestellung in den aktuellen Forschungsstand (Sprechakttheorie, Pragmatik) ein und betrachtet detailliert die Relevanztheorie und ihre Anwendung auf Kommunikationsprozesse. Schließlich werden Kommunikationsstörungen im Licht der Relevanztheorie erklärt.
Welche Theorie steht im Mittelpunkt der Analyse?
Die Relevanztheorie von Sperber und Wilson (1986/1995) bildet den zentralen theoretischen Rahmen der Arbeit. Die Arbeit erläutert die Kernkonzepte der Relevanztheorie, wie Code- und Inferenzmodelle, den Relevanzbegriff, die Rolle des Kontextes und die Konversationsmaximen von Grice. Sie zeigt die Anwendung der Theorie zur Erklärung sowohl erfolgreichen Verstehens als auch von Kommunikationsstörungen.
Wie wird das Thema strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit vorstellt, ein Kapitel zu Modellen von Verstehensprozessen, ein Kapitel zum Verhältnis von Verstehen, Nichtverstehen und Missverstehen, ein Kapitel zum Forschungsstand (inkl. Sprechakttheorie und Pragmatik), ein ausführliches Kapitel zur Relevanztheorie und schließlich einen Schlussteil.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfragen), Verstehensprozessen im Modell (Sprecher- und Hörerperspektive), dem Verhältnis von Verstehen, Missverstehen und Nichtverstehen, der Einordnung in den Forschungsstand (Sprechakttheorie, Pragmatik), der detaillierten Erläuterung der Relevanztheorie (inkl. Grice'scher Maximen) und einem Schlussteil, der die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Verstehen, Nichtverstehen, Missverstehen, verbale Kommunikation, Relevanztheorie, Sprechakttheorie, Pragmatik, Inferenz, Implikatur, Kontext, Kommunikationsstörungen, kognitive Prozesse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Analyse der Bedingungen für erfolgreiches Verstehen verbaler Kommunikation und die Identifizierung von Ursachen für Kommunikationsstörungen im Rahmen der Relevanztheorie. Die Arbeit untersucht, ob erfolgreiches Verstehen der Regelfall oder eher die Ausnahme ist.
Welche Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit nimmt eine pragmatische Perspektive ein und konzentriert sich auf die Anwendung der Relevanztheorie zur Erklärung von Verstehensprozessen und Kommunikationsstörungen. Sie betrachtet die Prozesse aus der Perspektive sowohl des Sprechers als auch des Hörers.
- Citation du texte
- Sabine Braun (Auteur), 2004, Verstehen, Nichtverstehen, Missverstehen - Verstehensprozesse bei verbaler Kommunikation im Rahmen der Relevanztheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117988