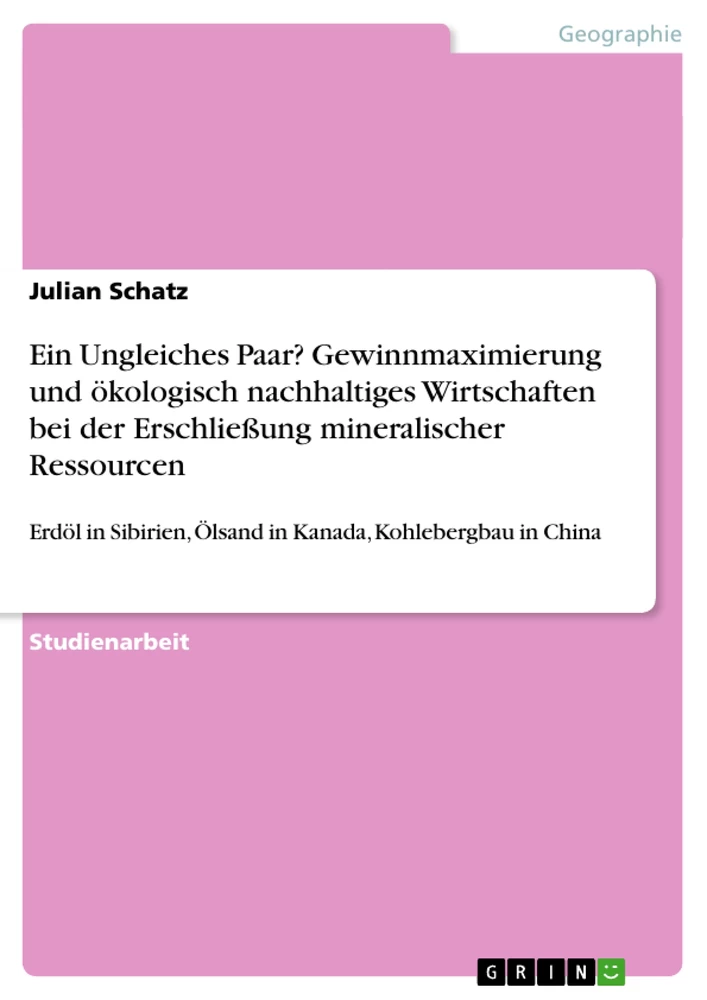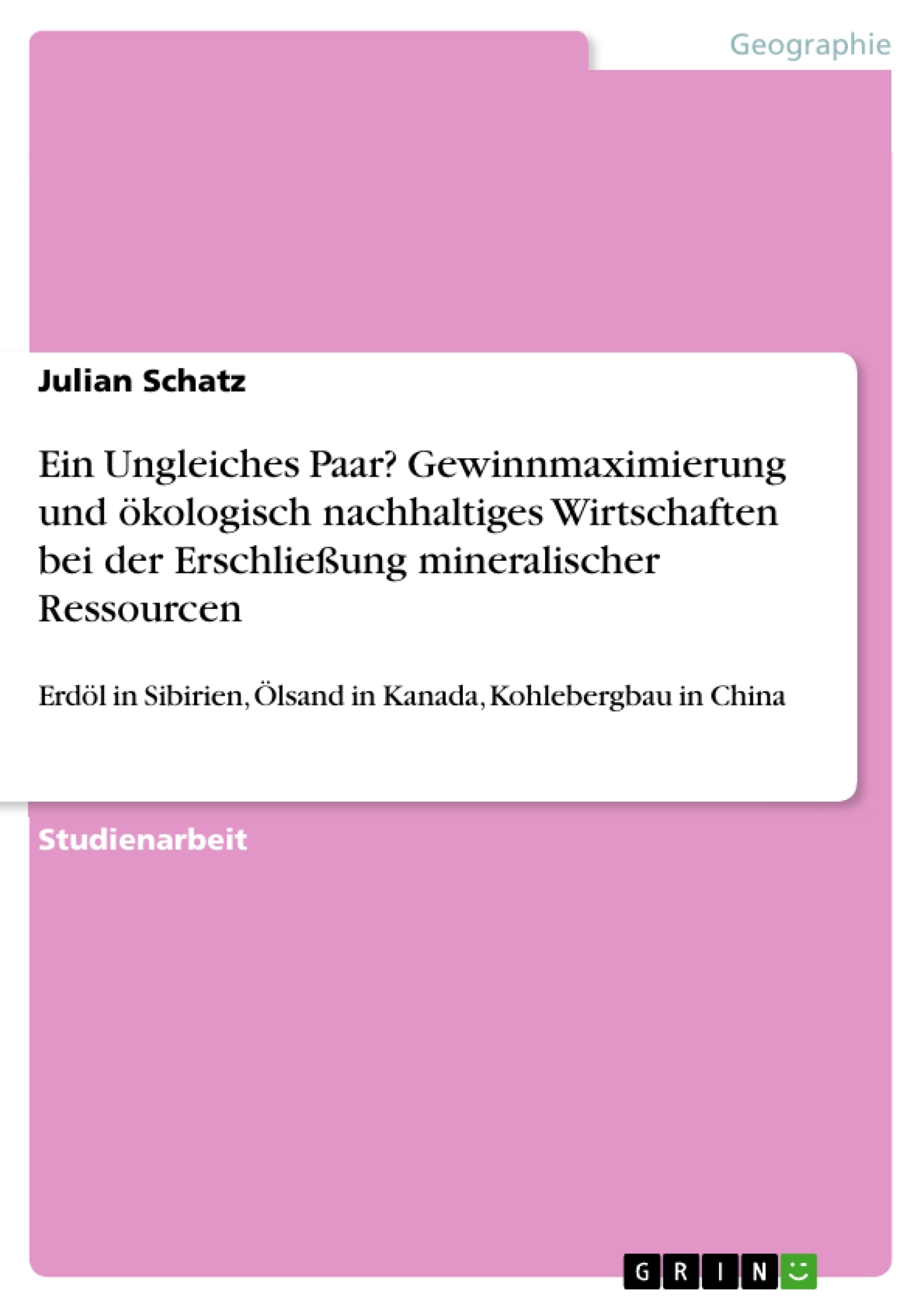Wo mineralische Ressourcen vorkommen, ist meistens auch viel Geld zu verdienen. Das ist schon lange bekannt und hat in der Geschichte zu etlichen Kriegen um die begehrten Rohstoffe geführt. Die größte Bedeutung haben nach wie vor die fossilen mineralischen Energieträger Erdöl, Erdgas und Kohle. Die Entdeckungen großer Lagerstätten haben schon vielen davor wirtschaftlich eher bedeutungslosen Ländern zu einem kometenhaften Aufstieg in der Hierarchie der globalen Wirtschaft verholfen.(...) Der riesige Energiebedarf der hoch industrialisierten Länder der Welt erzeugt für diejenigen ohne ausreichend eigenen Rohstoffen einen hohen Druck, den Bedarf auf möglichst lange Zeit zu sichern. Das bringt gewaltige Mengen an Kapital ins Spiel, mit dem die energieträchtigen Ressourcen eingekauft werden. Dabei ist mit dem Gewissen der Endkunden nicht weit her, wenn es darum geht unter welchen Bedingungen die gekauften Rohstoffe der Erde abgerungen wurden. Eine allzu ethische und ökologische Einkaufsmoral würde mit Sicherheit früher oder später zu einem Ansteigen der Preise führen, denn die Länder, in denen die begehrten Güter gewonnen werden, würden gezwungen, nachhaltigere Methoden im Abbau einzuführen. Da die Abnehmer so wenig wie möglich bezahlen wollen und die Produzenten von Rohstoffen soviel wie möglich verdienen wollen, ist der Zustand der Natur in den Förderregionen oftmals katastrophal. Landschaftsumgestaltung durch Tagebau, Austreten von Öl aus leckenden Pipelines und saurer Regen sind nur einige von vielen Problemen, die lokale Ökosysteme gefährden. In vielen Fördergebieten werden zudem beträchtliche Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre emittiert und liefern demzufolge einen nicht unwesentlichen Beitrag zum globalen Klimawandel. Ein gänzlich umweltverträglicher Abbau von fossilen Ressourcen ist unmöglich. Anhand der drei folgenden Beispiele soll gezeigt, wie es um eine Annäherung an dieses unerreichbare Ideal in den ausgewählten Förderregionen der Erde bestellt ist. Die konventionelle Ölförderung im russischen Westsibirien und die Gewinnung nicht-konventionellen Öls aus Ölsanden im kanadischen Alberta zeigen, welche Probleme im subarktischen Bereich mit seinen empfindlichen und sich schwer regenerierenden Ökosystemen durch den Abbau des Öls entstehen können. Als letztes Beispiel folgt der Kohlebergbau in China, der ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erdölförderung in Sibirien und daraus resultierende ökologische Probleme
- 2.1 Einleitung und geographischer Überblick über Westsibirien
- 2.2 Transport des Westsibirisches Öls durch Pipelines
- 2.2.1 Schäden durch intakte Pipelines
- 2.2.2 Marode Pipelines bergen ein hohes Gefahrenpotential
- 2.2.3 Der ,,Komi Oil Spill”
- 2.3 Indigene Völker leiden unter den Erdölreserven
- 2.4 Das Samotlor-Ölfeld
- 2.5 Abfackeln von Begleitgasen
- 2.6 Dämme und Plattformen aus Sand
- 2.7 Fazit und Ausblick
- 3. Ölsandförderung in Alberta, Kanada
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Geographischer Überblick
- 3.3 Abbaumethoden (Tagebau und in-situ Verfahren)
- 3.4 Erschließung einer Lagerstätte im Athabaska-Gebiet
- 3.5 Ökologische Folgen der Ölsandförderung
- 3.6 Die 'First Nations' in Ölsandgebieten
- 3.7 Ausblick
- 4. Kohlebergbau in China
- 4.1 Überblick
- 4.2 Kohlevorkommen in China
- 4.3 Ökologische Probleme bei der Kohlengewinnung
- 4.3.1 Luftverschmutzung und Saurer Regen
- 4.3.2 Kohlefeuer
- 4.3.3 Landschaftsumgestaltung und Wasserverschmutzung durch Kohlenwaschung
- 4.4 Ausblick
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Spannungsfelder zwischen Gewinnmaximierung und ökologisch nachhaltigem Wirtschaften anhand von drei Fallbeispielen: Erdölförderung in Sibirien, Ölsandförderung in Alberta und Kohlebergbau in China. Ziel ist es, die ökologischen Probleme und die Auswirkungen auf die betroffenen indigenen Bevölkerungen aufzuzeigen und die jeweiligen Herausforderungen für eine nachhaltige Ressourcenerschließung zu beleuchten.
- Ökologische Folgen der Mineraliengewinnung
- Konflikte zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz
- Auswirkungen auf indigene Bevölkerungsgruppen
- Vergleichende Analyse verschiedener Fördermethoden
- Herausforderungen für eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Konflikte zwischen Gewinnmaximierung und ökologischer Nachhaltigkeit bei der Erschließung mineralischer Ressourcen zu untersuchen. Es werden die drei Fallstudien (Sibirien, Alberta, China) vorgestellt und ihre Relevanz für die Gesamtbetrachtung erläutert. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, indem sie die zentralen Fragestellungen formuliert und den methodischen Ansatz skizziert.
2. Erdölförderung in Sibirien und daraus resultierende ökologische Probleme: Dieses Kapitel analysiert die Erdölförderung in Westsibirien und ihre schwerwiegenden ökologischen Folgen. Es wird der geographische Kontext beschrieben, die Risiken des Pipeline-Transports im Permafrostgebiet hervorgehoben (einschließlich des Komi Oil Spill), und die negativen Auswirkungen auf indigene Gemeinschaften und deren traditionelle Lebensweise detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf den Umweltzerstörungen durch Ölaustritte, die Zerstörung von Lebensräumen, sowie auf der Verbrennung von Begleitgasen. Das Kapitel veranschaulicht, wie die Gewinnmaximierung auf Kosten der Umwelt und der Bevölkerung geschieht.
3. Ölsandförderung in Alberta, Kanada: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ölsandförderung in Alberta und ihren ökologischen Implikationen. Die unterschiedlichen Abbaumethoden (Tagebau und In-situ Verfahren) werden erläutert, sowie die umfangreichen ökologischen Schäden, wie z.B. die Zerstörung von Lebensräumen und die Beeinträchtigung der Wasserqualität. Die Situation der First Nations und ihre Konflikte mit den Förderunternehmen werden detailliert beschrieben. Das Kapitel zeigt die komplexen Herausforderungen auf, die mit dem Abbau dieser Ressourcen verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Folgen für die Umwelt und die indigene Bevölkerung.
4. Kohlebergbau in China: Das Kapitel befasst sich mit den ökologischen Problemen des Kohlebergbaus in China. Es beschreibt die enormen Kohlevorkommen und analysiert die Luftverschmutzung, sauren Regen, Kohleflözbrände, Landschaftsumgestaltung und Wasserverschmutzung. Das Ausmaß der Umweltzerstörung und die sozialen Folgen werden detailliert dargestellt. Im Fokus stehen die gravierenden Auswirkungen des Bergbaus auf die Umwelt und die menschlichen Lebensbedingungen in den betroffenen Regionen. Der Vergleich mit den anderen Fallstudien verdeutlicht die globalen Dimensionen der ökologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewinnung mineralischer Rohstoffe.
Schlüsselwörter
Gewinnmaximierung, ökologische Nachhaltigkeit, Erdölförderung, Ölsandförderung, Kohlebergbau, Sibirien, Alberta, China, Permafrost, indigene Völker, Umweltzerstörung, nachhaltige Ressourcenwirtschaft, Pipeline-Transporte, Tagebau, In-situ Verfahren, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Kohleflözbrände.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: Gewinnmaximierung vs. Ökologische Nachhaltigkeit
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht die Konflikte zwischen Gewinnmaximierung und ökologisch nachhaltigem Wirtschaften bei der Erschließung mineralischer Ressourcen. Sie analysiert drei Fallbeispiele: Erdölförderung in Sibirien, Ölsandförderung in Alberta (Kanada) und Kohlebergbau in China.
Welche Ziele verfolgt die Ausarbeitung?
Ziel ist es, die ökologischen Probleme der jeweiligen Fördermethoden aufzuzeigen, die Auswirkungen auf die betroffenen indigenen Bevölkerungsgruppen zu beleuchten und die Herausforderungen für eine nachhaltige Ressourcenerschließung zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt die ökologischen Folgen der Mineraliengewinnung, Konflikte zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz, die Auswirkungen auf indigene Bevölkerungsgruppen, einen Vergleich verschiedener Fördermethoden und die Herausforderungen für eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft.
Welche Fallbeispiele werden untersucht?
Die Ausarbeitung untersucht die Erdölförderung in Westsibirien (Russland) mit Fokus auf Pipelinereisiken und Auswirkungen auf indigene Völker, die Ölsandförderung in Alberta (Kanada) mit Betrachtung der Abbaumethoden (Tagebau und In-situ) und deren ökologische Folgen sowie den Kohlebergbau in China mit seinen weitreichenden Umweltproblemen wie Luft- und Wasserverschmutzung.
Welche ökologischen Probleme werden im Zusammenhang mit der Erdölförderung in Sibirien beschrieben?
Die Erdölförderung in Sibirien verursacht gravierende ökologische Probleme, darunter Schäden durch Pipelines (inklusive des Komi Oil Spill), die Zerstörung von Lebensräumen, negative Auswirkungen auf indigene Gemeinschaften und die Verbrennung von Begleitgasen.
Welche ökologischen Probleme werden im Zusammenhang mit der Ölsandförderung in Alberta beschrieben?
Die Ölsandförderung in Alberta führt zur Zerstörung von Lebensräumen, Beeinträchtigung der Wasserqualität und konfliktträchtigen Situationen mit den First Nations.
Welche ökologischen Probleme werden im Zusammenhang mit dem Kohlebergbau in China beschrieben?
Der Kohlebergbau in China verursacht massive Luftverschmutzung, sauren Regen, Kohleflözbrände, Landschaftsumgestaltung und Wasserverschmutzung.
Wie werden die Auswirkungen auf indigene Bevölkerungsgruppen betrachtet?
Die Ausarbeitung untersucht detailliert, wie die indigenen Völker in Sibirien und Alberta von den jeweiligen Fördermethoden betroffen sind und welche Konflikte mit den Unternehmen bestehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung verdeutlicht die globalen Dimensionen der ökologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewinnung mineralischer Rohstoffe und zeigt die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Ressourcenwirtschaft auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Ausarbeitung?
Gewinnmaximierung, ökologische Nachhaltigkeit, Erdölförderung, Ölsandförderung, Kohlebergbau, Sibirien, Alberta, China, Permafrost, indigene Völker, Umweltzerstörung, nachhaltige Ressourcenwirtschaft, Pipeline-Transporte, Tagebau, In-situ Verfahren, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Kohleflözbrände.
- Citar trabajo
- Julian Schatz (Autor), 2007, Ein Ungleiches Paar? Gewinnmaximierung und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften bei der Erschließung mineralischer Ressourcen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118018