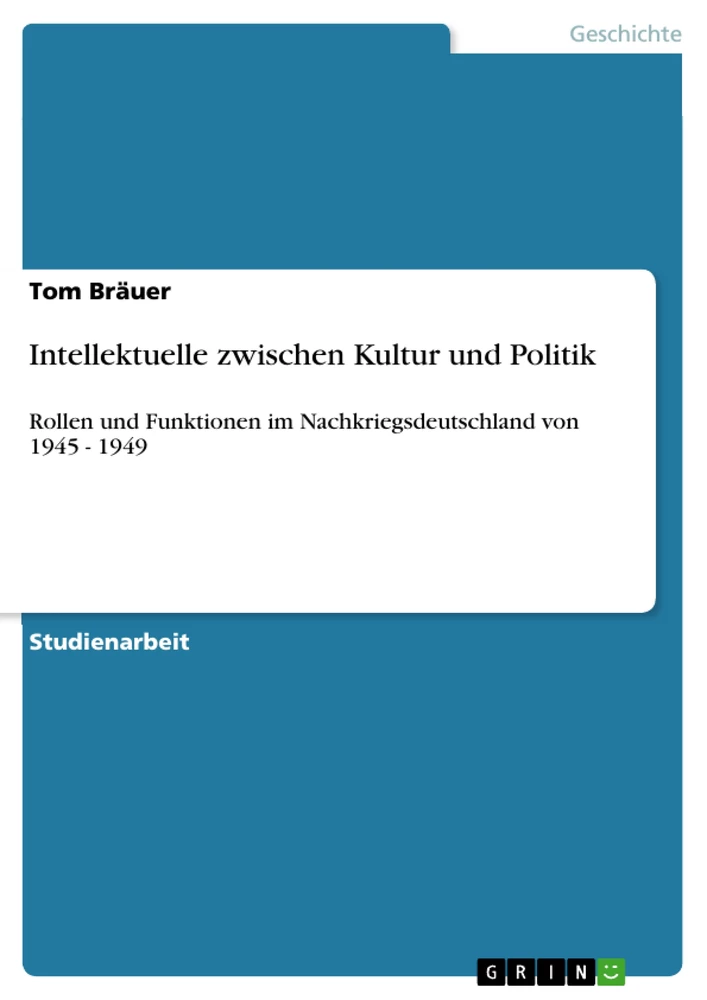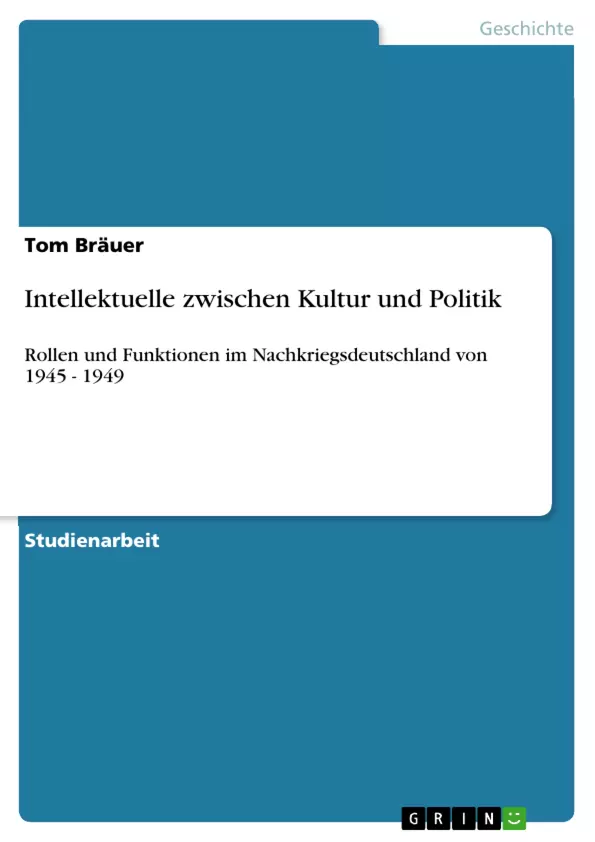Die folgende Arbeit versucht zwei Ebenen mit einander zu verbinden und nach den Wirkungen zu fragen. Die eine Ebene sind die komplexen politischen Beziehungen nach dem Untergang des „Dritten Reiches“ und dessen katastrophalen Folgen. Es kommt dabei auf die Widersprüchlichkeit zwischen theoretischen Konzeptionen und praktischer Umsetzung an. Schwerpunkt sind dabei die Besatzungsmächte. Die Komplexität der Abläufe bietet immer wieder Möglichkeiten zu entgegen gesetzten Entwicklungen. Impulse dieser Widersprüche werden auf der zweiten Ebene wahrgenommen und reflektiert. Die zweite Ebene sind die Intellektuellen der Nachkriegszeit, die im viel stärkeren Maße durch die Last der Vergangenheit und den Anspruch der Gegenwart ihre Positionen suchten und durch ihre Möglichkeiten Einfluss zu nehmen gedachten. Beide Seiten kennzeichnet den Willen und die Möglichkeiten zu einem neunen Anfang, der zunächst offen und vielgestaltig war; sich dann aber recht schnell in bereits vorgeprägte Bahnen getrennte Wege ging, aber als eine Bezugsgeschichte bis zum Wegfall der Blockkonfrontation und dem Ende des Kalten Krieges zu verstehen ist. In einem ersten kleinen Schritt wird der Versuch unternommen, den Begriff Intellektueller näher zu beleuchten und auf einige Aspekte der älteren und neueren Forschung einzugehen, die mit einem modernen Intellektuellenbegriff als Handlungstypus operiert. Daran anschließend geht die Arbeit in dem größeren Teil auf die komplizierte Nachkriegsgeschichte nach 1945 ein und geht von der These aus, dass die Prägungen bestimmter intellektueller Rollen in der Euphorie der Anfangsjahre Grundnarrative vorgestaltet haben, diese aber nicht ideologisierten, sondern in einer sehr heterogenen diskursiven Gemeinschaft zirkulierten.
Ein Schwerpunkt dabei sind Texte von bekannten Intellektuellen dieser Zeit, die vor allem in einem Zeitschriftenboom der Anfangsjahre erschienen. Diese Texte sind höchst emphatisch aufgeladen und zielen wirkungsmächtig auf ihr Publikum. Sie sind stilistisch höchst eindrucksvoll und zeugen von wahren Könnern ihres Faches. Vor allem Artikel der Frankfurter Hefte und Ost und West werden unter einem Gesichtspunkt mit einander verglichen. 1948 erinnerte man sich des hundertjährigen Jubiläums von 1848.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- 1. Intellektuellenforschung
- 1.1 Glanz und Elend der deutschen Intellektuellen
- 1.2 Begriffsdefinitionen und Intellektuellenforschung
- 1.3 Einige Aspekte einer moderneren Intellektuellengeschichte
- 2. 1945 das Ende und der Anfang
- 2.1 Das Ende
- 2.2 Der Anfang im Ende
- 2.3 Exkurs: Die Schuldfrage
- 2.3.1 Voraussetzungen
- 2.3.2 Die Intellektuellen und die Schuldfrage
- 2.4 Der Anfang von „oben“ und „unten“
- 2.4.1 Die Besatzungspolitik von „oben“
- 2.4.2 Die Besatzungspolitik von „unten“
- 2.5 Kulturpolitik der Besatzungsmächte und die ambivalente Rolle von Intellektuellen
- 2.5.1 Exkurs: Besonderheit in der SBZ – Kulturoffiziere
- 3. Das „,Schicksalsjahr 1948“
- 4. Intellektuelle und die Zeitschriftenlandschaft von 1945-1949
- 4.1 „Aufbruch“ und Ende der Zeitschriftenlandschaft
- 4.2 Exkurs: Der Ruf
- 4.3 Das Erinnerungsjahr 1948 im „Zeitschriftenboom“
- 5. Ein Ausblick: Mythen des Anfangs
- 6. Fazit
- 7. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Intellektuellen im Nachkriegsdeutschland von 1945-1949 und analysiert die komplexen politischen Beziehungen nach dem Untergang des „Dritten Reiches“. Sie beleuchtet die Widersprüchlichkeit zwischen theoretischen Konzeptionen und praktischer Umsetzung, insbesondere im Kontext der Besatzungsmächte. Die Arbeit geht von der These aus, dass die Prägung bestimmter intellektueller Rollen in der Euphorie der Anfangsjahre Grundnarrative vorgeprägt hat, diese aber nicht ideologisierten, sondern in einer sehr heterogenen diskursiven Gemeinschaft zirkulierten.
- Die Rolle von Intellektuellen im Nachkriegsdeutschland
- Die Widersprüchlichkeit zwischen theoretischen Konzeptionen und praktischer Umsetzung
- Die Prägung bestimmter intellektueller Rollen in der Euphorie der Anfangsjahre
- Die Bedeutung von Zeitschriften für die Verbreitung von intellektuellen Ideen
- Der Einfluss von Geschichtsmythen auf die Tagespolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorbemerkungen: Die Einleitung stellt den Begriff „Intellektueller“ und seine Bedeutung im historischen Kontext dar. Sie kritisiert Habermas' Sichtweise und argumentiert für eine breitere Kulturgeschichte, die nach Mentalitäts-, Rezeptions- und Perzeptionsmechanismen sucht.
- 1. Intellektuellenforschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Begriffs „Intellektueller“ und seine vielschichtigen Interpretationen. Es analysiert die Bedeutung des Begriffs in der Bundesrepublik Deutschland und die Rolle von Intellektuellen im Kontext der demokratischen Gesellschaft.
- 2. 1945 das Ende und der Anfang: Dieses Kapitel beschreibt die komplexe politische Situation im Nachkriegsdeutschland und die verschiedenen Ansätze zur Gestaltung der neuen Ordnung. Es behandelt die Rolle der Besatzungsmächte, die Schuldfrage und die Herausforderungen des „Neuen Anfangs“.
- 3. Das „,Schicksalsjahr 1948“ : Dieses Kapitel fokussiert auf das Jahr 1948 und seine Bedeutung für die Entwicklung des Nachkriegsdeutschlands. Es beleuchtet die Rolle von Intellektuellen in diesem Kontext und ihre Versuche, durch die Bereitstellung von Geschichtsmythen auf die Tagespolitik Einfluss zu nehmen.
- 4. Intellektuelle und die Zeitschriftenlandschaft von 1945-1949: Dieses Kapitel analysiert die Zeitschriftenlandschaft der Nachkriegszeit und die Rolle von Intellektuellen in diesem Medium. Es untersucht den „Zeitschriftenboom“ und die Bedeutung von Texten in Publikationen wie den Frankfurter Heften und Ost und West.
Schlüsselwörter
Intellektuelle, Nachkriegsdeutschland, Besatzungspolitik, Schuldfrage, Zeitschriftenlandschaft, Geschichtsmythen, Kulturpolitik, politische Einstellung, Mentalitäten, „Dritte Kraft“, „doppelte Wende“
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Intellektuelle nach 1945?
Sie suchten in der Trümmerzeit nach neuen Positionen, reflektierten die Last der Vergangenheit und versuchten, durch Texte und Zeitschriften Einfluss auf den Neuanfang zu nehmen.
Wie gingen Intellektuelle mit der Schuldfrage um?
Die Schuldfrage war zentral für den intellektuellen Diskurs. Es ging um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die moralische Verantwortung für den Wiederaufbau.
Was war der "Zeitschriftenboom" der Nachkriegsjahre?
Zwischen 1945 und 1949 entstanden zahlreiche Publikationen wie die "Frankfurter Hefte" oder "Der Ruf", die als wichtige Foren für politische und kulturelle Debatten dienten.
Warum war das Jahr 1948 ein "Schicksalsjahr"?
Es markierte das hundertjährige Jubiläum der Revolution von 1848 und diente Intellektuellen dazu, Geschichtsmythen bereitzustellen, um die aktuelle Tagespolitik zu beeinflussen.
Was unterscheidet die Besatzungspolitik von "oben" und "unten"?
Von "oben" agierten die Besatzungsmächte mit Verordnungen, während von "unten" die lokale Bevölkerung und Intellektuelle versuchten, kulturelle und politische Impulse für einen Neuanfang zu setzen.
- Quote paper
- Tom Bräuer (Author), 2008, Intellektuelle zwischen Kultur und Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118046