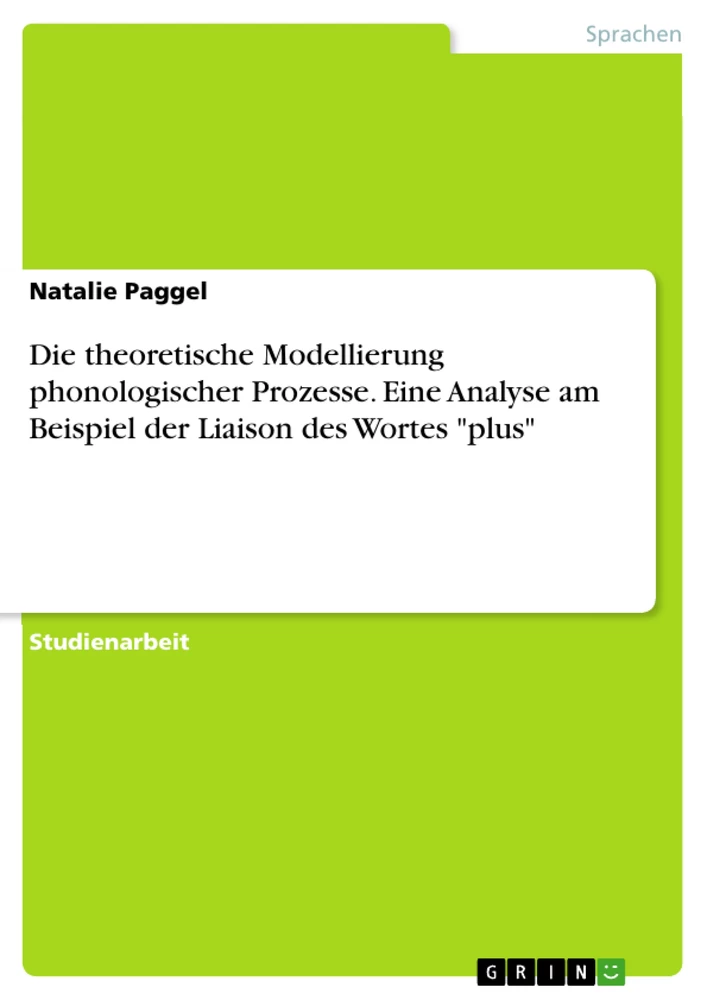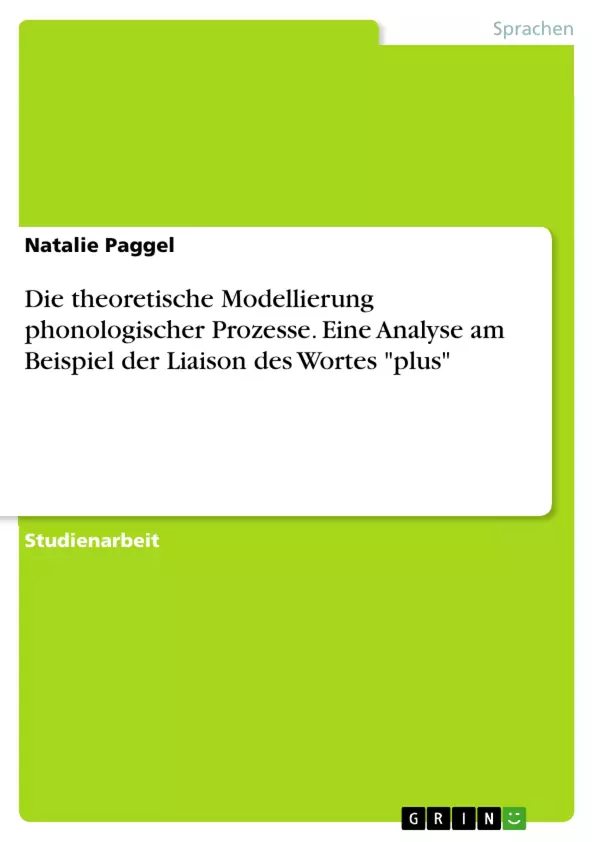Innerhalb dieser Arbeit soll die französische Liaison näher untersucht werden und dabei die verschiedenen Theorien dargelegt werden. Hierbei soll der phonologische Prozess an Hand von einer Theorie und dem Beispiel der drei Aussprachemöglichkeiten des Wortes plus näher dargelegt werden. Zu dem Zweck ist diese Arbeit wie folgt strukturiert. Zuerst wird in einem kompakten Abriss die Diachronie bzw. die historischen Fakten zur Liaison vorgestellt. Im
Anschluss werden die entsprechenden Theorien einzeln vorgestellt und anhand von Beispielen dargestellt. Nach der Theorieübersicht wird die Liaison mit Hilfe der Optimalitätstheorie am Wort plus angewandt. Am Ende werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Tendenzen der prozessphonologischen
Theorien gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Diachronie/Historische Fakten zu der Liaison.
- Theorien.
- Generative Phonologie.
- Autosegmentale Phonologie.
- Optimalitätstheorie.
- Exemplaristische Phonologie.
- Anwendung der Optimalitätstheorie am Beispiel des Wortes plus.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der französischen Liaison, einem phonetischen Phänomen, das die Aussprache des Französischen beeinflusst. Ziel ist es, die Liaison aus diachroner und synchroner Perspektive zu beleuchten, verschiedene Theorien zur Modellierung phonologischer Prozesse vorzustellen und die Optimalitätstheorie anhand des Beispiels des Wortes "plus" anzuwenden.
- Die historische Entwicklung der Liaison vom Altfranzösischen bis zum modernen Französisch.
- Verschiedene theoretische Ansätze zur Beschreibung phonologischer Prozesse, wie die Generative Phonologie, die Autosegmentale Phonologie, die Optimalitätstheorie und die Exemplaristische Phonologie.
- Die Anwendung der Optimalitätstheorie zur Erklärung der verschiedenen Aussprachemöglichkeiten des Wortes "plus" in Verbindung mit der Liaison.
- Die Bedeutung der Liaison als phonologischer Prozess und ihre Auswirkungen auf die französische Sprache.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über das Thema der Liaison und stellt die Problemstellung sowie die Gliederung der Arbeit dar. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung der Liaison und beleuchtet die sprachhistorischen Hintergründe des Phänomens. Kapitel 3 stellt verschiedene theoretische Ansätze zur Beschreibung phonologischer Prozesse vor, darunter die Generative Phonologie, die Autosegmentale Phonologie, die Optimalitätstheorie und die Exemplaristische Phonologie. Kapitel 4 widmet sich der Anwendung der Optimalitätstheorie zur Analyse der verschiedenen Aussprachemöglichkeiten des Wortes "plus" in Verbindung mit der Liaison.
Schlüsselwörter
Französische Liaison, Phonologie, diachroner Wandel, generative Phonologie, autosegmentale Phonologie, Optimalitätstheorie, exemplaristische Phonologie, phonologische Prozesse, Ausspracheregeln, phonetische Realisierung, sprachhistorische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die französische Liaison?
Die Liaison ist ein phonetisches Phänomen im Französischen, bei dem ein normalerweise stummer Endkonsonant vor einem folgenden Vokal ausgesprochen wird.
Welche Rolle spielt das Wort „plus“ in dieser Arbeit?
Das Wort „plus“ dient als Beispiel, um die drei verschiedenen Aussprachemöglichkeiten im Kontext phonologischer Theorien zu analysieren.
Was ist die Optimalitätstheorie?
Es ist ein theoretischer Ansatz, der sprachliche Phänomene als Ergebnis von Konflikten zwischen verschiedenen universellen Beschränkungen (Constraints) erklärt.
Welche weiteren Theorien werden behandelt?
Die Arbeit stellt die Generative Phonologie, die Autosegmentale Phonologie und die Exemplaristische Phonologie vor.
Wird auch die historische Entwicklung der Liaison betrachtet?
Ja, die Arbeit bietet einen kompakten Abriss über die Diachronie und die historischen Fakten zur Liaison vom Altfranzösischen bis heute.
- Quote paper
- Natalie Paggel (Author), 2020, Die theoretische Modellierung phonologischer Prozesse. Eine Analyse am Beispiel der Liaison des Wortes "plus", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1180812