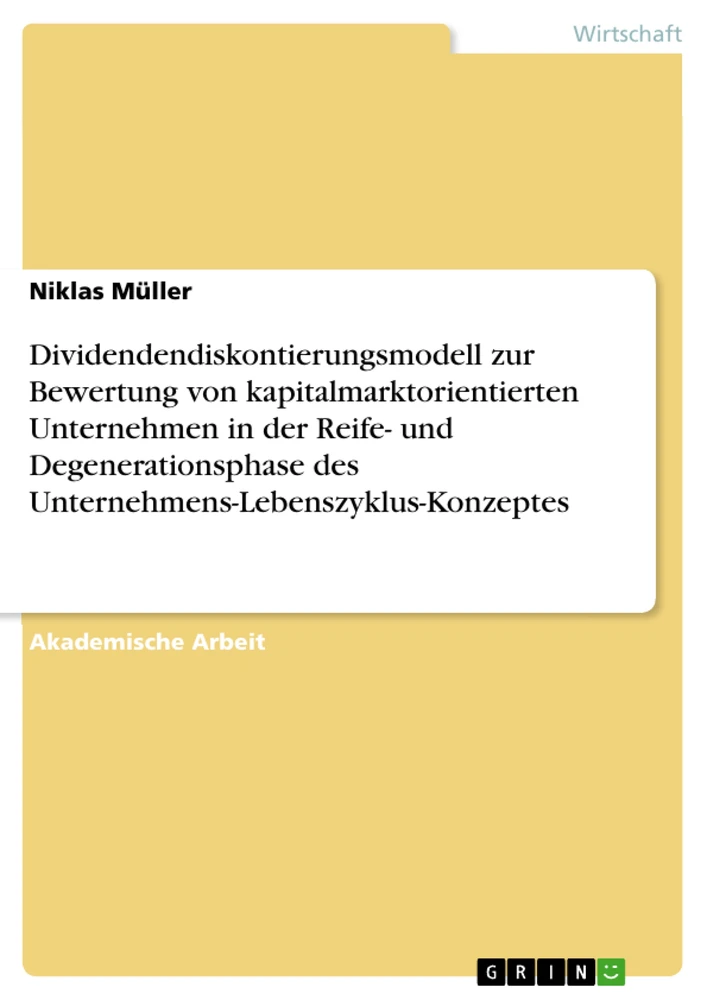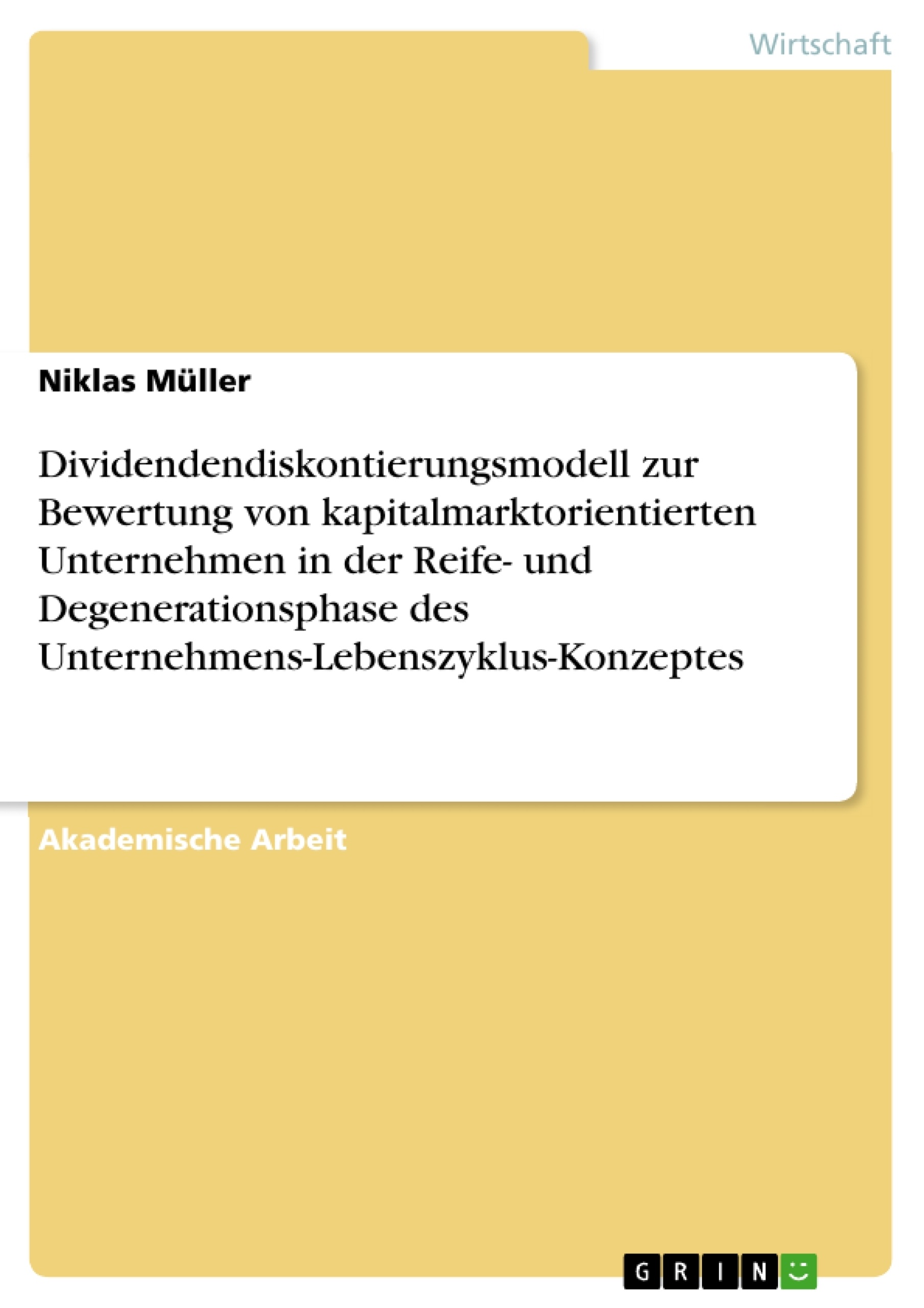Die vorliegende Arbeit beschreibt die Anwendbarkeit und die Relevanz des Dividendendiskontierungsmodells als Mittel der Unternehmensbewertung im Kontext des Unternehmens-Lebenszyklus-Konzepts.
Zu Beginn der Seminararbeit stehen die Dividenden mit ihren jeweiligen Eigenschaften als betrachtete Zahlungsströme sowie die mathematische, theoretische Beschreibung des Dividendendiskontierungsmodells im Vordergrund. Ebenso wird eine Erläuterung des allgemeinen Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes vorgenommen. Der Schwerpunkt wird vor allem auf die kritische Würdigung des Modells und potentiellen Anwendungsfällen gelegt. Dies soll durch eine kritische Auseinandersetzung mit der verfügbaren Literatur erfolgen. Der darauffolgende praxisorientierte Teil der Seminararbeit befasst sich mit der Prüfung der potentiellen Eignung und Vereinbarkeit des Dividendendiskontierungsmodells im Fokus der Reifephase und der Sättigungs- bzw. Regenerationsphase des Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes anhand von renommierten Praxisbeispielen. Dabei wird jeweils eine Berechnung des Unternehmenswertes nach Gordon dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen des Dividendendiskontierungsmodells zur Bewertung von kapitalmarktorientierten Unternehmen im Lichte des Lebenszyklus-Konzeptes auf Unternehmensebene
- Darstellung des Dividendendiskontierungsmodells nach Gordon (1959)
- Allgemeine Charakteristika von Dividenden innerhalb der Rechnungslegung
- Inputvariablen und theoretische Annahmen des Dividendendiskontierungsmodells
- Darstellung des Lebenszyklus-Konzeptes auf Unternehmensebene
- Darstellung des Dividendendiskontierungsmodells nach Gordon (1959)
- Diskussion zur Eignung des Dividendendiskontierungsmodells im Lichte des Unternehmenslebenszyklus
- Diskussion der Eignung des Dividendenmodells aus bewertungstheoretischer Sicht
- Diskussion der Eignung des Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes aus bewertungstheoretischer Sicht
- Prüfung und Würdigung der Vereinbarkeit des Dividendendiskontierungsmodells mit dem Unternehmenslebenszyklus-Konzept anhand von Praxisbeispielen
- Prüfung der Vereinbarkeit in der Reifephase des Unternehmenslebenszyklus anhand der Volkswagen AG
- Prüfung der Vereinbarkeit in der Niedergangsphase/ Degenerationsphase des Unternehmenslebenszyklus anhand der Deutschen Bank AG
- Thesenartige Zusammenfassung der Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Eignung des Dividendendiskontierungsmodells zur Bewertung von kapitalmarktorientierten Unternehmen in der Reife- und Degenerationsphase des Unternehmens-Lebenszyklus-Konzeptes. Ziel ist es, die grundlegenden Prinzipien des Dividendendiskontierungsmodells und des Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes darzustellen und deren Vereinbarkeit anhand von Praxisbeispielen zu überprüfen.
- Darstellung des Dividendendiskontierungsmodells nach Gordon (1959) und dessen theoretische Grundlagen
- Analyse des Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes und seiner Relevanz für die Unternehmensbewertung
- Kritische Würdigung der Vereinbarkeit des Dividendendiskontierungsmodells mit dem Unternehmenslebenszyklus-Konzept
- Praxisbezogene Anwendung des Dividendendiskontierungsmodells in der Reifephase und Degenerationsphase des Unternehmenslebenszyklus
- Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas der Unternehmensbewertung im Kontext von Dividendenausschüttungen und dem Unternehmenslebenszyklus-Konzept heraus. Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen des Dividendendiskontierungsmodells nach Gordon (1959) sowie des Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes. Kapitel 3 diskutiert die Eignung des Dividendendiskontierungsmodells und des Unternehmenslebenszyklus-Konzeptes aus bewertungstheoretischer Sicht. Kapitel 4 untersucht die Vereinbarkeit des Dividendendiskontierungsmodells mit dem Unternehmenslebenszyklus-Konzept anhand von Praxisbeispielen, der Volkswagen AG und der Deutschen Bank AG.
Schlüsselwörter
Dividendendiskontierungsmodell, Unternehmensbewertung, Kapitalmarktorientierung, Lebenszyklus-Konzept, Reife- und Degenerationsphase, Dividendenausschüttungen, Praxisbeispiele, Volkswagen AG, Deutsche Bank AG.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Dividendendiskontierungsmodell nach Gordon?
Es ist eine mathematische Methode zur Unternehmensbewertung, bei der der Wert eines Unternehmens auf Basis der erwarteten zukünftigen Dividendenzahlungen berechnet wird.
Wann ist dieses Modell besonders anwendbar?
Die Arbeit untersucht die Eignung speziell für kapitalmarktorientierte Unternehmen in der Reife- und Degenerationsphase ihres Lebenszyklus.
Welches Praxisbeispiel wird für die Reifephase genutzt?
Die Volkswagen AG dient als Beispiel, um die Vereinbarkeit des Modells mit stabilen Unternehmen in der Reifephase zu prüfen.
Wie wird die Degenerationsphase analysiert?
Am Beispiel der Deutschen Bank AG wird die Eignung des Modells für Unternehmen in einer Sättigungs- oder Niedergangsphase kritisch gewürdigt.
Was sind die Inputvariablen des Modells?
Zu den wichtigsten Variablen gehören die aktuelle Dividende, die erwartete Wachstumsrate der Dividenden und der geforderte Diskontierungssatz (Kapitalkosten).
- Quote paper
- Niklas Müller (Author), 2019, Dividendendiskontierungsmodell zur Bewertung von kapitalmarktorientierten Unternehmen in der Reife- und Degenerationsphase des Unternehmens-Lebenszyklus-Konzeptes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1180892