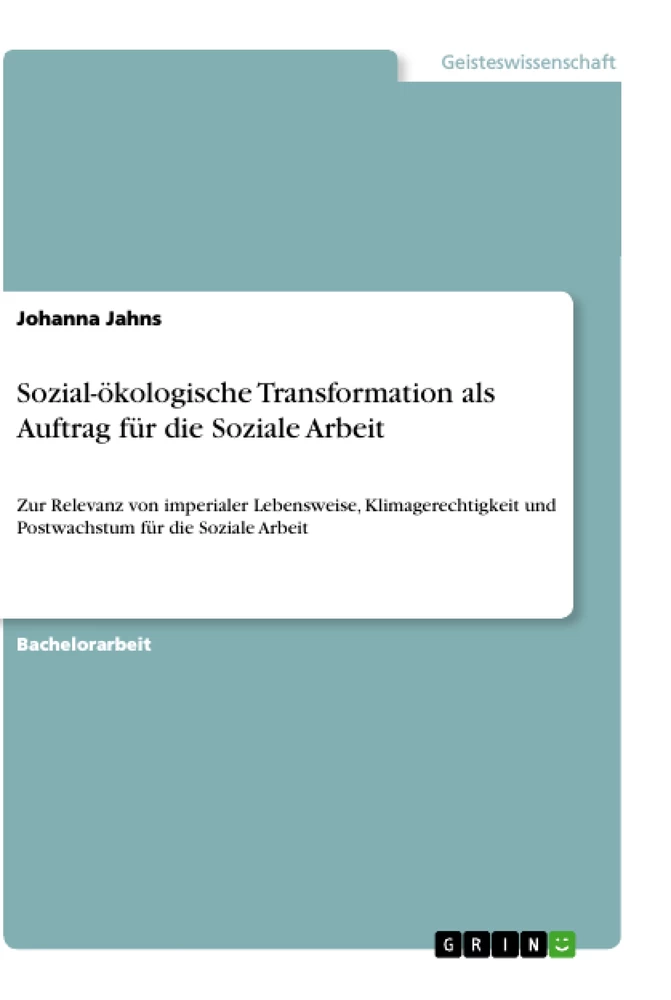Ziel dieser Arbeit ist es, neue Impulse zu setzen, um ökologische Gesichtspunkte auch in der Sozialen Arbeit anzusiedeln. Im Zentrum der Arbeit steht dabei besonders die Relevanz einer sozial-ökologischen Transformation für die Gesellschaft und die Bedeutung der Sozialen Arbeit für die Umsetzung eben dieser. Dabei soll auch darauf eingegangen werden, welche Rolle theoretische Konzepte wie die imperiale Lebensweise, die Klimagerechtigkeit und Postwachstumsdiskurse dabei spielen. Die primären Fragestellungen, die sich daraus für diese Arbeit ableiten lassen, lauten: Warum ist eine sozial-ökologische Transformation nötig? Weshalb besteht für die Soziale Arbeit ein Auftrag, an einer sozial-ökologischen Transformation zu wirken und was kann sie dazu beitragen? Welche Rolle spielen dabei die imperiale Lebensweise, Klimagerechtigkeit und Postwachstumsansätze?
Das Leben von Menschen auf der ganzen Welt wird zunehmend von multiplen sozialen und ökologischen Krisen bedroht: Erderwärmung, Flutkatastrophen, Dürren, Ressourcenknappheit, Ausbeutung von Arbeitskraft und Verarmung sind nur ein paar der Bedrohungen. Diese Krisen entstanden durch menschliches Handeln. Dabei ist der Hauptverursacher der globale Norden, welcher unter anderem durch seine imperiale Lebensweise maßgeblich dazu beiträgt, dass Ressourcen und Menschen ausgebeutet werden und die Klimakrise immer weiter voranschreitet. Dabei werden in den letzten Jahren soziale und ökologische Fragen immer häufiger zusammengedacht, weshalb viele eine sozial-ökologische Transformation erwirken wollen. Trotzdem ist diese tiefgreifende global benötigte Veränderung bisher ausgeblieben.
Auch die Soziale Arbeit stellt in vielen Professionsbereichen fest, dass Änderungen im Hinblick auf die multiplen sozial-ökologischen Krisenlagen vollzogen werden müssen. Was damit jedoch genau gemeint ist, darüber wird aktuell noch diskutiert. Wird die Soziale Arbeit jedoch als Menschenrechtsprofession nach Silvia Staub-Bernasconi angesehen, so ist es durchaus verwunderlich, dass bisher noch kaum ein Zusammenhang zwischen eigener Profession und einer sozial-ökologischen Transformation erkannt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zur Relevanz einer sozial-ökologischen Transformation
- 2.1 Die globale Klimakrise
- 2.2 Das Ende des Wachstums?
- 2.3 Die imperiale Lebensweise
- 2.3.1 Zur Entstehung der imperialen Lebensweise
- 2.3.2 Imperiale Lebensweise als Verursacherin sozial-ökologischer Krisen
- 3 Klimagerechtigkeit als Bindeglied zwischen Sozialer Arbeit und sozial-ökologischer Transformation
- 3.1 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession und Verfechterin sozialer Gerechtigkeit
- 3.2 Klimagerechtigkeit
- 3.2.1 Dekoloniale Perspektiven auf Klimagerechtigkeit
- 3.2.2 Geschlechtergerechtigkeit in der Klimadebatte
- 3.2.3 Menschen mit Beeinträchtigungen in Klimagerechtigkeitsdebatten
- 3.2.4 Klimagerechtigkeit und Soziale Arbeit
- 4 Ansätze zum Gelingen einer sozial-ökologischen Transformation
- 4.1 Postwachstumsansätze
- 4.1.1 Konkrete Transformationsansätze in Postwachstumsdiskursen
- 4.1.2 Kritik an Postwachstumsdebatten
- 4.2 Buen Vivir als dekoloniales Konzept für Transformationsprozesse
- 4.3 Aufgaben für die Soziale Arbeit
- 4.1 Postwachstumsansätze
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Relevanz einer sozial-ökologischen Transformation für die Soziale Arbeit. Sie analysiert die Notwendigkeit dieser Transformation im Kontext globaler Krisen und beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit bei deren Umsetzung. Die Arbeit hinterfragt den bisherigen Mangel an Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen in der Sozialen Arbeit.
- Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation angesichts multipler Krisen
- Der Auftrag der Sozialen Arbeit im Kontext sozial-ökologischer Transformation
- Die Rolle der imperialen Lebensweise als Krisenverursacher
- Klimagerechtigkeit als Bindeglied zwischen Sozialer Arbeit und ökologischer Transformation
- Postwachstumsansätze und Buen Vivir als transformative Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die dringende Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation heraus, die durch multiple soziale und ökologische Krisen wie Erderwärmung, Ressourcenknappheit und soziale Ungerechtigkeit bedingt ist. Sie betont die Rolle des globalen Nordens und seiner imperialen Lebensweise als Hauptverursacher dieser Krisen und verweist auf das Konzept der Externalisierung negativer Auswirkungen auf Länder des globalen Südens. Die Arbeit argumentiert, dass die Soziale Arbeit angesichts dieser Herausforderungen eine aktive Rolle bei der Transformation spielen muss, obwohl diese Verbindung bisher kaum Beachtung findet. Die zentralen Forschungsfragen werden formuliert, die sich auf die Notwendigkeit einer solchen Transformation, den Auftrag der Sozialen Arbeit und die Rolle relevanter Konzepte wie imperiale Lebensweise, Klimagerechtigkeit und Postwachstumsansätze konzentrieren.
2 Zur Relevanz einer sozial-ökologischen Transformation: Dieses Kapitel analysiert die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation anhand der globalen Klimakrise, des Wachstumsparadigmas kapitalistischer Gesellschaften und des Konzepts der imperialen Lebensweise. Es wird dargelegt, wie diese Faktoren zu den aktuellen Krisen beitragen und welche tiefgreifenden Veränderungen notwendig sind, um diesen entgegenzuwirken. Die Analyse der imperialen Lebensweise beleuchtet deren Entstehung und ihren Beitrag zur Ausbeutung von Ressourcen und Menschen, untermauert durch Zitate von Lessenich und Brand/Wissen.
3 Klimagerechtigkeit als Bindeglied zwischen Sozialer Arbeit und sozial-ökologischer Transformation: Das Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Sozialer Arbeit, Menschenrechten und sozial-ökologischer Transformation. Es argumentiert, dass die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession die Verantwortung hat, sich aktiv mit den Folgen der Klimakrise auseinanderzusetzen. Das Konzept der Klimagerechtigkeit wird im Detail betrachtet, wobei insbesondere dekoloniale Perspektiven, Geschlechtergerechtigkeit und die Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen beleuchtet werden. Der Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und den Aufgaben der Sozialen Arbeit wird herausgestellt.
4 Ansätze zum Gelingen einer sozial-ökologischen Transformation: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze für eine erfolgreiche sozial-ökologische Transformation. Im Fokus stehen Postwachstumsdiskurse mit ihren konkreten Transformationsansätzen und deren Kritik. Das dekoloniale Konzept von Buen Vivir wird als alternatives Modell vorgestellt. Abschließend werden mögliche Aufgaben der Sozialen Arbeit für die Gestaltung einer solchen Transformation beschrieben.
Schlüsselwörter
Sozial-ökologische Transformation, Klimagerechtigkeit, Imperiale Lebensweise, Postwachstum, Buen Vivir, Soziale Arbeit, Menschenrechte, Dekoloniale Perspektiven, Geschlechtergerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Sozial-ökologische Transformation und Soziale Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Relevanz einer sozial-ökologischen Transformation für die Soziale Arbeit. Sie analysiert die Notwendigkeit dieser Transformation im Kontext globaler Krisen und beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit bei deren Umsetzung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der bisherigen mangelnden Auseinandersetzung der Sozialen Arbeit mit ökologischen Fragen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation angesichts multipler Krisen, den Auftrag der Sozialen Arbeit in diesem Kontext, die Rolle der imperialen Lebensweise als Krisenverursacher, Klimagerechtigkeit als Bindeglied zwischen Sozialer Arbeit und ökologischer Transformation sowie Postwachstumsansätze und Buen Vivir als transformative Konzepte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Relevanz einer sozial-ökologischen Transformation (inkl. Analyse der globalen Klimakrise, des Wachstumsparadigmas und der imperialen Lebensweise), ein Kapitel zu Klimagerechtigkeit als Bindeglied zwischen Sozialer Arbeit und Transformation (inkl. Dekolonialer Perspektiven und Aspekten der Geschlechtergerechtigkeit), ein Kapitel zu Ansätzen für eine sozial-ökologische Transformation (inkl. Postwachstumsansätze und Buen Vivir) und abschließend ein Fazit mit Ausblick.
Welche Konzepte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert zentrale Konzepte wie die imperiale Lebensweise (inkl. ihrer Entstehung und Auswirkungen), Klimagerechtigkeit (inkl. dekolonialer Perspektiven und der Situation verschiedener gesellschaftlicher Gruppen), Postwachstumsansätze (inkl. Kritikpunkte) und Buen Vivir als alternatives Transformationsmodell.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der sozial-ökologischen Transformation?
Die Arbeit argumentiert, dass die Soziale Arbeit angesichts der multiplen Krisen eine aktive Rolle bei der Gestaltung einer sozial-ökologischen Transformation spielen muss. Sie betont die Verantwortung der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession und zeigt Handlungsfelder auf.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Handlungsbedarfe für die Soziale Arbeit im Kontext der sozial-ökologischen Transformation. Die Arbeit verdeutlicht die dringende Notwendigkeit einer aktiven Beteiligung der Sozialen Arbeit an diesem Transformationsprozess.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sozial-ökologische Transformation, Klimagerechtigkeit, Imperiale Lebensweise, Postwachstum, Buen Vivir, Soziale Arbeit, Menschenrechte, Dekoloniale Perspektiven, Geschlechtergerechtigkeit.
- Citar trabajo
- Johanna Jahns (Autor), 2021, Sozial-ökologische Transformation als Auftrag für die Soziale Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181064