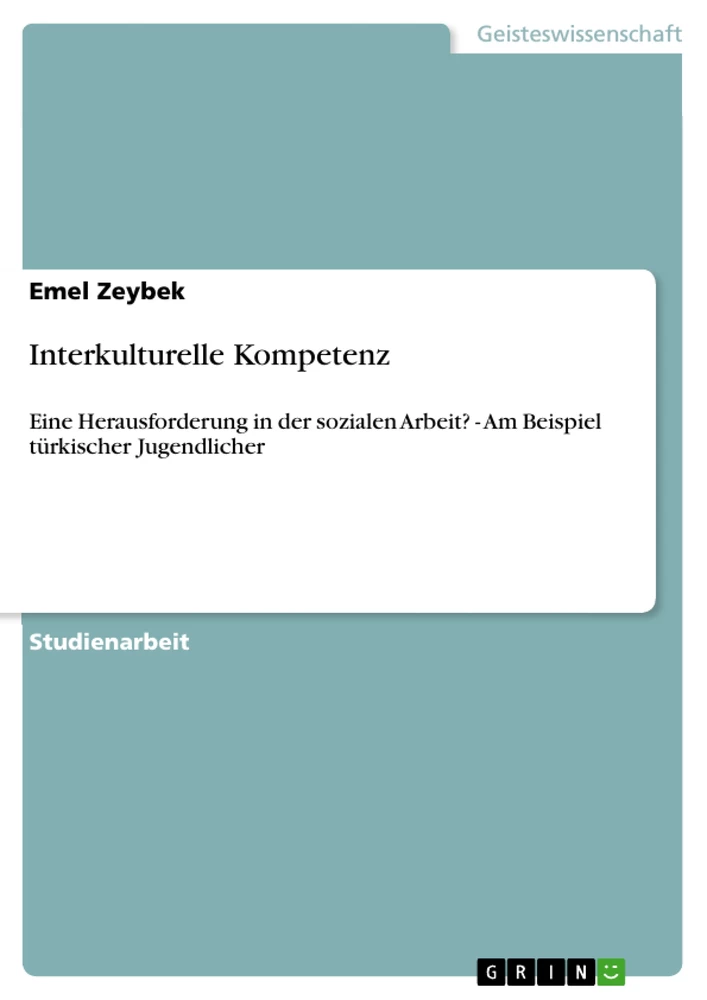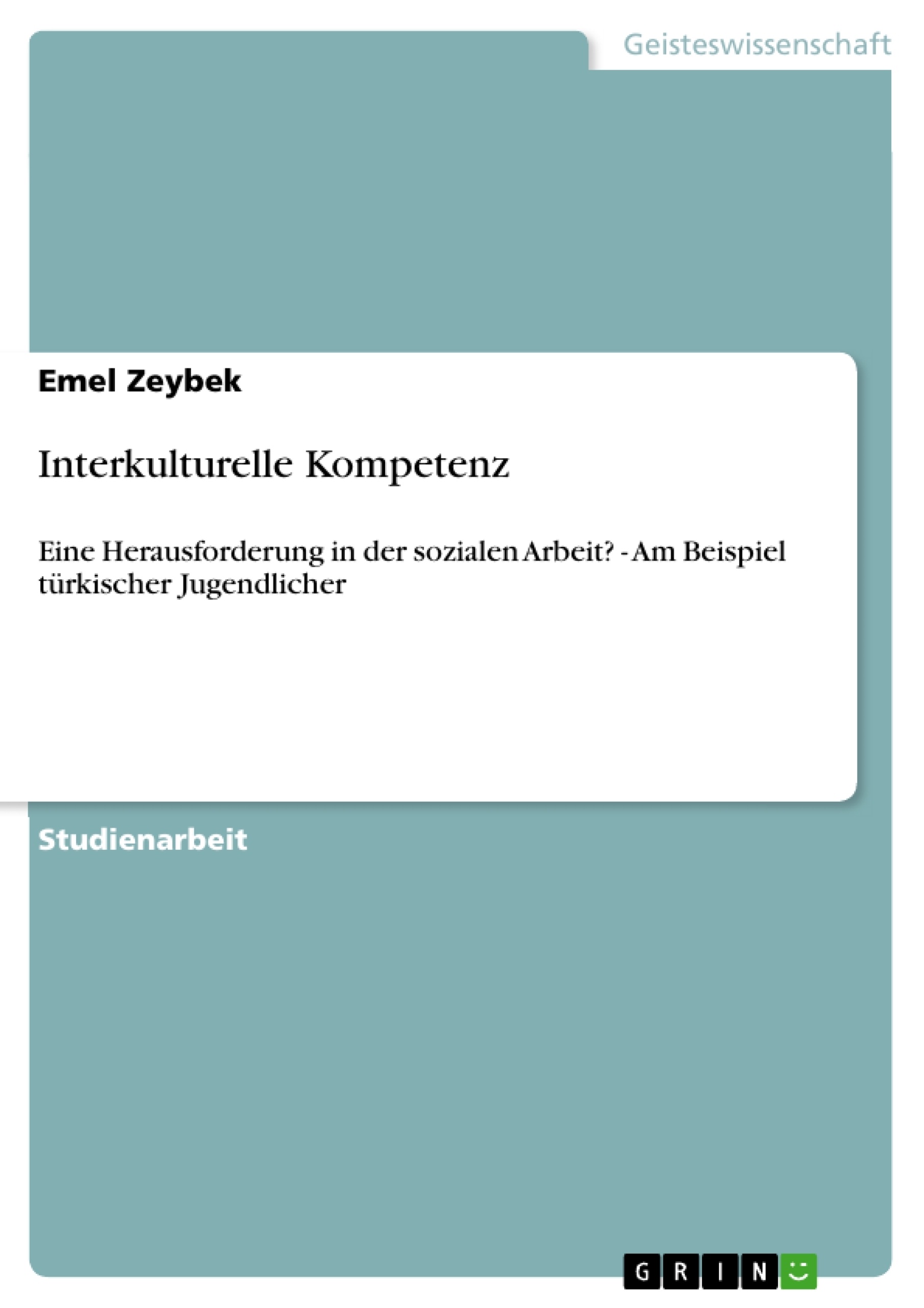In der Bundesrepublik Deutschland wurden in den `60 Jahren von Unternehmen und
Behörden Millionen ausländische Arbeitskräfte sogenannte „Gastarbeiter“ aus
verschiedenen Mittelmeerländern angeworben. Zu Beginn der Einwanderung ging man von
der Vorstellung aus, dass die „Gastarbeiter“ nach Deutschland kommen, arbeiten und nach
einigen Jahren in die Heimat zurückkehren würden. Die Entwicklung zu einem
Einwanderungsland wurde nicht bedacht. In den 70er Jahren entstand die
Ausländerpädagogik mit dem Ziel, die „Defizite“ der Migrantenkinder zu beheben. Die
Ausländerpädagogik (dieses werde ich im nächsten Abschnitt erklären) wandte die
ausgleichende Erziehungsmethode an, wollte damit die Anpassung der Migranten in die
Mehrheitsgesellschaft erleichtern. Mitte 80´er Jahre entstand die interkulturelle Pädagogik.
Im Gegenteil zu Ausländerpädagogik stellte sie nicht die Defizite der Migrantenkinder in den
Mittelpunkt, ihr Ziel war es, die Kinder zu einem multikulturellen Zusammenleben in der
deutschen Gesellschaft und somit zu einer gegenseitigen Akzeptanz zu befähigen. Die
Klienten der interkulturellen Erziehung waren sowohl Migranten- als auch einheimische
Kinder. Besonders in den letzten Jahren wurde der interkulturellen Kompetenz eine immer
größere Bedeutung als „Schlüsselkompetenz“ in einer globalisierten Welt zugeschrieben.
Angesichts einer immer offener werdenden Welt, treffen auch immer mehr Menschen
unterschiedlicher Kulturen aufeinander. Die Vermittlung zwischen verschiedenen
Lebenswelten und unterschiedlichen Systemen kann interkulturelle Spannungen und
Konflikten helfen, um die vorhandenen Ressourcen aller Beteiligten stärker zu nutzen. Die
Interkulturelle Kompetenz ermöglicht es eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkräften
und Hilfesuchenden. Unterschiedliche Wertvorstellungen, Normen und Konzeptionen von
Gesellschaft können leichter verständlich gemacht und reflektiert werden. Sie erleichtert es,
persönliche Gefühle, Kränkungen und Moralvorstellungen zu äußern. Interkulturelle
Kompetenz erfordert Fachkenntnisse und Perspektivenwechsel zu folgenden Themen wie
z.B.: • Gründe für Migration
• Lebensbedingungen der Migranten im Aufnahmeland
• Kultureller Hintergrund der Migranten ( z.B. Lebensbedingungen in den
Herkunftsländern, Religion, kulturspezifische Normen und Rollenerwartungen).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Die erste Migrationsgeneration
- Die türkische Familie
- Die Beziehung zwischen den Ehepartnern
- Erziehung und Eltern- Kind- Beziehung
- Schule
- Wohnsituation
- Ursachen von Gewalt unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Lernen am Modell
- Mögliche Erklärungsversuche zur Gewaltbereitschaft und kriminellem Verhalten bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Definition der Kinder- und Jugendhilfe
- Was ist Jugendsozialarbeit?
- Zur Entstehung der Interkulturelle Pädagogik
- Vorraussetzung für die Entwicklung interkultureller Konzepte
- Interkulturelle Kompetenz in der Sozialen Arbeit
- Die Qualifikation der Pädagogischen Fachkräfte
- Sozialpädagogischen Methoden
- Die Klientenzentrierte Gesprächsführung nach C.R. Rogers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderung der Interkulturellen Kompetenz in der Sozialen Arbeit am Beispiel türkischer Jugendlicher. Sie beleuchtet die Bedeutung von interkultureller Kompetenz in einer zunehmend globalisierten Welt und analysiert die Herausforderungen, die sich aus unterschiedlichen Lebenswelten und Kulturen ergeben.
- Die Bedeutung von Interkultureller Kompetenz in der Sozialen Arbeit
- Die Herausforderungen der Integration türkischer Jugendlicher in Deutschland
- Die Rolle der Familie und der Kultur in der Entwicklung von Jugendlichen
- Die Bedeutung von interkulturellen pädagogischen Konzepten
- Die Qualifikation von Fachkräften im Umgang mit interkulturellen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Interkulturellen Kompetenz in der Sozialen Arbeit heraus und führt in die Thematik ein. Im zweiten Kapitel werden wichtige Begriffe wie Migration, Immigration und Emigration definiert. Das dritte Kapitel beleuchtet die Situation der ersten Migrationsgeneration, insbesondere der türkischen Gastarbeiter, und die Herausforderungen, die sie im Aufnahmeland Deutschland erlebten. Kapitel 4 fokussiert auf die türkische Familie und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Jugendlichen. Es werden verschiedene Aspekte des Familienlebens, wie die Beziehung zwischen den Ehepartnern, Erziehung und Eltern-Kind-Beziehung, Schule und Wohnsituation, beleuchtet. Kapitel 5 untersucht die Ursachen von Gewalt unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere unter türkischen Jugendlichen. Es werden verschiedene Erklärungsversuche, wie das Lernen am Modell, diskutiert. Kapitel 6 definiert die Kinder- und Jugendhilfe und ihre Bedeutung für die Unterstützung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Kapitel 7 erläutert das Konzept der Jugendsozialarbeit und ihre Rolle bei der Integration von Jugendlichen. Kapitel 8 beschäftigt sich mit der Entstehung der interkulturellen Pädagogik und ihren wichtigsten Prinzipien. Es werden die Voraussetzungen für die Entwicklung interkultureller Konzepte, die Bedeutung von interkultureller Kompetenz in der Sozialen Arbeit und die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte behandelt. Kapitel 9 beleuchtet verschiedene sozialpädagogische Methoden, die im Umgang mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund eingesetzt werden können. Kapitel 10 befasst sich mit der klientenzentrierten Gesprächsführung nach C.R. Rogers und ihrer Bedeutung für die Interkulturelle Kommunikation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Migration, Interkulturelle Kompetenz, Integration, türkische Jugend, Familie, Gewalt, Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, interkulturelle Pädagogik, sozialpädagogische Methoden und klientenzentrierte Gesprächsführung.
- Quote paper
- Emel Zeybek (Author), 2008, Interkulturelle Kompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118140