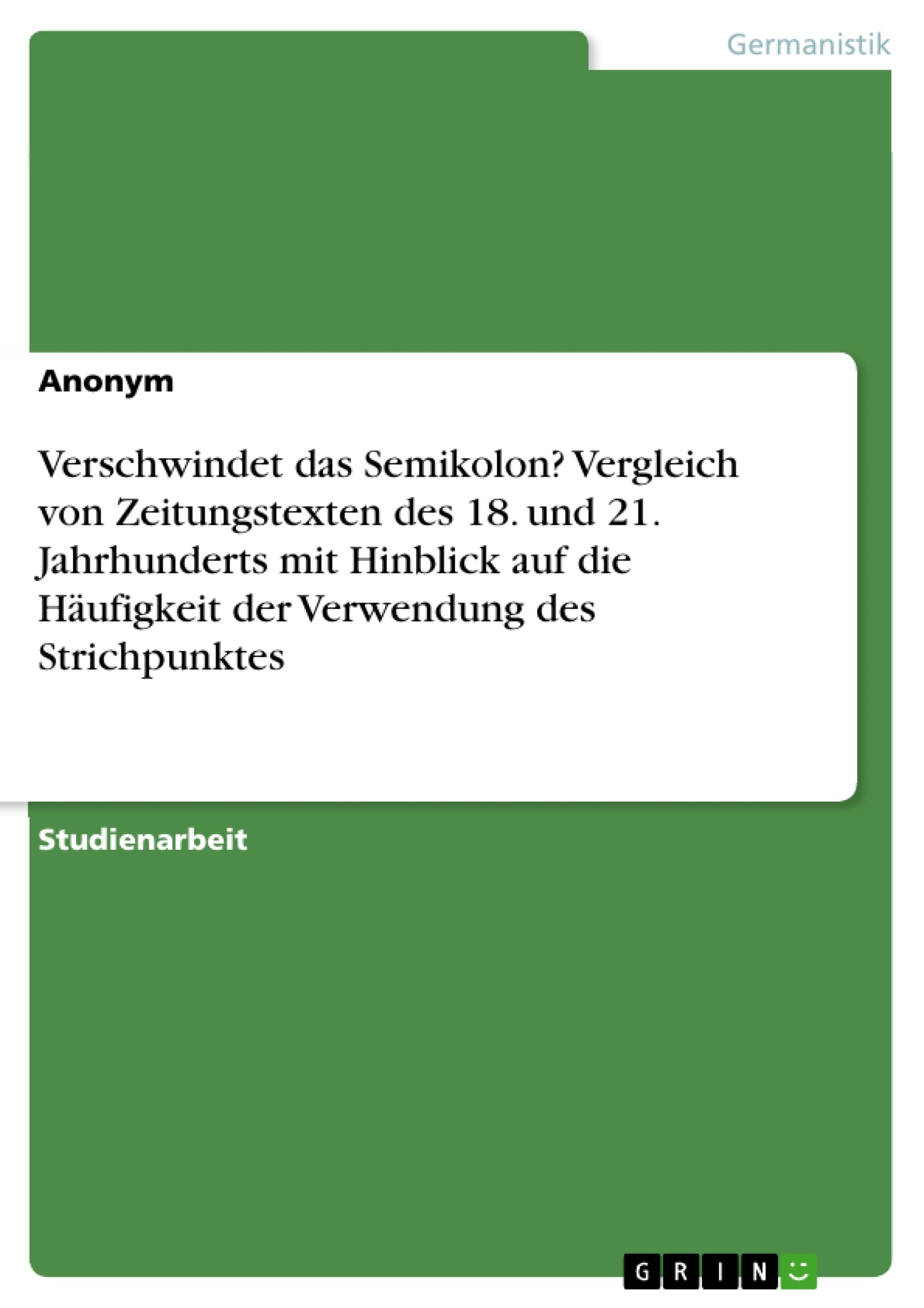In dieser Seminararbeit wird untersucht, ob speziell in aktuellen Zeitungstexten tatsächlich weniger Semikolons vorkommen als in Aufschriften des 18. Jahrhunderts. Dazu werden zunächst die offiziellen Rechtschreibregelungen von heute und damals aufgezeigt und gegenübergestellt, damit bekannt ist, wie die Leitlinien für den Gebrauch des Strichpunkts waren und sind. Weiterhin werden verschiedene Korpora auf die Verwendung des besagten Satzzeichens hin untersucht und ausgewertet, um eine tragbare Aussage über einen eventuellen Rückgang des Gebrauchs des Semikolons in Zeitungstexten zu machen. Die Korpora beinhalten Blätter des 18. und des 21. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Regeln zum Gebrauch des Semikolons: Vergleich 21. und 18. Jahrhundert
- 3. Überprüfung des eventuellen Rückgangs des Gebrauchs des Semikolons anhand von Zeitungstexten des 18. und 21. Jahrhunderts
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Hypothese, dass das Semikolon im Laufe der Zeit an Häufigkeit verloren hat. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der Verwendung des Semikolons in Zeitungstexten des 18. und 21. Jahrhunderts. Die Arbeit soll klären, ob das subjektive Empfinden eines Rückgangs des Semikolons durch quantitative Daten belegt werden kann.
- Vergleich der Regeln zum Gebrauch des Semikolons im 18. und 21. Jahrhundert
- Quantitative Analyse der Semikolon-Verwendung in Zeitungstexten beider Jahrhunderte
- Identifizierung möglicher Gründe für einen Rückgang der Semikolon-Verwendung
- Bewertung der Rolle des Sprachgefühls bei der Interpunktion
- Diskussion der historischen Entwicklung der Semikolon-Verwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Rückgang des Semikolons und dem damit verbundenen subjektiven Empfinden. Sie erwähnt bereits bestehende Meinungen von Waechter (2008) und Ley (2014), die einen Rückgang des Semikolons beklagen, und führt die Forschungsmethodik ein, die auf einem Vergleich von Zeitungstexten des 18. und 21. Jahrhunderts basiert. Die Arbeit zielt darauf ab, diese subjektiven Beobachtungen durch eine quantitative Analyse zu überprüfen.
2. Regeln zum Gebrauch des Semikolons: Vergleich 21. und 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die historischen Regeln zum Gebrauch des Semikolons, beginnend mit Ratkes Beschreibung im 17. Jahrhundert bis hin zu modernen Rechtschreibregeln. Es zeigt, dass die Regeln historisch immer eine gewisse Flexibilität und Abhängigkeit vom Sprachgefühl des Schreibers beinhalten. Der Vergleich verdeutlicht den Wandel in der expliziten Regelsetzung, von vagen Beschreibungen hin zu mehr Interpretationsspielraum im modernen Sprachgebrauch. Dies wird als ein möglicher Faktor für den Rückgang der Semikolon-Verwendung diskutiert. Der Kontrast zwischen den Ansätzen von Heynatz (1772) und modernen Duden-Regelungen wird herausgestellt, um den Wandel der Perspektive auf das Semikolon zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Semikolon, Strichpunkt, Interpunktion, Zeitungstext, 18. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Rechtschreibregeln, Sprachgefühl, Quantitative Analyse, Korpuslinguistik, historische Sprachentwicklung
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Rückgang des Semikolons?
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Hypothese, dass die Verwendung des Semikolons im Laufe der Zeit abgenommen hat. Der Fokus liegt auf einem quantitativen Vergleich des Semikolongebrauchs in Zeitungstexten des 18. und 21. Jahrhunderts.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit möchte klären, ob das subjektive Empfinden eines Rückgangs des Semikolons durch quantitative Daten belegt werden kann. Sie analysiert die historischen Regeln zum Semikolongebrauch und untersucht mögliche Gründe für einen Rückgang der Verwendung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit vergleicht die Regeln zum Semikolongebrauch im 18. und 21. Jahrhundert. Eine quantitative Analyse der Semikolon-Verwendung in Zeitungstexten beider Jahrhunderte bildet den Kern der Untersuchung. Die Ergebnisse werden zur Überprüfung der Hypothese herangezogen.
Welche Zeiträume werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Zeitungstexte aus dem 18. und dem 21. Jahrhundert, um den Wandel im Semikolongebrauch über einen langen Zeitraum zu untersuchen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf historische Rechtschreibregeln und analysiert Zeitungstexte aus dem 18. und 21. Jahrhundert. Sie erwähnt bereits bestehende Meinungen von Waechter (2008) und Ley (2014) zum Thema.
Welche Aspekte der Semikolon-Verwendung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Wandel in den Regeln zum Semikolongebrauch, die quantitative Häufigkeit des Semikolons in den untersuchten Texten und mögliche Gründe für einen Rückgang der Verwendung. Die Rolle des Sprachgefühls bei der Interpunktion wird ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich der Regeln zum Semikolongebrauch im 18. und 21. Jahrhundert, ein Kapitel zur Überprüfung des Rückgangs anhand von Zeitungstexten und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Semikolon, Strichpunkt, Interpunktion, Zeitungstext, 18. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Rechtschreibregeln, Sprachgefühl, Quantitative Analyse, Korpuslinguistik, historische Sprachentwicklung.
Welche Schlussfolgerung wird angestrebt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die subjektive Wahrnehmung eines Rückgangs des Semikolons durch eine quantitative Analyse zu überprüfen und mögliche Gründe für einen solchen Rückgang zu identifizieren.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Verschwindet das Semikolon? Vergleich von Zeitungstexten des 18. und 21. Jahrhunderts mit Hinblick auf die Häufigkeit der Verwendung des Strichpunktes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181867