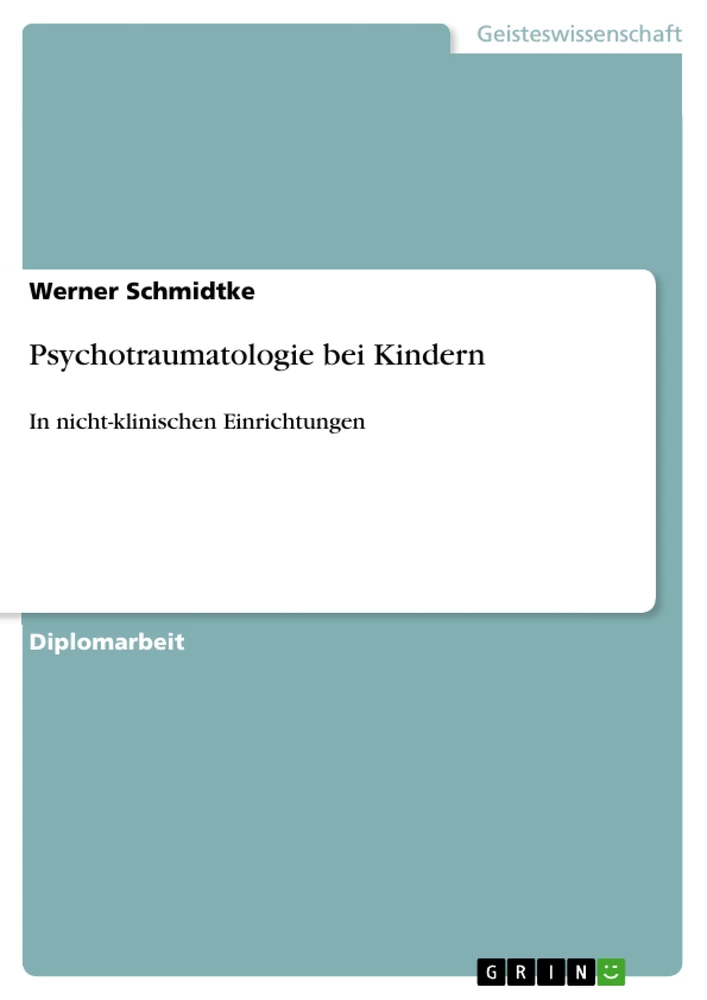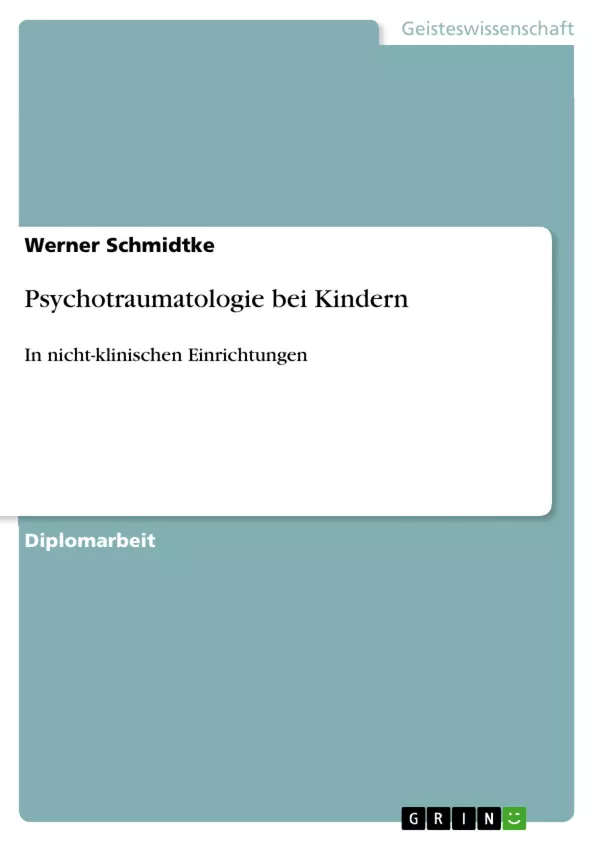Kindern sind die Darstellungen ihres Erlebens und gar die Einarbeitung eines traumatischen Erlebnisses als etwas von außen Kommendes, an dem sie nicht schuld sind, kaum möglich. Für Kinder stellen traumatisierende Situationen eine schwere Erschütterung des sich in der Entwicklung befindlichen Welt- und Selbstverständnisses dar. (vgl. Fischer u. Riedesser, 2003, S.276). Sie fühlen sich vielleicht alleingelassen, da die Eltern die Reaktionen des Kindes aufgrund des Erlebnisses nicht verstehen oder unterschätzen. Doch selbst wenn Eltern ein betroffenes Kind beispielsweise in Behandlung zu einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten geben, ist eine spezifische Behandlung und Aufarbeitung des traumatischen Ereignisses aus zweierlei Gründen nicht gewährleistet. Zum einen ist die Landschaft der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten ohnehin sehr rar gesät und zum anderen sieht eine Ausbildung dieser Berufsgruppe keine expliziten traumaspezifischen Inhalte vor. In dieser Arbeit wird zu fragen sein, ob pädagogische Fachkräfte, wie Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Lehrer u.a., die in ihrem Arbeitsfeld traumatisierten Kindern begegnen und sich oftmals mit unangemessenen Reaktionen dieser auf eher alltägliche Situationen konfrontiert sehen, diese Verhaltensweisen in Verbindung mit außergewöhnlichen Situationen der Kinder bringen können, zumal es den Kindern selbst vielleicht kaum gelingt, ihre Gefühle und Bedürfnisse angemessen zu äußern. Somit könnte den Kindern eine wirkungsvolle Hilfe von einer spezifisch geschulten Fachkraft versperrt sein, so dass eine Grundlage für eine psychopathogene Störung gelegt ist, auch wenn es hierzu noch einer Vielzahl an weiteren noch darzustellenden Faktoren bedarf. Gerade im Kontext des alltagspädagogischen Arbeitsfeldes ist es ein Anliegen dieser Arbeit, aufzuzeigen, wie sich traumatische Situationen in der Entwicklung des Kindes auswirken und welche Folgen eine inadäquate Intervention haben kann. Hierbei spielen v.a. Ergebnisse der Psychotraumatologie eine große Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Psychotraumatologie
- 2.1 Historische Entwicklungen
- 2.2 Diagnostische Sichtweisen der Psychotraumatologie
- 2.2.1 Definition der Traumabegriffs
- 2.3 Kurz- und Langzeitfolgen einer Traumatisierung
- 2.4 Das Verlaufsmodell und kritische Anmerkung zu kategorischen Diagnoseverfahren
- 3. Traumatisierung im Kindesalter
- 3.1 Entwicklungen des Kindes
- 3.1.1 Die Entwicklungslinie des Bindungsverhaltens
- 3.1.2 Entwicklung des Selbst
- 3.2 Kindheitstrauma und Entwicklungsaspekte
- 3.3 Traumafolgen und Merkmale bei Kindern
- 3.4 Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.4.1 Risikofaktoren
- 3.4.2 Schutzfaktoren
- 4. Traumatherapie bei Kindern
- 4.1 Diagnostische Unterschiede bei Erwachsenen und Kindern
- 4.2 Therapeutische Grundsätze einer Traumaintervention bei Kindern
- 4.3 Psychotherapeutische Ansätze zur Behandlung traumatisierter Kinder
- 4.3.1 Kognitive Verhaltenstherapie
- 4.3.2 EMDR
- 4.3.3 Psychodynamische Traumatherapie (PTT)
- 4.4 Zur Problematik in der therapeutischen Beziehung und Behandlung bei traumatisierten Kindern
- 5. Zusammenfassung der Psychotraumatologie
- 6. Psychotraumatologie und Soziale Arbeit
- 6.1 Sozialpädagogische Institutionen und deren Gegenstandsbereich im Themenkontext
- 6.2 Aufgaben sozialpädagogischer Einrichtungen im Kontext von Traumatisierungen
- 6.3 Zur Unsicherheit im Umgang mit traumatisierten Kinder
- 7. Regionale Erhebung in sozialpädagogischen Einrichtungen über den Bekanntheitsgrad der Psychotraumatologie
- 7.1 Vorstellung der Erhebung
- 7.2 Darstellungen der Befragungsergebnisse
- 8. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Psychotraumatologie und deren Relevanz in der Sozialen Arbeit mit Kindern in nichtklinischen Einrichtungen. Ziel ist es, die Folgen von Traumatisierung im Kindesalter zu beleuchten und die Bedeutung einer traumaspezifischen Intervention in der pädagogischen Praxis aufzuzeigen.- Die Arbeit analysiert die Auswirkungen traumatischer Erlebnisse auf die Entwicklung von Kindern.
- Sie untersucht die Rolle von Risiko- und Schutzfaktoren im Kontext der Traumatisierung.
- Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der Traumatherapie bei Kindern.
- Sie untersucht die Bedeutung der Psychotraumatologie im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit.
- Die Arbeit präsentiert Ergebnisse einer regionalen Erhebung über den Bekanntheitsgrad der Psychotraumatologie in sozialpädagogischen Einrichtungen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein, indem sie den aktuellen Stand der Forschung und die Relevanz des Themas im Kontext der Sozialen Arbeit beleuchtet.
- Kapitel 2: Psychotraumatologie: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Psychotraumatologie, inklusive historischer Entwicklungen, diagnostischer Sichtweisen und der Folgen von Traumatisierung.
- Kapitel 3: Traumatisierung im Kindesalter: Dieses Kapitel fokussiert auf die Besonderheiten der Traumatisierung im Kindesalter, inklusive der Entwicklung des Kindes, der Folgen von Traumatisierung und der Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren.
- Kapitel 4: Traumatherapie bei Kindern: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen und Möglichkeiten der Traumatherapie bei Kindern, inklusive diagnostischer Unterschiede, therapeutischer Grundsätze und verschiedener psychotherapeutischer Ansätze.
- Kapitel 5: Zusammenfassung der Psychotraumatologie: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse und Ergebnisse der Psychotraumatologie zusammen, die in den vorherigen Kapiteln behandelt wurden.
- Kapitel 6: Psychotraumatologie und Soziale Arbeit: Dieses Kapitel analysiert die Relevanz der Psychotraumatologie im Kontext der Sozialen Arbeit, indem es die Aufgaben von sozialpädagogischen Einrichtungen im Umgang mit traumatisierten Kindern beleuchtet.
- Kapitel 7: Regionale Erhebung in sozialpädagogischen Einrichtungen über den Bekanntheitsgrad der Psychotraumatologie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer regionalen Erhebung, die den Bekanntheitsgrad der Psychotraumatologie in sozialpädagogischen Einrichtungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Psychotraumatologie, Traumatisierung, Kindheit, Sozialpädagogik, Traumafolgen, Traumatherapie, Risiko- und Schutzfaktoren, soziale Arbeit, pädagogische Praxis, regionale Erhebung, Bekanntheitsgrad.Welche Auswirkungen haben Traumata auf die kindliche Entwicklung?
Traumatisierende Situationen erschüttern das sich entwickelnde Welt- und Selbstverständnis von Kindern massiv. Sie beeinträchtigen das Bindungsverhalten und können ohne adäquate Intervention zu psychopathogenen Störungen führen.
Warum ist die Diagnose von Traumata bei Kindern schwierig?
Kindern fällt es oft schwer, ihr Erleben sprachlich auszudrücken oder traumatische Ereignisse als etwas Äußeres einzuordnen. Zudem zeigen sie oft Verhaltensweisen, die in alltäglichen Situationen als unangemessen missverstanden werden.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei traumatisierten Kindern?
Pädagogische Fachkräfte in nichtklinischen Einrichtungen sind oft die ersten Kontaktpersonen. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, dass Sozialpädagogen und Lehrer spezifisch geschult werden, um Traumafolgen zu erkennen.
Was sind Risiko- und Schutzfaktoren im Kontext der Psychotraumatologie?
Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Traumafolgestörung, während Schutzfaktoren (Resilienz) dem Kind helfen, Belastungen besser zu verarbeiten. Die Arbeit analysiert beide Seiten im Detail.
Welche psychotherapeutischen Ansätze für Kinder werden vorgestellt?
Die Arbeit beleuchtet die kognitive Verhaltenstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) und die psychodynamische Traumatherapie (PTT).
Wie bekannt ist die Psychotraumatologie in sozialpädagogischen Einrichtungen?
Eine regionale Erhebung in der Arbeit untersucht den Bekanntheitsgrad des Fachgebiets und zeigt auf, wo Defizite in der Ausbildung und im Umgang mit betroffenen Kindern liegen.