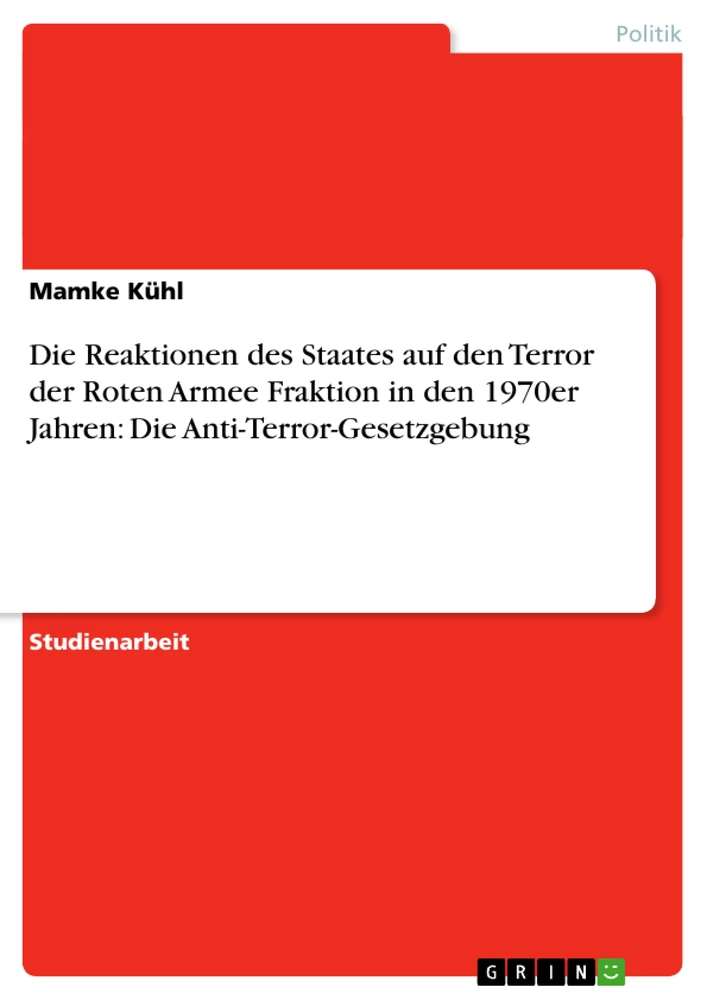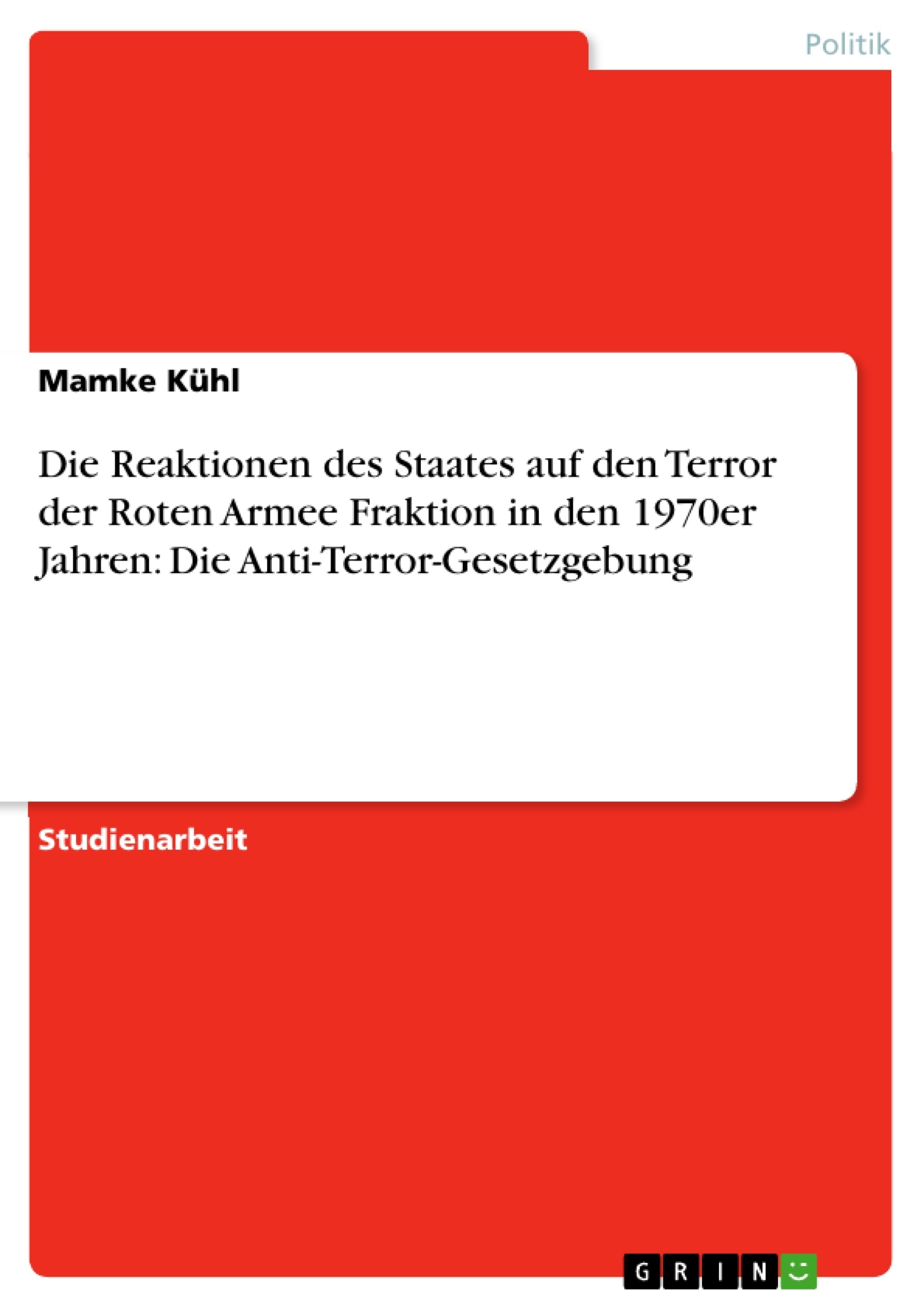Kürzlich wurden zwei Terrorverdächtige aus einer KLM-Maschine auf dem Flughafen Köln-Bonn geholt. Mehrere terroristische Bombenanschläge mit islamistischem Hin-tergrund sind in den letzten Jahren in Deutschland verhindert worden. Als Bürger hat man den Eindruck, der Staat geht souverän mit der Bedrohung um. Prozesse gegen Terrorverdächtige müssen nicht jahrelang vorbereitet werden.
Wie aber sah der Umgang des Staates mit dem bundesdeutschen Terror der 1970er Jahre aus? Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Reaktionen des deut-schen Rechtstaates auf den Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF). Seinen Höhepunkt fand der Terrorismus in Deutschland im Herbst 1977, als die RAF den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer entführte. Die 44 Tage seiner Entführung gelten als „eines der am meisten bedrückenden Kapitel der Ge-schichte der Bundesrepublik“ (Wesel 2002: 257). Eine Welle von Gewalttaten er-schütterte die Republik, auf die der Staat mit aller Härte reagierte. Er schöpfte nahe-zu alle rechtstaatlichen Mittel aus und schuf – wo nötig – neue Gesetze. Zwischen 1970 und 1978 wurden eine Vielzahl von Gesetzen, bzw. Gesetzesänderungen zur Abwehr der vom Terrorismus ausgehenden Gefahren beschlossen.
Zunächst werde ich kurz auf die Geschichte der RAF eingehen, ihre Gründung nach-vollziehen, ihre Ziele beschreiben und welche Gewalttaten in den 1970er Jahren auf ihr Konto gingen. Danach beschäftige ich mich mit den wichtigsten Neuerungen im Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung. Unter anderem geht es dabei um den Verteidigerausschluss, die Möglichkeit, Verhandlungen in Abwesenheit der Ange-klagten durchzuführen und das Kontaktsperregesetz. Abschließend werde ich eine Bewertung der staatlichen Reaktionen auf den Terrorismus vornehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die RAF - Ein Überblick bis 1977
- Reaktionen des Staates
- Das erste Anti-Terror-Paket
- Gesetzgebungstätigkeiten im Jahr 1976
- Kontaktsperre
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Reaktionen des deutschen Rechtstaates auf den Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF) in den 1970er Jahren, insbesondere im Kontext der Entführung Hanns-Martin Schleyers im Herbst 1977. Die Arbeit untersucht die Anti-Terror-Gesetzgebung, die in dieser Zeit erlassen wurde, und beleuchtet die wichtigsten Neuerungen im Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung.
- Die Entstehung und Entwicklung der RAF in den 1970er Jahren
- Die wichtigsten Gewalttaten der RAF
- Die staatlichen Reaktionen auf den Terrorismus der RAF
- Die Anti-Terror-Gesetzgebung und ihre Auswirkungen
- Die Bewertung der staatlichen Reaktionen auf den Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Aktualität des Themas im Hinblick auf den Terrorismus der Gegenwart. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Geschichte der RAF bis 1977, einschließlich ihrer Entstehung, ihrer Ziele und ihrer wichtigsten Gewalttaten. Kapitel 3 analysiert die wichtigsten Neuerungen im Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung, die in Reaktion auf den Terrorismus der RAF erlassen wurden. Dazu gehören der Verteidigerausschluss, die Möglichkeit, Verhandlungen in Abwesenheit der Angeklagten durchzuführen und das Kontaktsperregesetz.
Schlüsselwörter
Rote Armee Fraktion (RAF), Terrorismus, Anti-Terror-Gesetzgebung, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Verteidigerausschluss, Kontaktsperre, Bundesrepublik Deutschland, 1970er Jahre, Hanns-Martin Schleyer, Stadtguerilla, Marxismus-Leninismus, Vietnam-Krieg.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Rote Armee Fraktion (RAF)?
Die RAF war eine linksextremistische terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland, die vor allem in den 1970er Jahren aktiv war.
Was geschah im "Deutschen Herbst" 1977?
Der Höhepunkt des Terrors war die Entführung und spätere Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer durch die RAF.
Was ist das Kontaktsperregesetz?
Ein Gesetz, das erlassen wurde, um jegliche Kommunikation zwischen inhaftierten Terroristen und der Außenwelt (inklusive Verteidigern) in Krisensituationen zu unterbinden.
Welche Änderungen gab es in der Strafprozessordnung?
Es wurden Möglichkeiten zum Verteidigerausschluss und zur Durchführung von Verhandlungen in Abwesenheit der Angeklagten geschaffen.
Wie reagierte der Rechtsstaat auf die Bedrohung?
Der Staat reagierte mit Härte und schuf zwischen 1970 und 1978 eine Vielzahl neuer Anti-Terror-Gesetze zur Gefahrenabwehr.
- Quote paper
- Mamke Kühl (Author), 2008, Die Reaktionen des Staates auf den Terror der Roten Armee Fraktion in den 1970er Jahren: Die Anti-Terror-Gesetzgebung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118268