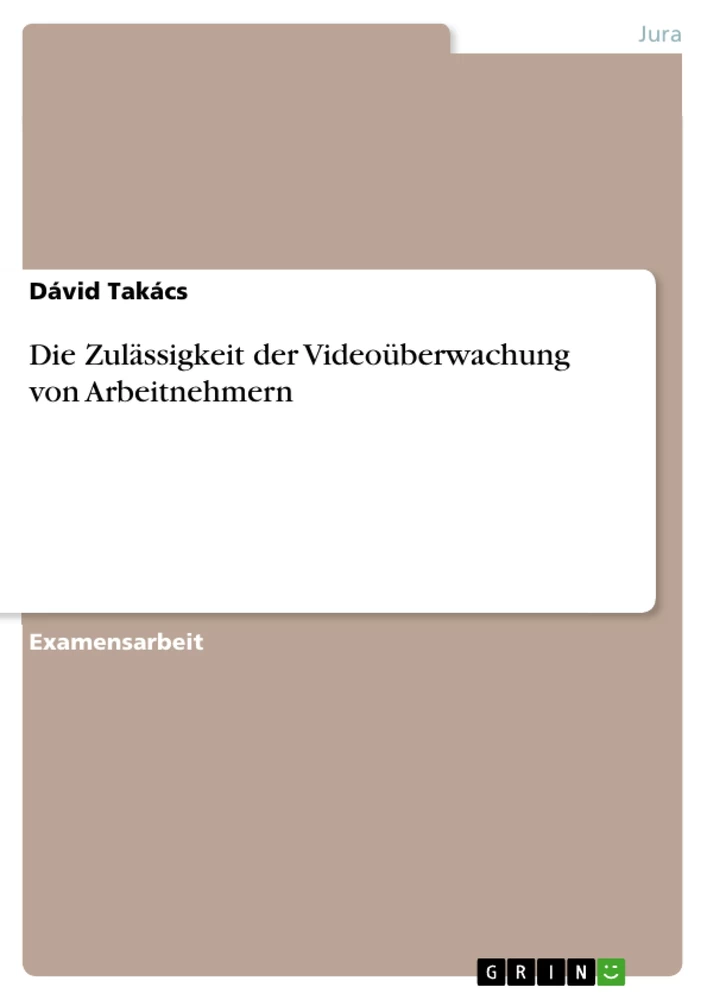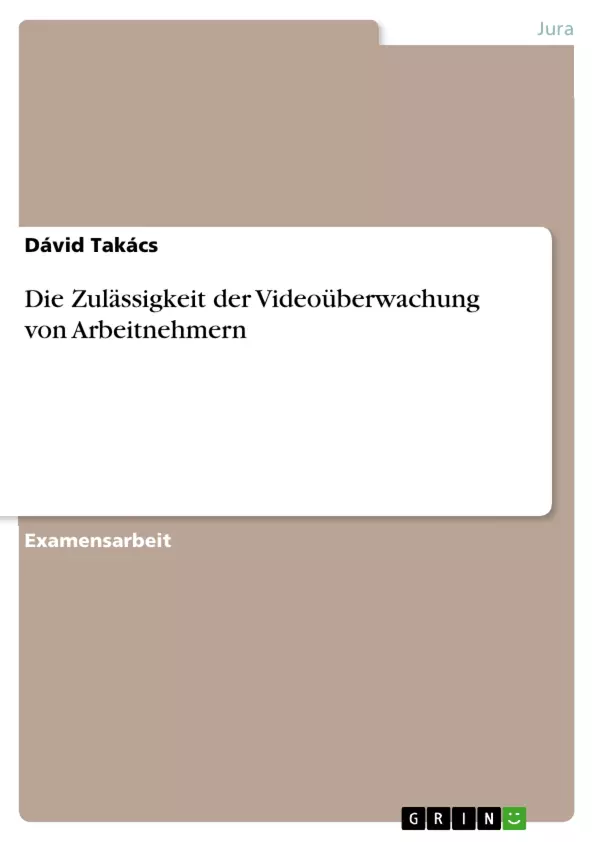Neben der alltäglichen Relevanz ist die rechtliche Dimension der Frage hochaktuell. Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des angepassten Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) am 25.5.2018 erhielt die Diskussion um die Zulässigkeit der Videoüberwachung der Arbeitnehmer einen neuen Impuls.
Daneben befeuern Schlagzeilen über Bußgelder in Millionenhöhe auf Unternehmerseite die Sorge, Fehler im Umgang mit Datenschutz könnten die Existenz des Unternehmens bedrohen.
Nun steht der jahrzehntelangen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Videoüberwachung der Arbeitnehmer die neue europäische Verordnung gegenüber. In dieser Arbeit wird untersucht, welche Auswirkungen die neue Rechtslage auf die Zulässigkeit der Videoüberwachung hat und an welcher Stelle die bereits entwickelten Grundsätze weitergelten.
Die Untersuchung geht von den Regelungen der DSGVO aus und beantwortet die Frage, ob das gleichzeitig novellierte BDSG eine zulässige Konkretisierung im Rahmen der Öffnungsklauseln ist. Anschließend werden nach einem kurzen Exkurs in die grundrechtliche Dimension der Fragestellung, die von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an die Videoüberwachung systematisiert. Danach wird gezeigt, wieso die verdeckte Videoüberwachung nach der deutschen Rechtslage nicht zu rechtfertigen ist und es eines Rückgriffs auf die DSGVO bedarf. Abschließend werden die für die Praxis relevanten Grundsätze der Beweisverwertungsverbote skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemaufriss
- II. Gang der Untersuchung
- B. Zulässigkeit der Videoüberwachung von Arbeitnehmern
- I. Gesetzliche Ausgangslage
- 1. Beschäftigtendatenschutz der DSGVO und des BDSG
- a) Europäische Regelung in der DSGVO
- aa) Grundsatz und ausgewählte Anforderungen
- bb) Öffnungsklauseln, insbesondere Art. 88 Abs. 1 DSGVO
- (1) Unzulässigkeit der Abweichung nach unten
- (2) Unzulässigkeit der Abweichung nach oben
- b) Nationale Gesetzesgrundlage im BDSG
- aa) Relevante Erlaubnisnormen
- bb) Verhältnis der Erlaubnisnormen zueinander
- c) Vereinbarkeit des BDSG mit europäischem Recht
- aa) § 4 BDSG europarechtswidrig
- bb) § 26 BDSG dagegen zulässige Konkretisierung der DSGVO
- (1) Datenverarbeitung nach § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG
- (2) Datenverarbeitung nach § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG
- 2. (Unions-) Grundrechtliche Dimension der Fragestellung
- a) Verfassungsgrundrechte der Arbeitgeber
- b) Verfassungsgrundrechte der Arbeitnehmer
- 3. Zwischenergebnis zur gesetzlichen Ausgangslage
- a) Europäische Regelung in der DSGVO
- II. Zulässigkeitsanforderungen der Videoüberwachung
- 1. Ausgangsüberlegungen
- 2. Systematisierung der Zulässigkeitsvoraussetzungen nach der Rechtsprechung
- a) Legitimer Zweck oder Anfangsverdacht
- b) Geeignet
- c) Erforderlichkeit
- d) Angemessenheit/Überwachungsquadrant
- aa) Offene Überwachung öffentlicher Räume
- bb) Offene Überwachung nicht öffentlicher Räume
- cc) Verdeckte Überwachung öffentlicher Räume
- dd) Verdeckte Überwachung nicht öffentlicher Räume
- ee) Kriterien zur Bestimmung der Eingriffsintensität
- 3. Verdeckte Videoüberwachung europarechtswidrig?
- 4. Mitbestimmungsrecht
- 5. Bewertung der Zulässigkeitsvoraussetzungen
- III. Rechtsfolgen bei Unzulässigkeit
- 1. Beschäftigtendatenschutz der DSGVO und des BDSG
- C. Untersuchungsergebnis und Ausblick
- I. Gesetzliche Ausgangslage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Examensseminararbeit untersucht die Zulässigkeit der Videoüberwachung von Arbeitnehmern unter Berücksichtigung der relevanten Rechtsnormen und Rechtsprechung. Der Fokus liegt dabei auf der Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers an der Überwachung und den Grundrechten der Arbeitnehmer auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Videoüberwachung im Arbeitsverhältnis
- Datenschutzrechtliche Vorgaben der DSGVO und des BDSG
- Grundrechtliche Aspekte der Videoüberwachung
- Zulässigkeit der Videoüberwachung unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit
- Rechtsfolgen bei unzulässiger Videoüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Problemaufriss und den Gang der Untersuchung darlegt. Im Hauptteil wird zunächst die gesetzliche Ausgangslage hinsichtlich des Beschäftigtendatenschutzes der DSGVO und des BDSG beleuchtet. Anschließend werden die grundrechtlichen Aspekte der Videoüberwachung im Arbeitsverhältnis erörtert. Die Zulässigkeit der Videoüberwachung wird danach unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit geprüft, wobei verschiedene Aspekte wie der legitime Zweck, die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Angemessenheit betrachtet werden. Die Rechtsfolgen bei unzulässiger Videoüberwachung werden im letzten Abschnitt des Hauptteils behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Videoüberwachung, Arbeitnehmer, Datenschutz, Grundrechte, DSGVO, BDSG, Verhältnismässigkeit, Rechtliche Zulässigkeit, Rechtsfolgen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Videoüberwachung am Arbeitsplatz nach der DSGVO erlaubt?
Ja, sie ist unter strengen Voraussetzungen zulässig, wenn sie einem legitimen Zweck dient, erforderlich ist und das Interesse des Arbeitgebers die Rechte des Arbeitnehmers überwiegt.
Was regelt § 26 BDSG im Hinblick auf die Überwachung?
§ 26 BDSG konkretisiert die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere zur Aufdeckung von Straftaten oder zur Kontrolle der Vertragspflichten.
Wann ist eine verdeckte Videoüberwachung zulässig?
Eine verdeckte Überwachung ist nur in absoluten Ausnahmefällen bei einem konkreten Anfangsverdacht einer schweren Straftat zulässig, wenn alle anderen milderen Mittel ausgeschöpft sind.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei der Videoüberwachung?
Der Betriebsrat hat gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Einführung und Anwendung von technischen Überwachungseinrichtungen.
Was passiert bei einer unzulässigen Videoüberwachung?
Unzulässige Überwachung kann zu hohen Bußgeldern, Schadensersatzansprüchen der Mitarbeiter und einem Beweisverwertungsverbot in Arbeitsgerichtsprozessen führen.
- Citar trabajo
- Dávid Takács (Autor), 2020, Die Zulässigkeit der Videoüberwachung von Arbeitnehmern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1182834