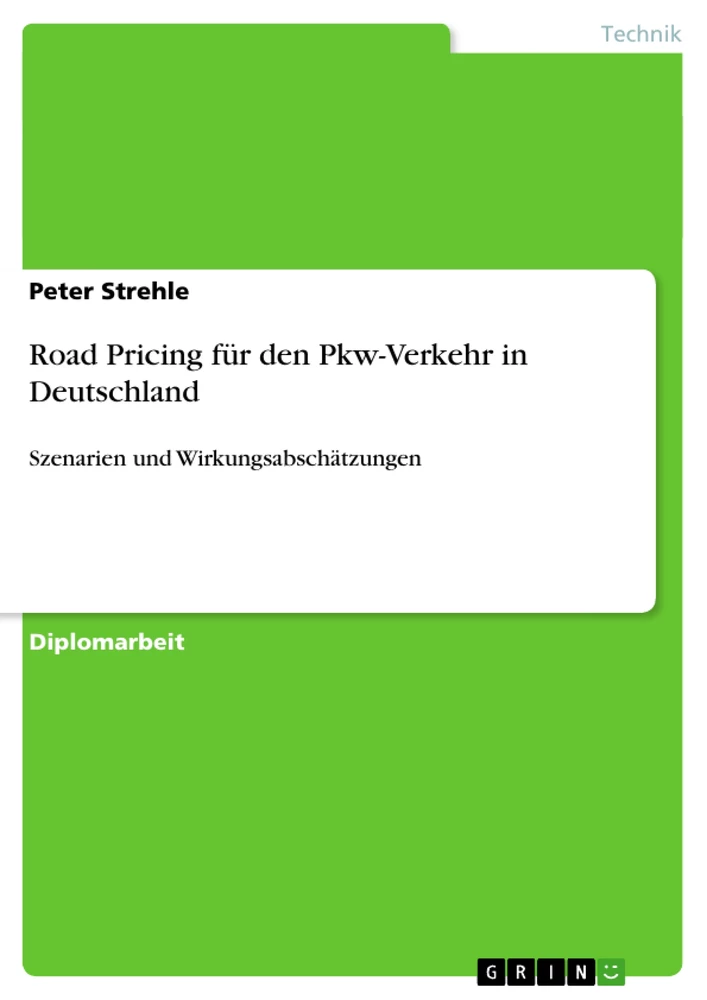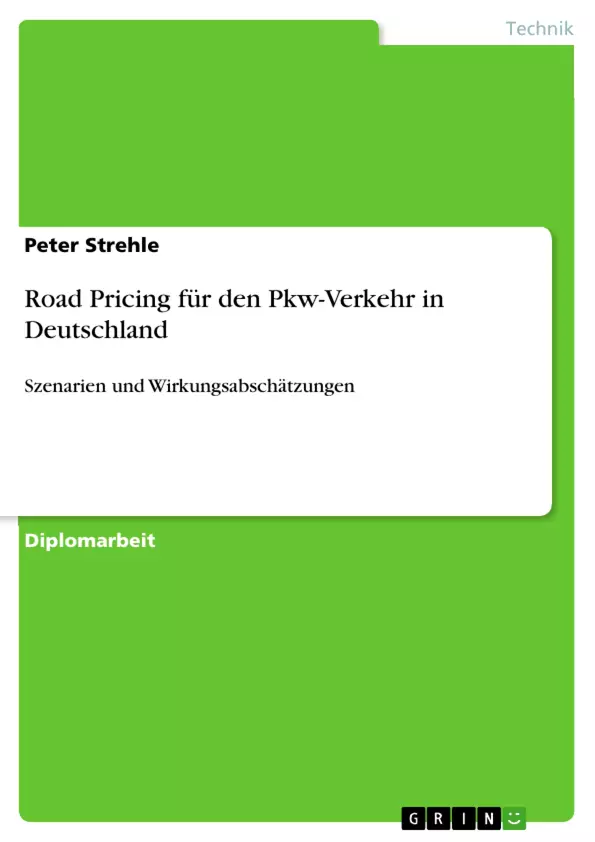Nachdem im Jahr 2005 die Autobahnmaut für Lastkraftwagen (Lkw) in Deutschland
eingeführt wurde, werden in den letzten Jahren auch immer mehr Stimmen laut, die
eine Einführung von Straßenbenutzungsgebühren (Road Pricing) auf Autobahnen
ebenfalls für Personenkraftwagen (Pkw) fordern. Mindestens genauso viele Stimmen, wenn nicht sogar deutlich mehr, sind jedoch gegen die Einführung eines Road Pricing für Pkw. Generell gibt es noch einiges an Diskussionsbedarf zu diesem Thema, was vor allem auch zu einem hohen politischen Interesse führt. Während Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee klar gegen die Einführung einer Maut ist, gibt es mit Wolfgang Reinhart und Günther Beckstein, um nur einige Namen zu nennen, auch Befürworter für Road Pricing im Pkw-Verkehr. In der Bevölkerung gehen die Meinungen zum Thema Pkw-Maut ebenfalls auseinander, wobei die ablehnenden Stimmen überwiegen. Umfragen aus dem Jahr 2005 des Allgemeinen Deutschen Automobil Clubs (ADAC), von Spiegel, Forsa oder des Allensbach-Instituts ergaben Werte für Stimmen, die sich für eine Einführung der Pkw-Maut aussprachen, in Höhe von 20% bis maximal 41% und Werte für Stimmen, welche dagegen waren, im Bereich von 45-73%.
Nicht nur bedingt durch die Osterweiterung der Europäischen Union (EU) und der
Stellung Deutschlands als Transitland im Verkehr, sondern vor allem auch durch die Zunahme des Pkw-Bestandes und der Anzahl an Neuzulassungen steigt die Verkehrsnachfrage im motorisierten Individualverkehr (MIV) in den letzten Jahren stetig an. Ebenfalls nimmt der relative Anteil an Fahrten im MIV verglichen mit den Fahrleistungen im Schienenverkehr zu. In einer Studie des Instituts für Mobilitätsforschung Dr. Hell wurde eine Steigerung der Fahrleistung im Personenverkehr um 20% im Zeitraum vom Jahr 2000 bis 2020 prognostiziert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Konzeptionelle Grundlagen
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition von Mobility Pricing
- 2.2 Definition von Road Pricing
- 2.2.1 Ziele, Zweck und Sinn von Road Pricing
- 2.2.2 Die verschiedenen Arten des Road Pricing
- 2.2.2.1 Objektbezogene Straßenbenutzungsgebühren
- 2.2.2.2 Fahrleistungsbezogene Straßenbenutzungsgebühren
- 2.2.2.3 Flächenbezogene Straßenbenutzungsgebühren
- 2.2.3 Mauterhebungssysteme und verwendete Technologie
- 2.2.4 Akzeptanz in der Bevölkerung
- 2.2.5 Rechtliche Probleme
- 2.2.6 Internationale Beispiele
- 2.2.6.1 Congestion Charge in London
- 2.2.6.2 ASFINAG in Österreich
- 2.2.6.3 Mautringe in Norwegen
- 2.2.6.4 Value Pricing und die Möglichkeit der Anwendung in Deutschland
- 3. Aggregiertes Modell für ein Road Pricing in Deutschland
- 3.1 Modellbeschreibung
- 3.2 Autobahnmaut
- 3.2.1 Fahrleistungsbezogen
- 3.2.2 Vignettenlösung
- 3.3 Gesamt-Flächenmaut
- 3.3.1 Fahrleistungsbezogen (einheitlich)
- 3.3.2 Fahrleistungsbezogen (differenziert nach Straßenklassen)
- 3.4 Kritische Würdigung
- 4. Relationsfeines Modell für ein Road Pricing in Deutschland
- 4.1 Modellbeschreibung
- 4.2 Die Szenarien
- 4.2.1 Ausgangssituation
- 4.2.2 Autobahnmaut
- 4.2.2.1 Auswirkungen auf den Verkehrsfluss (Nachfrageänderung)
- 4.2.2.2 Kosten für den Verkehrsteilnehmer und Erlöse für den Bund
- 4.2.3 Einheitliche Gesamtflächenmaut
- 4.2.3.1 Auswirkungen auf den Verkehrsfluss (Nachfrageänderung)
- 4.2.3.2 Kosten für den Verkehrsteilnehmer und Erlöse für den Bund
- 4.2.4 Gesamtflächenmaut differenziert nach Straßenklassen
- 4.2.4.1 Auswirkungen auf den Verkehrsfluss (Nachfrageänderung)
- 4.2.4.2 Kosten für den Verkehrsteilnehmer und Erlöse für den Bund
- 4.3 Beispielrelationen
- 4.3.1 Stuttgart - München
- 4.3.2 Stuttgart - Ludwigshafen am Rhein
- 4.3.3 Stuttgart - Heilbronn
- 4.3.4 Karlsruhe - Heilbronn
- 4.4 Vergleich der Szenarien und kritische Würdigung
- 5. Wirkungsabschätzungen
- 5.1 Bedeutung für unterschiedliche Personengruppen
- 5.2 Preiselastizität der Nachfrage und Zeitwertkosten
- 5.3 Reaktionsmöglichkeiten der Nachfrager
- 5.4 Mögliche Verwendung der Einnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Implementierung von Road Pricing im deutschen Pkw-Verkehr. Ziel ist die Szenarienanalyse und Wirkungsabschätzung verschiedener Road-Pricing-Modelle. Die Arbeit analysiert sowohl aggregierte als auch relationsfeine Modelle.
- Analyse verschiedener Road-Pricing-Modelle (Autobahnmaut, Flächenmaut)
- Wirkungsabschätzung auf Verkehrsfluss und Nachfrage
- Kosten-Nutzen-Analyse für Verkehrsteilnehmer und den Bund
- Betrachtung rechtlicher und gesellschaftlicher Aspekte
- Vergleich internationaler Beispiele
Zusammenfassung der Kapitel
1. Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit dar, indem es die Problemstellung des Pkw-Verkehrs in Deutschland beschreibt und die Vorgehensweise der Analyse detailliert erläutert. Es skizziert den Ansatz der Arbeit und die Methodik, die zur Bewertung der verschiedenen Road Pricing Szenarien verwendet wird. Dies beinhaltet die Definition des Problems und den Rahmen für die anschließende theoretische und modellbasierte Analyse. Die Problemstellung wird als Ausgangspunkt für die gesamte Arbeit etabliert.
2. Theoretische Grundlagen: Hier werden die zentralen Begriffe "Mobility Pricing" und "Road Pricing" definiert und eingegrenzt. Es folgt eine detaillierte Erörterung verschiedener Road-Pricing-Arten, ihrer Ziele und ihrer technischen Umsetzung. Der Fokus liegt auf der Analyse von objektbezogenen, fahrleistungsbezogenen und flächenbezogenen Gebühren. Weiterhin werden die Akzeptanz in der Bevölkerung, rechtliche Herausforderungen und internationale Beispiele wie die Congestion Charge in London, das ASFINAG-System in Österreich und Mautringe in Norwegen diskutiert, um ein umfassendes Verständnis für die Komplexität des Themas zu schaffen. Die Kapitel liefern das theoretische Fundament für die folgenden Modellanalysen.
3. Aggregiertes Modell für ein Road Pricing in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt ein aggregiertes Modell zur Abschätzung der Auswirkungen verschiedener Road-Pricing-Szenarien in Deutschland. Es präsentiert detaillierte Beschreibungen von Autobahnmaut (fahrleistungsbezogen und Vignettenlösung) und Gesamtflächenmaut (einheitlich und differenziert nach Straßenklassen). Die Modellbeschreibung selbst enthält die wichtigsten Annahmen und Parameter, welche die Grundlage für die folgenden Analysen und Berechnungen bilden. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Würdigung der Modellannahmen und -grenzen.
4. Relationsfeines Modell für ein Road Pricing in Deutschland: Im Gegensatz zum aggregierten Modell des vorherigen Kapitels, wird hier ein relationsfeines Modell vorgestellt. Dieses ermöglicht eine detailliertere Analyse der Auswirkungen von Road Pricing auf spezifische Verkehrsrelationen. Es werden verschiedene Szenarien (Ausgangssituation, Autobahnmaut, einheitliche und differenzierte Flächenmaut) simuliert und die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss sowie die Kosten für die Verkehrsteilnehmer und Einnahmen für den Bund analysiert. Beispielrelationen wie Stuttgart-München, Stuttgart-Ludwigshafen etc. dienen als Fallstudien zur Illustration der Ergebnisse. Das Kapitel endet mit einem Vergleich der verschiedenen Szenarien und einer kritischen Würdigung des relationsfeinen Modells.
5. Wirkungsabschätzungen: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Modellanalysen im Detail ausgewertet und die Bedeutung der Ergebnisse für unterschiedliche Personengruppen beleuchtet. Die Preiselastizität der Nachfrage und die Zeitwertkosten werden analysiert, um ein vollständiges Bild der Auswirkungen auf den Verkehrsmarkt zu liefern. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion der möglichen Verwendung der durch Road Pricing erzielten Einnahmen und den Implikationen verschiedener Verwendungsszenarien.
Schlüsselwörter
Road Pricing, Mobility Pricing, Autobahnmaut, Flächenmaut, Verkehrsfluss, Nachfrage, Kosten-Nutzen-Analyse, Wirkungsabschätzung, Szenarienanalyse, Deutschland, Verkehrsmodellierung, Preiselastizität, Akzeptanz, Rechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Implementierung von Road Pricing im deutschen Pkw-Verkehr
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Implementierung von Road Pricing im deutschen Pkw-Verkehr. Sie analysiert verschiedene Road-Pricing-Modelle, um deren Auswirkungen auf den Verkehrsfluss, die Nachfrage und die Kosten-Nutzen-Verhältnisse für Verkehrsteilnehmer und den Bund abzuschätzen.
Welche Road-Pricing-Modelle werden untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl aggregierte als auch relationsfeine Modelle. Zu den untersuchten Modellen gehören die Autobahnmaut (fahrleistungsbezogen und Vignettenlösung) und die Gesamtflächenmaut (einheitlich und differenziert nach Straßenklassen).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Konzeptionelle Grundlagen, Theoretische Grundlagen, Aggregiertes Modell, Relationsfeines Modell und Wirkungsabschätzungen. Kapitel 1 legt die Problemstellung und Vorgehensweise dar. Kapitel 2 definiert zentrale Begriffe und analysiert internationale Beispiele. Kapitel 3 und 4 präsentieren und analysieren aggregierte bzw. relationsfeine Modelle. Kapitel 5 wertet die Ergebnisse aus und diskutiert deren Bedeutung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet sowohl eine deskriptive Analyse bestehender Literatur und internationaler Beispiele als auch eine modellbasierte Analyse. Es werden aggregierte und relationsfeine Modelle entwickelt und simuliert, um die Auswirkungen von Road Pricing zu prognostizieren.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Modellsimulationen für verschiedene Road-Pricing-Szenarien. Dies beinhaltet die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss, die Nachfrage, die Kosten für Verkehrsteilnehmer und die Einnahmen des Bundes. Die Ergebnisse werden für unterschiedliche Personengruppen und Verkehrsrelationen ausgewertet.
Welche Aspekte werden neben den Modellanalysen betrachtet?
Neben den quantitativen Modellanalysen werden auch qualitative Aspekte wie die Akzeptanz in der Bevölkerung, rechtliche Herausforderungen und die mögliche Verwendung der Einnahmen aus Road Pricing diskutiert.
Welche internationalen Beispiele werden untersucht?
Die Arbeit untersucht internationale Beispiele wie die Congestion Charge in London, das ASFINAG-System in Österreich und Mautringe in Norwegen, um die Erfahrungen anderer Länder mit Road Pricing zu beleuchten und einen Vergleich zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Road Pricing, Mobility Pricing, Autobahnmaut, Flächenmaut, Verkehrsfluss, Nachfrage, Kosten-Nutzen-Analyse, Wirkungsabschätzung, Szenarienanalyse, Deutschland, Verkehrsmodellierung, Preiselastizität, Akzeptanz, Rechtliche Aspekte.
- Citar trabajo
- Peter Strehle (Autor), 2008, Road Pricing für den Pkw-Verkehr in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118288