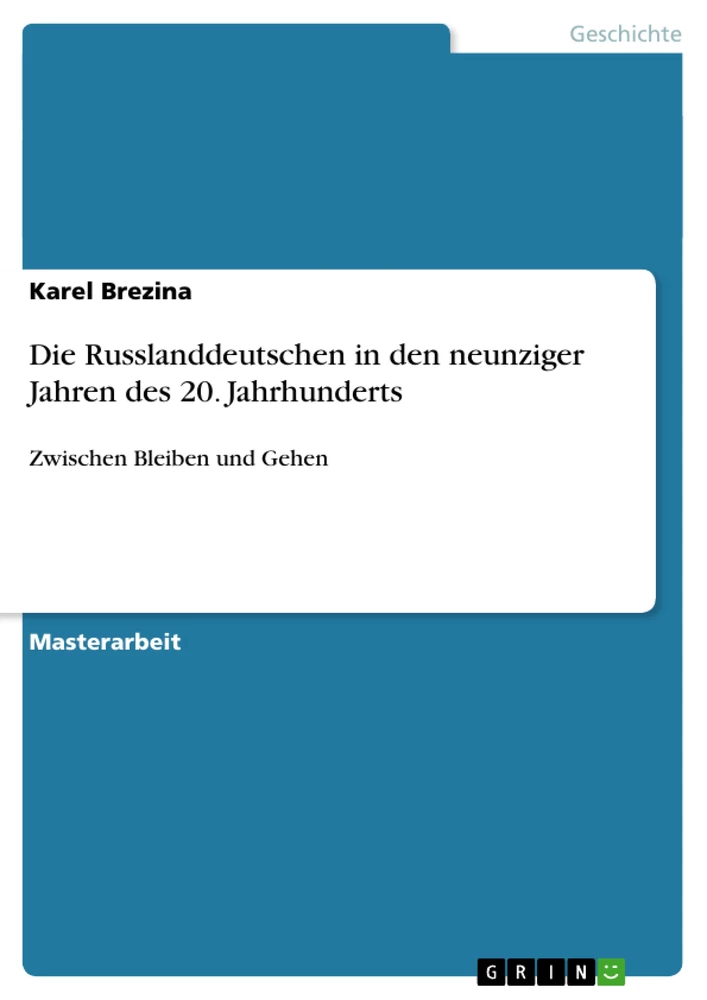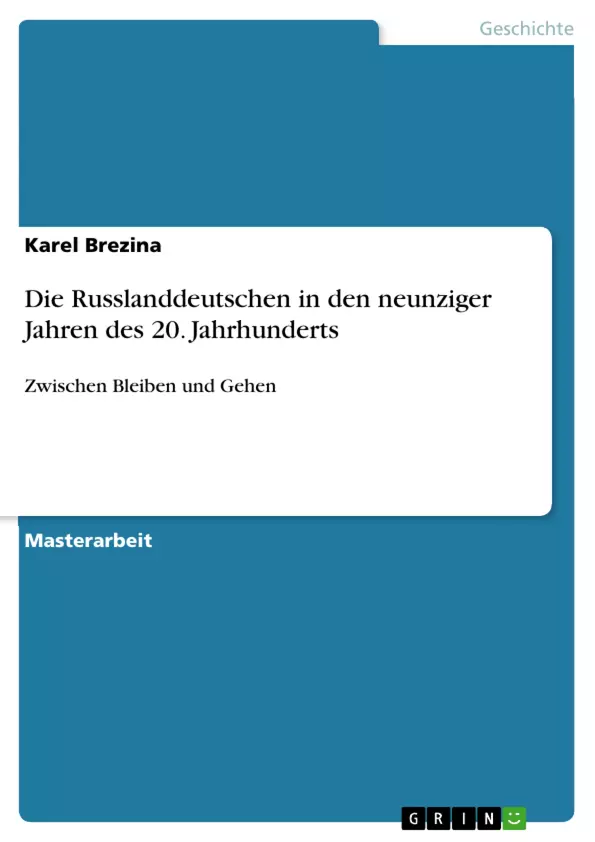Russlanddeutschen rund 1,2 Milliarden DM ausgegeben. Dies entspricht dem durchschnittlichen jährlichen Betrag in der Höhe von 80 Millionen DM. Inwieweit diese Investitionen ihr Ziel erreicht haben ist fraglich. Obwohl die deutsche Regierung den Erfolg dieser Politik mit den sinkenden Einreisezahlen beweist, sind die meiner Meinung nach eher auf die Verschärfung der Einreisebedingungen zurückzuführen.
Der gesetzliche Rahmen für die Aussiedleraufnahme wurde mehrmals verändert. Die wichtigsten Änderungen der Gesetzgebung (Kriegsfolgengesetz) sind mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der großen Migrationswellen verbunden. Seit 1990 müssen alle Aussiedler ihre Anträge von ihrem Herkunftsland die Anträge stellen, seit Januar 1993 musste jeder Antragsteller der nicht aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion kommt glaubhaft machen, dass er auch nach dem 31.12.1992 unter den Benachteiligungen des Kriegsfolgenschicksals leidet. Diese Regelung hatte zufolge, dass seit dieser Zeit die meisten Spätaussiedler die Russlanddeutschen waren. Darüber hinaus wurde auch die höchste jährliche Zuzugsquote auf 225.000 Spätaussiedler festgeschrieben. Weitere Die immer schlechtere Beherrschung der deutschen Sprache und die daraus resultierten Integrationsprobleme waren die wichtigsten Gründe für die Einführung der Sprachtest im Jahre 1996. Jeder Auswanderungswillige Spätaussiedler musste diesen Sprachtest erfolgreich ablegen, sonst konnte er nicht ausreisen. Dies führte zum Rückgang der Aufnahmebescheide, was auch im Jahre in der neuen Aufnahmequote von 100.000 Spätaussiedlern bestätigt wurde. Letztendlich wurde dieser Sprachtest Anfang dieses Jahres (2005) auch für die übrigen Familienangehörigen (heute 80% aller Einreisenden), die im Rahmen des Aufnahmeverfahrens mit dem Spätaussiedler ausreisen wollen, vorgeschrieben.
Weil viele Aussiedler in der Zeit des Kalten Krieges ganz ohne Mittel nach Deutschland kamen, gab es da für die ein relativ breites Netz von spezifischen Hilfen und Leistungen, die ihnen ihre Eingliederung vereinfachen sollten. Mit den steigenden Zahlen wurden diese Hilfen gekürzt und bis heute wurde bis auf einige Ausnahmen abgeschafft.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung.
- 1. Begriffsbestimmung
- 2. Zur Geschichte der Russlanddeutschen
- 3. Autonomiediskussion und Autonomiebewegung
- 3.1. Die deutschen Rayons in Westsibirien
- 3.1.1. Der deutsche nationale Rayon Halbstadt.
- 3.1.2. Der deutsche nationale Rayon Asowo..
- 3.2. Weitere Autonomievarianten...
- 3.2.1. Gebiet um Kaliningrad (Königsberg)
- 3.2.2. Ukraine...
- 3.2.3. Kirgisische Republik..
- 3.2.4. Das Gebiet um St. Petersburg.
- 3.1. Die deutschen Rayons in Westsibirien
- 4. Förderung der Russlanddeutschen in den Herkunftsländern
- 4.1. Erste Phase. Schwerpunkt wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Hilfe
- 4.1.1. Förderungsschwerpunkte.....
- 4.2. Zweite Phase. Schwerpunkt Breitenarbeit.
- 4.1. Erste Phase. Schwerpunkt wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Hilfe
- 5. Situation der deutschen Minderheit in den GUS-Staaten
- 5.1. Republik Kasachstan...
- 5.2. Kirgisische Republik.
- 5.3. Republik Tadschikistan.
- 5.4. Ukraine
- 6. Die russlanddeutsche Kultur
- 6.1. Bildung...
- 6.2. Deutsche Sprache und die Sprachkompetenz.
- 6.3. Religion.......
- 6.4. Russlanddeutsche Presse...
- 6.5. Die Politische und gesellschaftliche Stellung der Russlanddeutschen .
- 7. Motive und Hintergründe der Ausreise………………………………………….
- 8. Juristischer Rahmen
- 8.1. Das Aufnahmeverfahren.
- 8.2. Aussiedlerspezifische Hilfen und Leistungen..
- 9. Die Auswanderung der Deutschen aus Russland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Geschichte, das Leben und die Auswanderungsmotive der Russlanddeutschen zu beleuchten. Sie untersucht, warum diese Gruppe nach Deutschland auswanderte und welche Zukunft für die verbliebene deutsche Minderheit in den ehemaligen Sowjetrepubliken besteht.
- Die Geschichte der Russlanddeutschen
- Die Autonomiebewegung und die verschiedenen Autonomievarianten
- Die Situation der deutschen Minderheit in den GUS-Staaten
- Die russlanddeutsche Kultur und ihre Entwicklung
- Die Motive und Hintergründe der Auswanderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den historischen Kontext der Russlanddeutschen in Mittel- und Osteuropa beschreibt. Kapitel 1 definiert den Begriff "Russlanddeutscher" und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Gruppe. Kapitel 2 behandelt die Geschichte der Russlanddeutschen, beginnend mit ihrer Ansiedlung in Russland bis hin zur Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Kapitel 3 befasst sich mit der Autonomiebewegung und den verschiedenen Autonomievarianten, die von den Russlanddeutschen angestrebt wurden. Kapitel 4 analysiert die Förderung der Russlanddeutschen in ihren Herkunftsländern, sowohl in der ersten Phase mit wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Hilfe als auch in der zweiten Phase mit dem Schwerpunkt auf Breitenarbeit. Kapitel 5 untersucht die Situation der deutschen Minderheit in verschiedenen GUS-Staaten, darunter Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und die Ukraine. Kapitel 6 beleuchtet die russlanddeutsche Kultur, einschließlich Bildung, Sprache, Religion und Presse. Kapitel 7 analysiert die Motive und Hintergründe der Auswanderung der Russlanddeutschen. Kapitel 8 beschreibt den juristischen Rahmen für die Auswanderung und die damit verbundenen Hilfen und Leistungen. Schließlich behandelt Kapitel 9 die Auswanderung der Deutschen aus Russland im Detail.
Schlüsselwörter
Russlanddeutsche, deutsche Minderheit, Autonomiebewegung, GUS-Staaten, russlanddeutsche Kultur, Auswanderung, Aussiedler, Geschichte, Politik, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Russlanddeutschen?
Als Russlanddeutsche werden Angehörige der deutschen Minderheit in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion bezeichnet, die oft als Spätaussiedler nach Deutschland kommen.
Warum wurde 1996 ein Sprachtest für Aussiedler eingeführt?
Der Test wurde eingeführt, um Integrationsproblemen vorzubeugen, da die Deutschkenntnisse der Zuwanderer zunehmend schlechter wurden.
Was war das Ziel der Autonomiebewegung der Russlanddeutschen?
Die Bewegung erstrebte die Wiedererlangung oder Neugründung autonomer deutscher Gebiete (Rayons) innerhalb Russlands, wie etwa Halbstadt oder Asowo.
Wie hoch war die jährliche Zuzugsquote für Spätaussiedler?
In den 1990er Jahren wurde die Quote zunächst auf 225.000 Personen festgeschrieben und später auf 100.000 reduziert.
Welche Rolle spielt die Religion für die russlanddeutsche Kultur?
Die Religion ist ein zentraler Pfeiler der Identität und half der Minderheit über Generationen hinweg, ihre kulturellen Wurzeln in der Sowjetunion zu bewahren.
- Quote paper
- Karel Brezina (Author), 2006, Die Russlanddeutschen in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118357