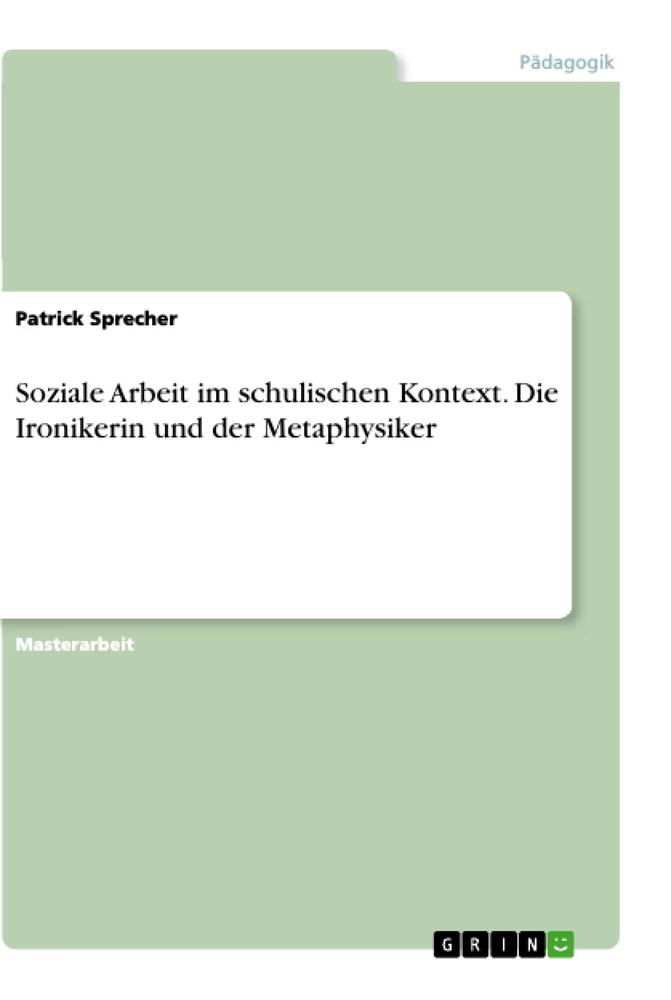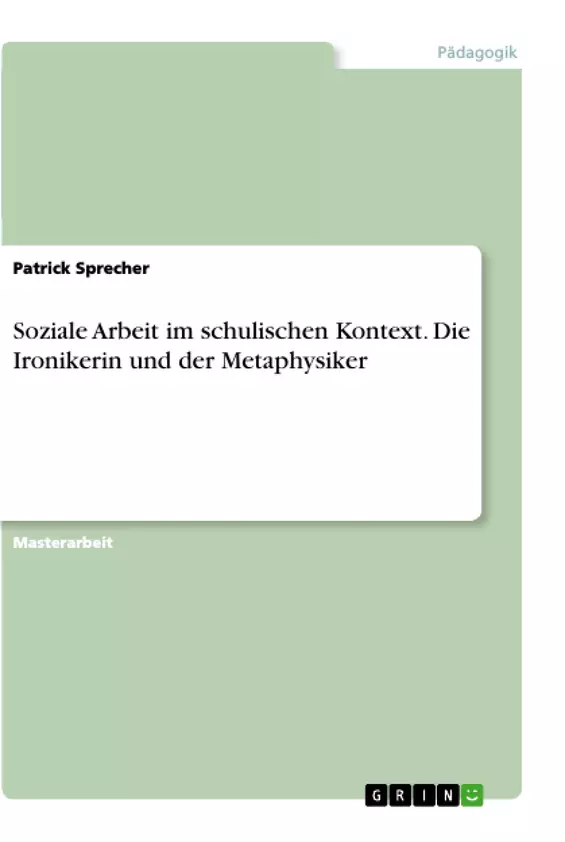In dieser Arbeit wird das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Schule am Gebrauch der Sprache festgemacht, so dass sich mit der Theorie des Diskurses von Jürgen Habermas ein Fundament gelegen lässt, durch welches die Möglichkeit einer Verständigung sowie Einigung im zwischenmenschlichen Austausch nachvollziehbar wird. Die damit einhergehenden Bedingungen – die Transzendentalität und die Transzendenz – werden zum Anlass genommen, um diesem Modell mit Skepsis und Kritik zu begegnen: Für das Phänomen „Soziale Arbeit im schulischen Kontext“ lässt sich erstens mit dem Konzept „Sprachspiel“ von Ludwig Wittgenstein auf die damit einhergehenden Differenzen aufmerksam machen, welche beachtenswert werden, wenn verschiedene Disziplinen sowie Professionen aufeinandertreffen.
Dass sich diesbezüglich Schule und Soziale Arbeit durch eigene Deutungs- und Wertungsmuster auszeichnen, welche mit einer jeweils anderen Rationalität oder Kultur verbunden sind, lässt sich zweitens mit den Figuren „Ironikerin“ sowie „Metaphysiker“ nach Richard Rorty überzeichnen. Damit wird nachvollziehbar, weshalb im Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Schule eine Möglichkeit für Inkommensurabilität besteht: Die Lebensform und das Weltkonzept sind so verschieden, dass eine mit Gründen geführte Diskussion an Grenzen stößt.
Für die Soziale Arbeit im schulischen Kontext lässt sich drittens mit dem Konzept „Widerstreit“ von Jean-François Lyotard auf die sich daraus ergebenden Kontroversen aufmerksam machen, welche sich als eine weder zur Verständigung noch zur Einigung führbare Form von Konflikten darstellen – dessen sich die Beteiligten aber kaum bewusst sind. Ausgehend davon wird in dieser Arbeit zu einem sensiblen sowie reflexiven Gebrauch der Sprache angemahnt, was ermöglicht, sowohl die im Diskurs der Schulsozialarbeit geltenden Normen zu bezweifeln als auch das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Schule alternativ auszulegen – diesbezüglich wird im Fazit ein Versuch unternommen sowie ein Angebot vorgestellt: Statt im zwischenmenschlichen Austausch eine vermeintliche Gewissheit anzustreben und zu versuchen, das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Schule zu klären oder zu entscheiden, soll eine Machbarkeit sowie eine Verantwortlichkeit angestrebt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog: Über diese Arbeit
- Zusammenfassung
- Sachliche Anmerkung
- Persönliche Anmerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und Schule im Kontext der Schulsozialarbeit. Sie zielt darauf ab, das Verhältnis zwischen beiden Disziplinen durch die Linse der Sprache zu betrachten und traditionelle Denkweisen über Kommunikation und Verständigung zu hinterfragen.
- Der Einfluss von Sprache und Kommunikation auf die Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und Schule
- Die Analyse von Verständigungsprozessen im schulischen Kontext unter Anwendung philosophischer Konzepte
- Die kritische Betrachtung von Konsens und Dissens in der Kommunikation zwischen Sozialarbeitenden und Lehrkräften
- Die Bedeutung von Gerechtigkeitsaspekten in der Schulsozialarbeit
- Die Rolle von Sprachspielen und unterschiedlichen Lebenswelten im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Prolog: Über diese Arbeit: Dieser Prolog führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung der Schulsozialarbeit im wissenschaftlichen Diskurs. Er betont die Notwendigkeit, bestehende Normen zu hinterfragen und das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Schule neu zu interpretieren.
- Zusammenfassung: Die Zusammenfassung stellt die zentrale These der Arbeit vor, die sich auf die Bedeutung der Sprache in der Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und Schule konzentriert. Sie erläutert die Verwendung philosophischer Konzepte zur Analyse der Kommunikation und der damit verbundenen Herausforderungen. Die Arbeit argumentiert, dass ein kritisches Bewusstsein für Konflikte und Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und Schule erforderlich ist, um Gerechtigkeit und Inklusion zu fördern.
- Sachliche Anmerkung: In diesem Abschnitt wird die Bedeutung des Dissenses in der Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und Schule hervorgehoben. Die Autorin argumentiert, dass die Konsensorientierung in der Kommunikation zu einer Vernachlässigung von Konflikten und Unstimmigkeiten führen kann. Sie plädiert dafür, den Dissens auszuhalten und ein Verständnis für Abweichendes und Störendes zu entwickeln, um das Wesen der Schulsozialarbeit gerecht zu werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Schulsozialarbeit, Sprache, Kommunikation, Verständigung, Dissens, Lebenswelten, Philosophie, Jürgen Habermas, Ludwig Wittgenstein, Richard Rorty, Jean-François Lyotard, Gerechtigkeit, Inklusion.
- Quote paper
- Patrick Sprecher (Author), 2020, Soziale Arbeit im schulischen Kontext. Die Ironikerin und der Metaphysiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1183724