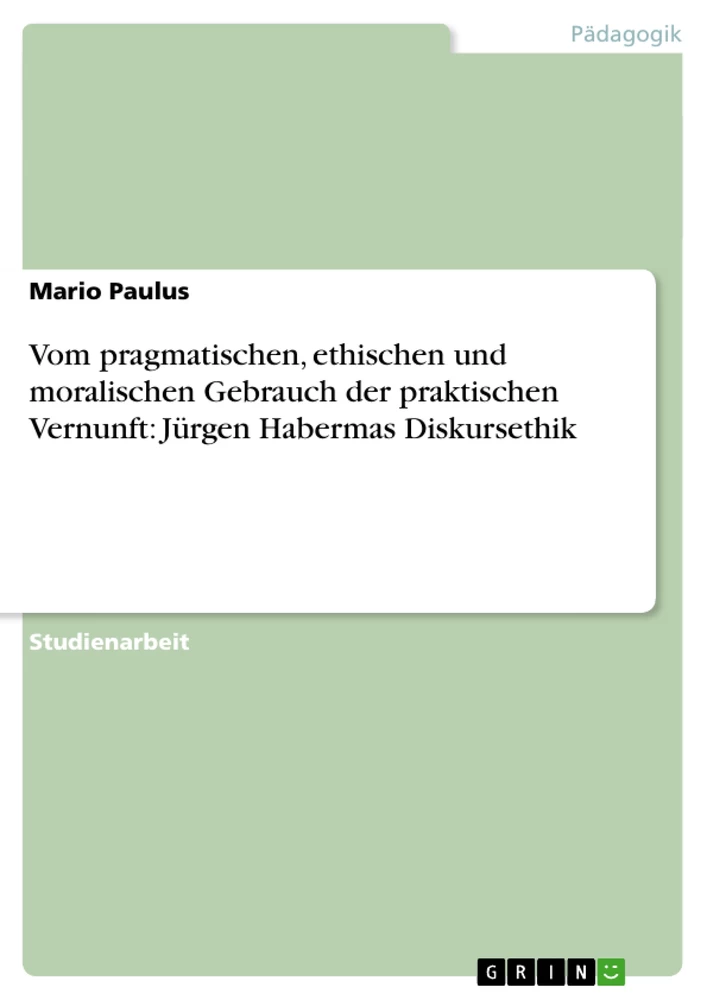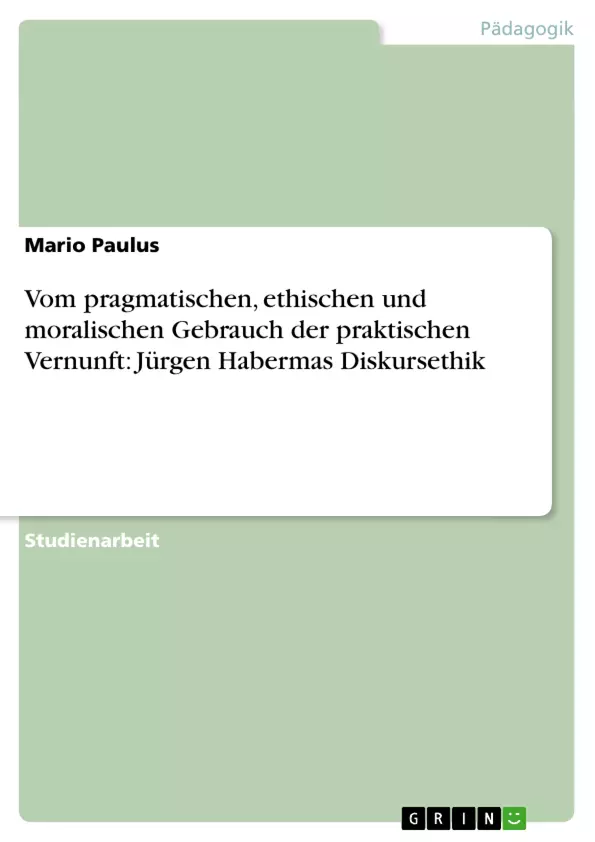In der heutigen Gesellschaft ist weithin das Gefühl verbreitet, es habe ein Werteverlust stattgefunden, der zu einer Orientierungslosigkeit geführt habe, was Fragen der Moral angehe.1 Anders formuliert: Es besteht in der Bevölkerung häufig Unklarheit darüber, worin in bestimmten Situationen eine „moralisch richtige“ Handlung bestehe, d.h. nach welchen Maßstäben man zu verfahren habe.
In der Philosophie gibt es unterschiedliche Konzepte, die auf diese Fragen, die nicht erst im 20. Jahrhundert gestellt worden sind, sondern seit jeher die Menschen beschäftigt haben, eine Antwort zu geben versuchen. Kant beispielsweise liefert als „Handlungsanweisung“ den Kategorischen Imperativ („handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte“2), Nietzsche hingegen geht davon aus, daß „eine K r i t i k der moralischen Werthe nöthig“ sei und daß „d e r W e r t h d i e s e r W e r t h e [...] s e l b s t e r s t e i n m a l i n F r a g e z u s t e l l e n“ sei.3
Diese beiden Auffassungen sind einander diametral entgegengesetzt. Geht der Aufklärer Kant davon aus, daß es möglich sei, moralische Normen mit universeller Verbindlichkeit aufzustellen, indem man sich der (praktischen) Vernunft bediene, läuft Nietzsches Nihilismus letztlich darauf hinaus, daß es keine moralische Normen gebe, denen allgemeine Gültigkeit zugewiesen werden könnte.
Dieser Gegensatz ist durch eine Debatte zu Beginn der achtziger Jahre in das Bewußtsein breiter Schichten der Bevölkerung Westeuropas geraten. Es stellt sich nämlich in der Tat die Frage, ob es einen Konsens geben kann über allgemein gültige Wahrheiten oder ob eine solche Übereinstimmung nicht unangemessen ist vor dem Hintergrund der Pluralität und Komplexität der heutigen Gesellschaft. Befürworter eines solchen Konsenses sehen sich als Vertreter der Moderne und akzentuieren ihre Verbundenheit mit der Tradition der Aufklärung, während von einem der Gegner – dem Franzosen Jean-François Lyotard – der Begriff der „Postmoderne“ aus der Architektur in die Philosophie übertragen worden ist.
Es ist nicht schwer zu erkennen, worin der Bezug zum Thema „Moral und Werte“ besteht. Denn wer davon ausgeht, daß es nicht die allgemein gültige Wahrheit gibt, der muß konsequenterweise auch ausschließen, daß es ein für alle verbindliches Moralprinzip geben könne. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textimmanente Betrachtungen
- 3. Jürgen Habermas' Diskursethik
- 4. Habermas' Diskursethik im Kontext von Moderne und Postmoderne
- 4.1 Habermas Diskursethik und die Moderne
- 4.2 Habermas Diskursethik und die Postmoderne
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jürgen Habermas' Diskursethik, insbesondere im Kontext der Debatte zwischen Moderne und Postmoderne. Ziel ist es, die zentralen Merkmale der Diskursethik herauszuarbeiten und deren Einordnung in den modernen und postmodernen Diskurs zu beleuchten. Die Analyse basiert auf einer detaillierten textorientierten Betrachtung einer ausgewählten Abhandlung Habermas'.
- Habermas' Diskursethik als Antwort auf den Werteverlust in der Gesellschaft
- Der Vergleich der Diskursethik mit Kants kategorischem Imperativ
- Die Kontroverse zwischen Moderne und Postmoderne im Kontext der Diskursethik
- Die Rolle der intersubjektiven Kommunikation in Habermas' Philosophie
- Kritische Hinterfragung zentraler Aspekte der Diskursethik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den gesellschaftlichen Kontext der Arbeit dar: den verbreiteten Werteverlust und die damit verbundene Orientierungslosigkeit in moralischen Fragen. Sie führt in die philosophische Debatte um moralische Normen ein, kontrastiert die Positionen Kants und Nietzsches und situiert Habermas' Diskursethik innerhalb dieser Debatte als Versuch, einen Konsens über allgemein gültige moralische Prinzipien durch Kommunikation zu erreichen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die Vorgehensweise der Analyse von Habermas' Werk „Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft“.
2. Textimmanente Betrachtungen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte, abschnittsweise Analyse von Habermas' ausgewählter Abhandlung. Es präsentiert und hinterfragt die zentralen Thesen, um die Kernmerkmale seiner Diskursethik herauszuarbeiten. Die Analyse konzentriert sich auf die Schlüsselfaktoren und Argumentationslinien des Textes, um ein umfassendes Verständnis der Argumentation Habermas' zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Identifizierung der Hauptargumente und ihrer Begründungen innerhalb des Textes selbst.
3. Jürgen Habermas' Diskursethik: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der textimmanenten Analyse zusammen und präsentiert ein umfassendes Bild von Habermas' Diskursethik. Es synthetisiert die zentralen Merkmale der Theorie, wie sie in Kapitel 2 detailliert untersucht wurden, und stellt sie als kohärentes Ganzes dar. Dieser Abschnitt bietet eine prägnante und systematische Darstellung der Diskursethik, die die wichtigsten Elemente und deren Zusammenhänge hervorhebt. Die Ergebnisse dieses Kapitels bilden die Grundlage für die weitere Diskussion in Kapitel 4.
4. Habermas' Diskursethik im Kontext von Moderne und Postmoderne: Dieses Kapitel verortet Habermas' Diskursethik im Spannungsfeld von Moderne und Postmoderne. Es untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Ethik Kants und zeigt auf, wie die Diskursethik sich von postmodernen Positionen abgrenzt. Die Analyse vergleicht und kontrastiert die zentralen Prinzipien der Diskursethik mit den grundlegenden Annahmen der Moderne und Postmoderne, um die Position von Habermas im philosophischen Diskurs zu verdeutlichen und seine Einordnung in die breite philosophische Debatte zu beleuchten. Es werden die Implikationen dieser Einordnung für Habermas' Diskursethik diskutiert.
Schlüsselwörter
Diskursethik, Jürgen Habermas, Moderne, Postmoderne, Intersubjektive Kommunikation, Moral, Werte, Konsens, Kants Kategorischer Imperativ, Praktische Vernunft, Wertverlust, Orientierungslosigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Jürgen Habermas' Diskursethik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Jürgen Habermas' Diskursethik, insbesondere im Kontext der Debatte zwischen Moderne und Postmoderne. Sie untersucht die zentralen Merkmale der Diskursethik und deren Einordnung in den modernen und postmodernen Diskurs anhand einer detaillierten textorientierten Betrachtung einer ausgewählten Abhandlung Habermas'.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die zentralen Merkmale von Habermas' Diskursethik herauszuarbeiten und deren Einordnung in den modernen und postmodernen Diskurs zu beleuchten. Sie untersucht Habermas' Diskursethik als Antwort auf den Werteverlust in der Gesellschaft und vergleicht sie mit Kants kategorischem Imperativ. Die Rolle der intersubjektiven Kommunikation und kritische Hinterfragung zentraler Aspekte der Diskursethik werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den gesellschaftlichen Kontext und die philosophische Debatte vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Textimmanente Betrachtungen) analysiert detailliert die ausgewählte Abhandlung Habermas'. Kapitel 3 (Jürgen Habermas' Diskursethik) fasst die Ergebnisse der textimmanenten Analyse zusammen. Kapitel 4 (Habermas' Diskursethik im Kontext von Moderne und Postmoderne) verortet die Diskursethik im Spannungsfeld von Moderne und Postmoderne. Kapitel 5 (Zusammenfassung) bietet eine Gesamtübersicht. Kapitel 6 (Literaturverzeichnis) listet die verwendeten Quellen auf.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Diskursethik, Jürgen Habermas, Moderne, Postmoderne, Intersubjektive Kommunikation, Moral, Werte, Konsens, Kants Kategorischer Imperativ, Praktische Vernunft, Wertverlust, Orientierungslosigkeit.
Wie wird Habermas' Diskursethik in dieser Arbeit untersucht?
Die Analyse basiert auf einer detaillierten textorientierten Betrachtung einer ausgewählten Abhandlung Habermas'. Die Arbeit untersucht die zentralen Thesen, Schlüsselfaktoren und Argumentationslinien des Textes, um ein umfassendes Verständnis der Argumentation Habermas' zu ermöglichen. Die Ergebnisse der textimmanenten Analyse werden dann synthetisiert und im Kontext der Debatte zwischen Moderne und Postmoderne eingeordnet.
Welchen Vergleich zieht die Arbeit?
Die Arbeit vergleicht Habermas' Diskursethik mit Kants kategorischem Imperativ und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Ethik Kants. Sie zeigt auf, wie sich die Diskursethik von postmodernen Positionen abgrenzt und vergleicht die zentralen Prinzipien der Diskursethik mit den grundlegenden Annahmen der Moderne und Postmoderne.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht, insbesondere für Personen, die sich mit der Philosophie Jürgen Habermas', der Diskursethik, der Moderne und Postmoderne auseinandersetzen. Sie eignet sich für Studierende und Wissenschaftler im Bereich Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft.
- Quote paper
- M.A. Mario Paulus (Author), 2002, Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft: Jürgen Habermas Diskursethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11845