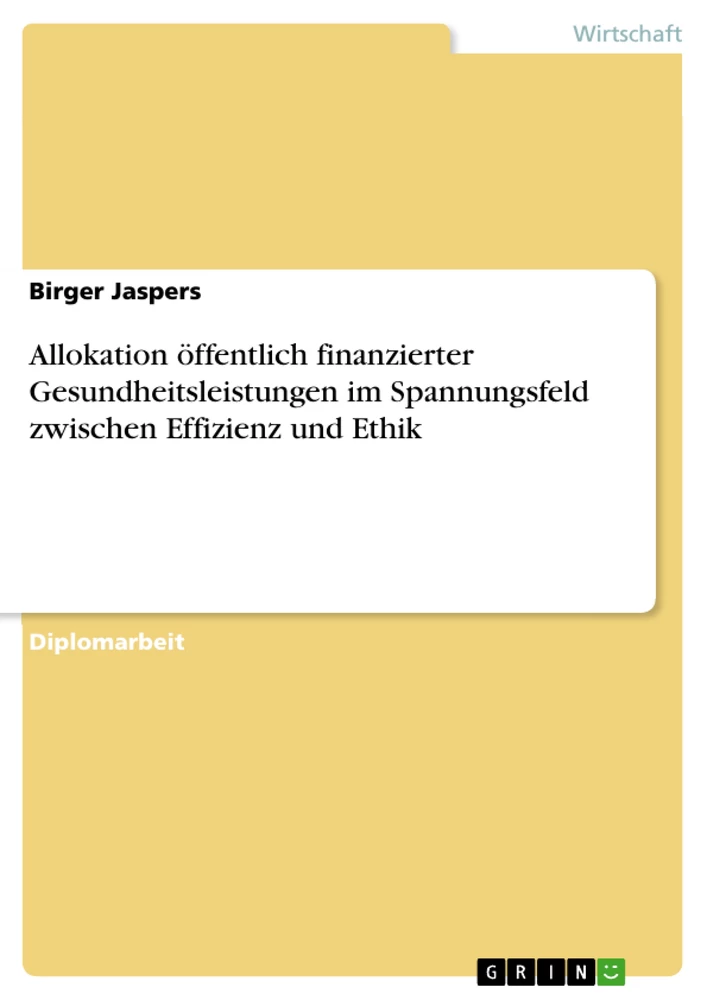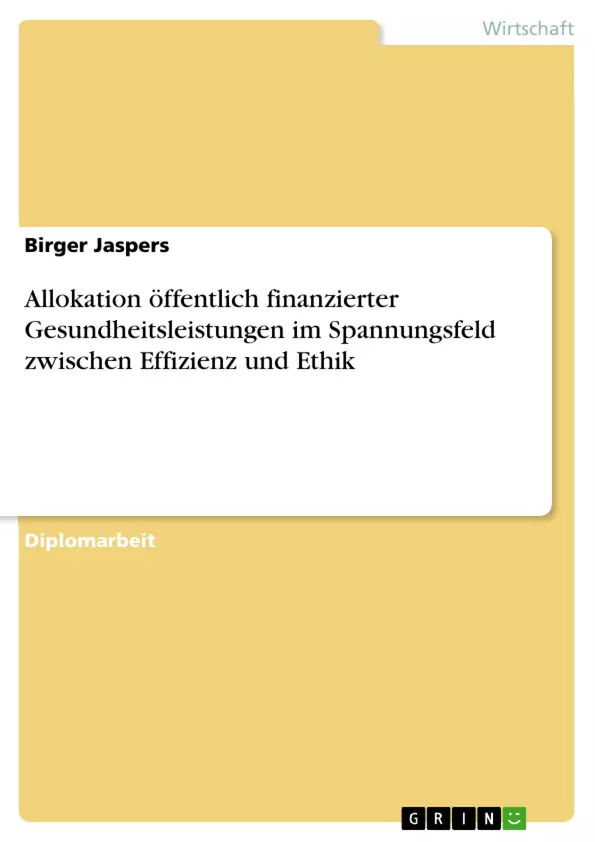Deutschland galt lange Zeit als „gesundheitsökonomisches Entwicklungsland“ [Greiner, W. / von der Schulenburg, J.-M. (2007), S. 7]. Sowohl durch den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) als auch durch die Gründung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)im Rahmen des Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetzes 2003 sind jedoch mittlerweile die institutionellen Grundlagen für „die Bewertung von Verhältnissen zwischen Nutzen und Kosten im System der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung“ [IQWiG (2008)] geschaffen worden.
Folglich sollen auf der einen Seite gesundheitspolitische Entscheidungen über die Verwendung der öffentlich finanzierten Mittel für die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen für die Bevölkerung nach dem Kriterium der Effizienz erfolgen. Auf der anderen Seite wurden aber sowohl durch den Gesetzgeber, als auch durch die Bundesärztekammer Ethik-Kommissionen eingesetzt, um nicht nur bioethische Fragen zu erörtern, sondern auch die Ressourcenverwendung im Gesundheitswesen unter dem Aspekt der Gerechtigkeit zu untersuchen. Zudem finanziert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) aktuell in zwei Förderphasen wissenschaftliche Projekte unter dem Titel „Gerechtigkeit in der modernen Medizin: Leistungsansprüche und Kostenerwägungen als Probleme gerechter Allokation öffentlicher Mittel im Gesundheitswesen“ [BMBF-Nachwuchsgruppe (2006)]. Die Forscher haben sich zum Ziel gesetzt, durch ihre Arbeit „zu einem besseren Verständnis der ethischen Grundlagen unseres Gesundheitswesens zu gelangen, nicht zuletzt um dem öffentlich-politischen Diskurs sowie Entscheidungsträgern in diesem Bereich eine wissenschaftliche Grundlage anzubieten“ [Rauprich, O. (2006)].
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und Aufbau der Arbeit
- Allokation begrenzter Gesundheitsressourcen
- Ökonomie: Wirtschaftliche Bereitstellung von Gesundheitsgütern
- Begründung gesundheitsökonomischer Evaluation
- Grundkonzepte gesundheitsökonomischer Evaluation
- Kosten-Nutzwert-Analyse und das QALY-Konzept
- Evidenz-basierte Medizin
- Ethik: Theorien für eine gerechte Ressourcenverteilung
- Liberalismus
- Egalitarismus
- Utilitarismus
- Kommunitarismus
- Recht: Gesetzlicher Rahmen für Allokationsentscheidungen
- Ökonomie: Wirtschaftliche Bereitstellung von Gesundheitsgütern
- Zwischenfazit
- Priorisierung und Rationierung im Gesundheitswesen
- Grundlegende Rahmenkonzepte für ethisch reflektierte Entscheidungen
- Allokationsethik nach Beauchamp und Childress
- Allokationsethik nach Daniels
- Anwendungsorientierte Rahmenkonzepte
- Orientierungsrahmen und Konzepte von Public-Health-Ethikern
- Orientierungsrahmen und Konzepte von Gesundheitsökonomen
- Grundlegende Rahmenkonzepte für ethisch reflektierte Entscheidungen
- Fazit und Ausblick
- Fazit für das Gesundheitswesen in Deutschland
- Ausblick auf die deutsche Public-Health-Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Allokation öffentlich finanzierter Gesundheitsleistungen im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Ethik. Sie analysiert die ökonomischen und ethischen Herausforderungen der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen und untersucht verschiedene theoretische Konzepte und praktische Ansätze für eine gerechte und effiziente Allokation.
- Die ökonomische Perspektive auf die Bereitstellung von Gesundheitsgütern
- Ethische Theorien für eine gerechte Ressourcenverteilung
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Allokationsentscheidungen
- Konzepte für die Priorisierung und Rationierung von Gesundheitsleistungen
- Die Rolle von Public-Health-Ethik und Gesundheitsökonomie in der Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas der Allokation öffentlich finanzierter Gesundheitsleistungen dar und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Begriffsbestimmung und Aufbau der Arbeit: Dieses Kapitel definiert die wichtigsten Begriffe und erläutert die Methodik der Arbeit.
- Allokation begrenzter Gesundheitsressourcen: Dieses Kapitel analysiert die ökonomischen und ethischen Aspekte der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen. Es werden verschiedene Konzepte der gesundheitsökonomischen Evaluation, ethische Theorien für eine gerechte Ressourcenverteilung und der rechtliche Rahmen für Allokationsentscheidungen vorgestellt.
- Zwischenfazit: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der ersten drei Kapitel zusammen.
- Priorisierung und Rationierung im Gesundheitswesen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Konzepten für die Priorisierung und Rationierung von Gesundheitsleistungen. Es werden sowohl theoretische Rahmenkonzepte als auch praktische Ansätze aus der Public-Health-Ethik und Gesundheitsökonomie vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Allokation, Gesundheitsleistungen, Effizienz, Ethik, Ressourcenverteilung, gesundheitsökonomische Evaluation, QALY-Konzept, Evidenz-basierte Medizin, ethische Theorien, Liberalismus, Egalitarismus, Utilitarismus, Kommunitarismus, Recht, Priorisierung, Rationierung, Public-Health-Ethik, Gesundheitsökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der gesundheitsökonomischen Evaluation?
Ziel ist es, das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen von Gesundheitsleistungen zu bewerten, um begrenzte öffentliche Mittel effizient einzusetzen.
Was bedeutet das QALY-Konzept?
QALY steht für "Quality-Adjusted Life Year" (qualitätskorrigiertes Lebensjahr) und dient als Maßstab, um den Nutzen medizinischer Maßnahmen sowohl nach Lebensverlängerung als auch nach Lebensqualität zu messen.
Welche ethischen Theorien spielen bei der Ressourcenverteilung eine Rolle?
Wichtige Theorien sind der Liberalismus, Egalitarismus, Utilitarismus und Kommunitarismus, die jeweils unterschiedliche Ansätze für eine "gerechte" Verteilung bieten.
Was ist der Unterschied zwischen Priorisierung und Rationierung?
Priorisierung legt eine Rangfolge fest, welche Leistungen zuerst finanziert werden; Rationierung bedeutet das Vorenthalten notwendiger Leistungen aufgrund von Ressourcenmangel.
Welche Aufgabe hat das IQWiG in Deutschland?
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen bewertet den Nutzen medizinischer Leistungen als wissenschaftliche Grundlage für Entscheidungen in der gesetzlichen Krankenversicherung.
- Citar trabajo
- Birger Jaspers (Autor), 2008, Allokation öffentlich finanzierter Gesundheitsleistungen im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Ethik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118687