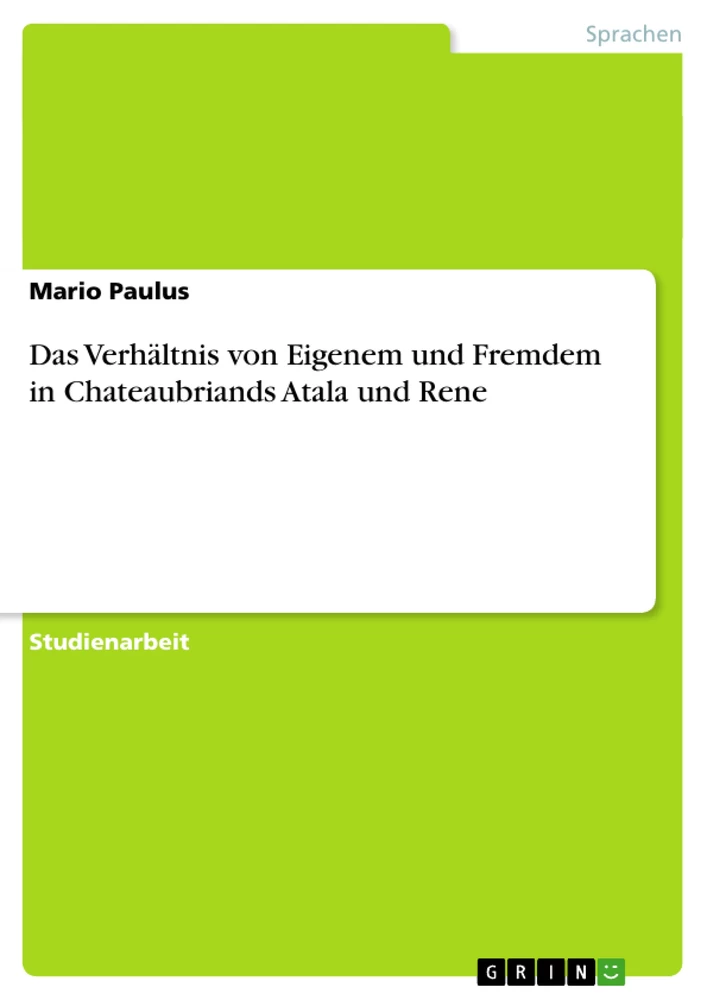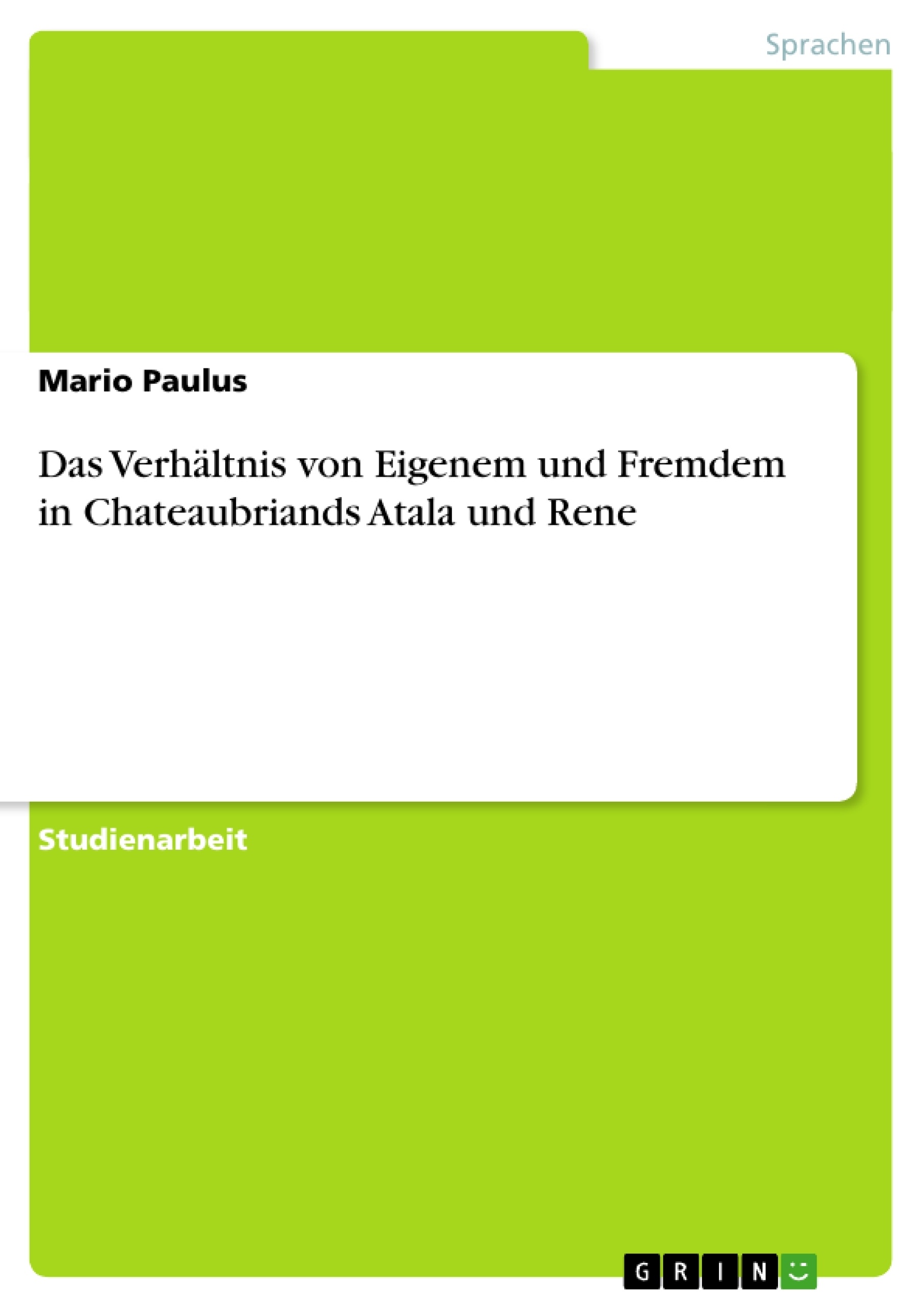Ausgangspunkt des Seminars „Fremdbilder in der französischen Literatur vom 18. bis zum
20. Jahrhundert”, in dessen Kontext die vorliegende Arbeit verfaßt worden ist, war die
Frage, wie wir mit Fremdheit umgehen und wie sich dies in entsprechenden literarischen
Texten niederschlägt. Damit rücken automatisch das Verhältnis von Eigenem und
Fremdem sowie dessen literarische Darstellung in das Zentrum des Interesses; es wird also
die Differenz zwischen Eigenem und Fremdem thematisiert.
Die Differenz–Forschung ist von kapitaler Bedeutung für die modernen
Geisteswissenschaften, wobei es sowohl um kulturelle als auch um sexuelle Differenz
geht. Tradierte Beurteilungsmuster des Eigenen und Fremden werden dabei ebenso einer
kritischen Analyse unterzogen wie die Problematik, daß Identität überhaupt als eine
Konstruktion angesehen werden muß, die unterlaufen werden kann1.
Für die Literaturwissenschaft ist dieser Forschungszweig zudem deshalb von besonderer
Bedeutung, weil hier mehrere moderne Literaturtheorien miteinander kombiniert werden.
So befindet sich die Differenz–Forschung auf einer Linie mit dem Dekonstruktivismus
eines Jacques Derrida, der als Vertreter des Poststrukturalismus die Auffassung vertritt,
daß bestimmte Grundprinzipien existieren, die die Basis der bestehenden Ordnung bilden,
die aber nicht etwas Unumstößliches sind, sondern die als „das Ergebnis eines bestimmten
Bedeutungssystems” entlarvt werden können. Denn als Konsequenz kann die These
vertreten werden, daß sich ein Geschlechterverhältnis eingebürgert hat, daß keineswegs als
naturgegeben gelten muß. Damit befindet man sich wiederum zugleich im Umfeld der
Diskursanalyse, die sich mit solchen Problemen befaßt.
Auch die Psychoanalytische Literaturtheorie spielt für die Differenz–Forschung insofern
eine Rolle, als bestimmte unbewußte Denkstrukturen des (männlichen) Individuums als
latent vorhanden dekonstruiert werden können.
In der vorliegenden Arbeit ist dementsprechend versucht worden, die erwähnten literaturtheoretischen
Ansätze zu nutzen, um eine möglichst vielschichtige und schlüssige
Interpretation der zu untersuchenden Texte leisten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chateaubriands Ungenügen an der Gegenwart
- 2.1 Die Zeit um 1800 als Epoche des Umbruchs
- 2.2 Chateaubriands Zivilisationskritik
- 3. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in „Atala“ und „,René“
- 3.1 Formprobleme
- 3.2 Figurenkonstellation
- 4. Die amerikanische Wildnis als das Fremde in der Ferne
- 4.1 Natur und Naturempfinden in „Atala“ und „René“
- 4.2 Die Wildnis als zu kolonisierender Raum
- 5. Die Frau als das Fremde in der Nähe
- 5.1 Atala und Amélie als heldenhafte Figuren
- 5.2 Bestätigung des patriarchalen Diskurses
- 6. Zusammenfassung
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Chateaubriands Erzählwerke „Atala“ und „René“ im Kontext der Zeit um 1800, einer Epoche des Umbruchs. Die zentrale Fragestellung ist, wie Chateaubriand mit dem Verhältnis von Eigenem und Fremdem umgeht und wie dieses in den beiden Werken literarisch dargestellt wird. Dabei werden verschiedene literaturtheoretische Ansätze herangezogen, insbesondere die Differenz-Forschung, der Dekonstruktivismus und die Psychoanalytische Literaturtheorie.
- Die Zeit um 1800 als Epoche des Umbruchs und Chateaubriands Zivilisationskritik.
- Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in „Atala“ und „René“.
- Die amerikanische Wildnis als das Fremde in der Ferne und die Rolle der Natur in den Erzählungen.
- Die Frau als das Fremde in der Nähe und die Konstruktion der Geschlechterverhältnisse in den Texten.
- Die Funktion des Fremden in den Werken Chateaubriands.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Differenz-Forschung für die Literaturwissenschaft und die Problematik von Identität beleuchtet. Die Einleitung stellt den Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit dar.
Kapitel 2 untersucht Chateaubriands Kritik an der Gegenwart im Kontext der Zeit um 1800. Es zeigt, wie Chateaubriands Blick in die Ferne nach Nordamerika als Ausdruck eines weit verbreiteten Ungenügens an der bestehenden Gesellschaft zu verstehen ist.
Kapitel 3 behandelt das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in den Erzählwerken „Atala“ und „René“. Es wird gezeigt, wie Chateaubriand die Problematik von Eigenem und Fremdem in Bezug auf die Interaktion zwischen Individuum und Gesellschaft thematisiert.
Kapitel 4 untersucht die amerikanische Wildnis als das Fremde in der Ferne und die Rolle der Natur in den Erzählungen. Es werden die unterschiedlichen Naturempfindungen der Figuren in „Atala“ und „René“ beleuchtet und die Bedeutung der Wildnis als zu kolonisierender Raum diskutiert.
Kapitel 5 betrachtet die Frau als das Fremde in der Nähe und die Konstruktion der Geschlechterverhältnisse in den Texten. Es analysiert die Figuren Atala und Amélie als heldenhafte Frauen und beleuchtet die Bestätigung des patriarchalen Diskurses in den Erzählungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Eigenen und Fremden, der Zivilisationskritik, dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, der Natur und der Wildnis, sowie mit den Geschlechterrollen und dem patriarchalen Diskurs in den Erzählungen Chateaubriands.
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert Chateaubriand in "Atala" und "René"?
Er thematisiert das Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden, Zivilisationskritik und das Ungenügen des Individuums an der Gesellschaft um 1800.
Was symbolisiert die amerikanische Wildnis in diesen Werken?
Die Wildnis steht für das "Fremde in der Ferne", einen Raum der Sehnsucht, aber auch einen zu kolonisierenden Raum, der im Kontrast zur europäischen Zivilisation steht.
Wie wird die Frau in Chateaubriands Texten dargestellt?
Frauen wie Atala und Amélie werden als heldenhafte, aber oft leidende Figuren gezeichnet, die das "Fremde in der Nähe" und den patriarchalen Diskurs verkörpern.
Welche Rolle spielt die Psychoanalytische Literaturtheorie in der Analyse?
Sie hilft dabei, unbewusste Denkstrukturen der meist männlichen Protagonisten und deren Identitätskonstruktionen zu dekonstruieren.
Warum ist die Zeit um 1800 als Epoche des Umbruchs wichtig?
Nach der Französischen Revolution herrschte eine tiefe Verunsicherung, die Chateaubriand durch die Flucht in exotische Welten und die Thematisierung von Entfremdung verarbeitete.
- Quote paper
- M.A. Mario Paulus (Author), 2001, Das Verhältnis von Eigenem und Fremdem in Chateaubriands Atala und Rene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11870