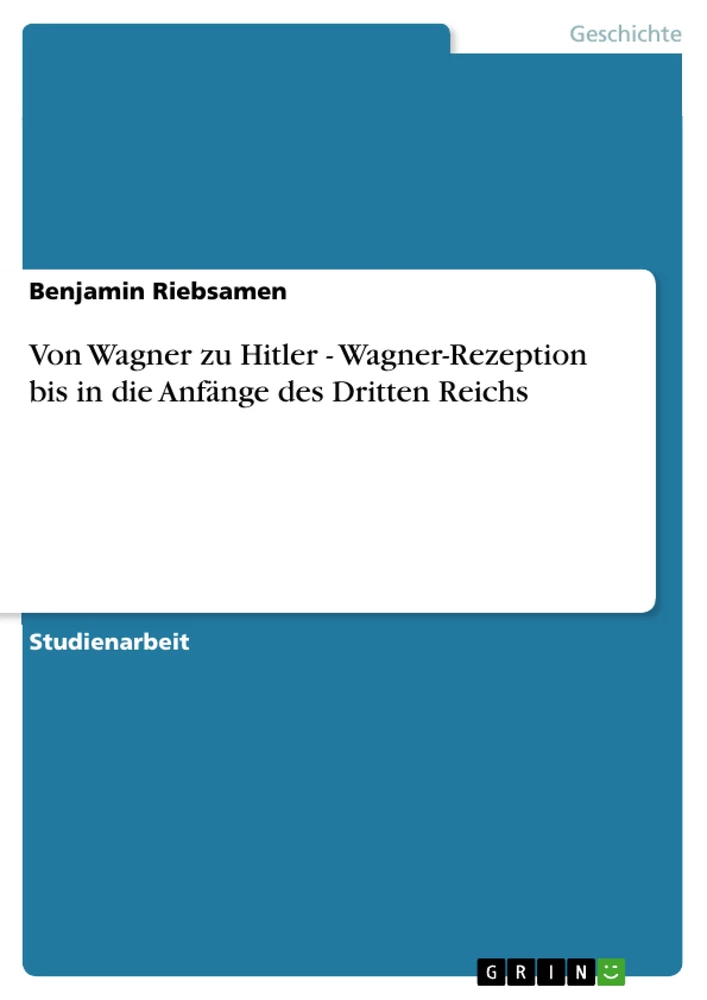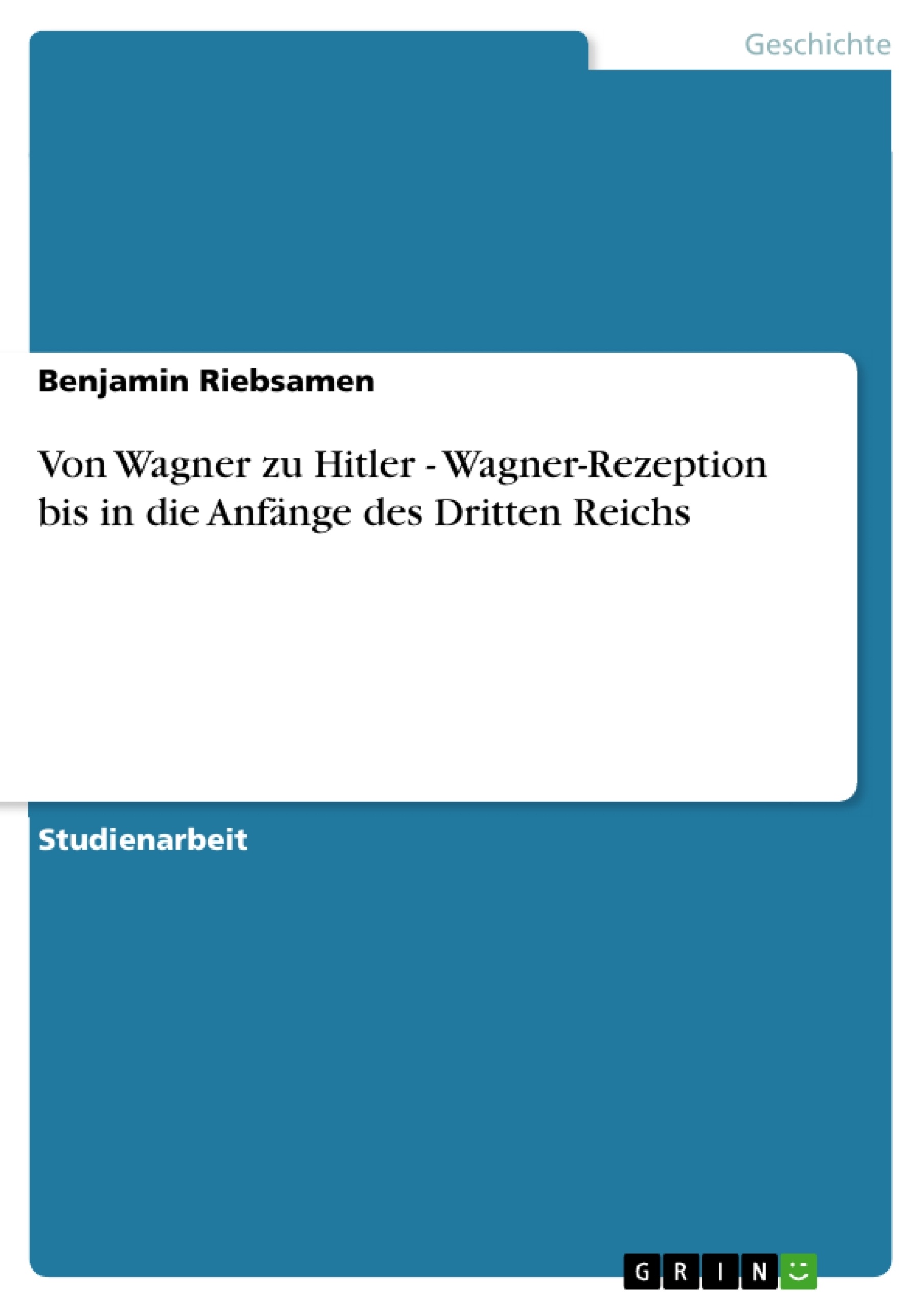Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Rezeption der Wagnerschen Werke und seiner theoretischen Schriften. Es soll herausgearbeitet werden, wie die so genannten Wagnerianer vor allem nach dem Tod Wagners systematisch seine „Lehren“ verbreitet, gedeutet und teilweise auch versucht haben, sie umzusetzen. Dabei soll untersucht werden, welche Gesellschaftsschicht zu diesen Kreisen zählte und welche medialen Mittel von ihnen genutzt wurden, um ihre Gedanken zu verbreiten. Richtungspunkt der Arbeit wird sein, den Weg von Wagner zu Hitler nachzuvollziehen, zu ergründen, wie die Wagnerianer vor Hitler diesen Weg vorbereiteten, inwieweit Wagner Hitler als Vorbild gedient haben könnte und welche Parallelitäten und Gemeinsamkeiten hervorstechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbedingungen
- 2.1 Der deutsche Kulturpessimismus
- 2.2 Die Entstehung des Wagnerismus
- 3. Nach dem Tode des „Meisters“.
- 3.1 Der Bayreuther Kreis und die Fortspinnung des deutschen Gedankens
- 3.2 Die Bayreuther Blätter - Propaganda im Geiste Richard Wagners
- 4. Schlussbetrachtungen.
- 4.1 Wagner - Hitlers Mentor?
- 4.2 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Richard Wagners Werken und Schriften nach seinem Tod. Im Fokus steht die systematische Verbreitung seiner „Lehren“ durch die Wagnerianer, deren soziale Zusammensetzung und die von ihnen genutzten Medien. Ziel ist es, den Weg von Wagner zu Hitler nachzuvollziehen, die Vorarbeit der Wagnerianer zu analysieren und Parallelen zwischen Wagner und Hitler herauszuarbeiten.
- Die Verbreitung von Wagners Ideen nach seinem Tod.
- Die Rolle des Bayreuther Kreises und der Bayreuther Blätter.
- Der Einfluss des deutschen Kulturpessimismus auf die Wagner-Rezeption.
- Die Entstehung und Definition des Wagnerismus.
- Parallelen zwischen Wagners Weltanschauung und der Ideologie Hitlers.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die polarisierende Figur Richard Wagners vor und hebt die unterschiedlichen Perspektiven auf sein Werk hervor – von unkritischer Verehrung bis hin zu Verachtung. Sie umreißt den Forschungsgegenstand: die Rezeption Wagnerscher Werke und Schriften nach seinem Tod, mit dem Schwerpunkt auf der systematischen Verbreitung seiner Ideen durch die Wagnerianer und deren Zusammenhang mit dem Aufstieg Hitlers. Die Arbeit will den Weg von Wagner zu Hitler nachzeichnen und Gemeinsamkeiten beider Figuren untersuchen.
2. Vorbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen für die Rezeption Wagners. Der Abschnitt 2.1 beschreibt den deutschen Kulturpessimismus Ende des 19. Jahrhunderts, der durch die rasche Modernisierung und die damit einhergehende Angst vor dem Verlust traditioneller Werte geprägt war. Dieser Pessimismus führte zur Suche nach einem Sündenbock, der im Judentum gefunden wurde. Wagner wird als prominenter Vertreter dieses Kulturpessimismus dargestellt, der seine antisemitischen Ansichten offen kundtat. Abschnitt 2.2 behandelt die Entstehung des Begriffs „Wagnerismus“, der die Rezeption von Wagners nicht-musikalischen Werken beschreibt und die oft nicht auf fundierter Fachkenntnis basierende, aber dennoch stark verbreitete Begeisterung für Wagner umfasst.
Häufig gestellte Fragen zu: Rezeption von Richard Wagners Werk nach seinem Tod
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Richard Wagners Werken und Schriften nach seinem Tod. Der Fokus liegt auf der systematischen Verbreitung seiner „Lehren“ durch die Wagnerianer, deren sozialer Zusammensetzung und den von ihnen genutzten Medien. Ziel ist es, den Weg von Wagner zu Hitler nachzuvollziehen, die Vorarbeit der Wagnerianer zu analysieren und Parallelen zwischen Wagner und Hitler herauszuarbeiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verbreitung von Wagners Ideen nach seinem Tod, die Rolle des Bayreuther Kreises und der Bayreuther Blätter, den Einfluss des deutschen Kulturpessimismus auf die Wagner-Rezeption, die Entstehung und Definition des Wagnerismus sowie Parallelen zwischen Wagners Weltanschauung und der Ideologie Hitlers.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu den Vorbedingungen (deutscher Kulturpessimismus und Entstehung des Wagnerismus), einem Kapitel über die Zeit nach Wagners Tod (Bayreuther Kreis und Bayreuther Blätter) und Schlussbetrachtungen (Wagner als Hitlers Mentor? und ein Resümee).
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt Richard Wagner als polarisierende Figur vor und beschreibt die unterschiedlichen Perspektiven auf sein Werk. Sie umreißt den Forschungsgegenstand: die Rezeption Wagnerscher Werke nach seinem Tod, mit Schwerpunkt auf der Verbreitung seiner Ideen durch die Wagnerianer und deren Zusammenhang mit dem Aufstieg Hitlers. Das Ziel ist die Nachzeichnung des Weges von Wagner zu Hitler und die Untersuchung von Gemeinsamkeiten beider Figuren.
Worum geht es im Kapitel „Vorbedingungen“?
Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen für die Rezeption Wagners. Es beschreibt den deutschen Kulturpessimismus Ende des 19. Jahrhunderts mit seiner Angst vor dem Verlust traditioneller Werte und der Suche nach einem Sündenbock (Judentum). Wagner wird als prominenter Vertreter dieses Pessimismus dargestellt. Weiterhin behandelt es die Entstehung des „Wagnerismus“ und die oft unfundierte, aber weit verbreitete Begeisterung für Wagner.
Was wird im Kapitel über die Zeit nach Wagners Tod behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Bayreuther Kreises und der Bayreuther Blätter bei der Verbreitung von Wagners Ideen. Es untersucht, wie diese Gruppe Wagners „Lehren“ systematisch verbreitete und welche Propaganda-Instrumente sie nutzte.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussbetrachtungen untersuchen die Frage, ob Wagner als Hitlers Mentor betrachtet werden kann und fassen die Ergebnisse der Arbeit in einem Resümee zusammen. Die Arbeit analysiert die Vorarbeit der Wagnerianer und die Parallelen zwischen Wagner und Hitler.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Richard Wagner, Wagnerismus, Bayreuther Kreis, Bayreuther Blätter, deutscher Kulturpessimismus, Antisemitismus, Hitler, Propaganda.
- Quote paper
- Benjamin Riebsamen (Author), 2006, Von Wagner zu Hitler - Wagner-Rezeption bis in die Anfänge des Dritten Reichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118721