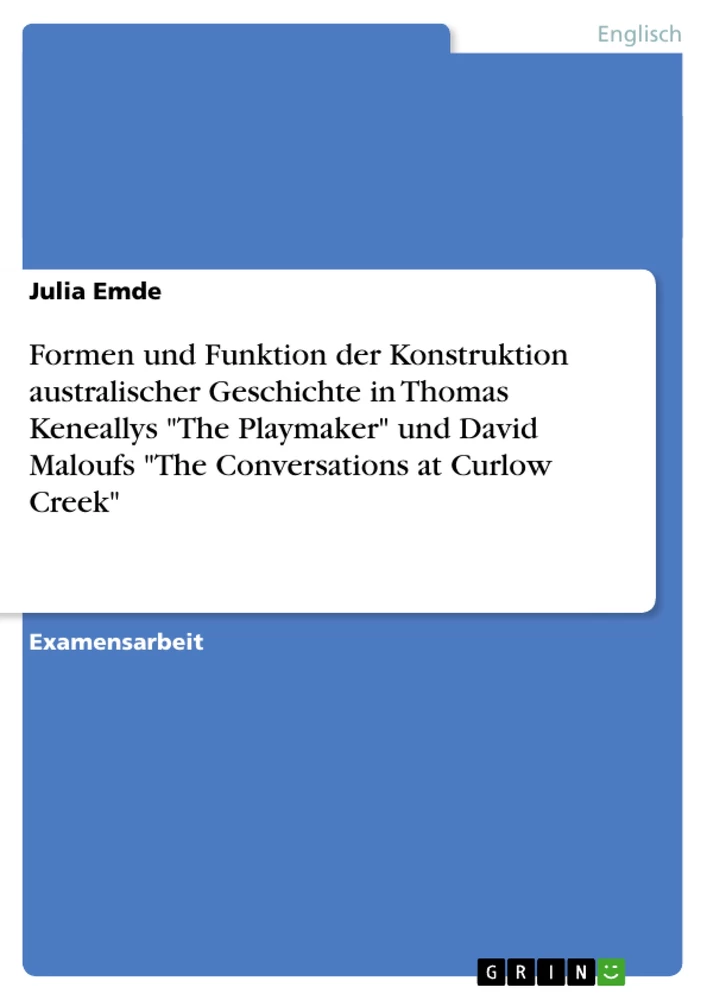[…] Diese Arbeit wird sich mit der Haltlosigkeit essentialistischer Geschichtskonzeptionen beschäftigen, indem zunächst in Kapitel zwei die Idee der Geschichtswissenschaft als objektiver Rekonstruktion der Vergangenheit widerlegt wird. Dabei soll auf die Theorie der Différance von Jacques Derrida eingegangen werden, die zeigt, dass alle Bedeutungen nur im Kontext der Zeichensysteme einer Kultur erzeugt werden, womit auch die teleologische Geschichtsschreibung als kulturelles Konstrukt zu betrachten ist. […] Darauf aufbauend wird das Konzept der Nation problematisiert, und verdeutlicht, inwiefern bestimmte Vorstellungen über das Phänomen der Nation in der Vergangenheit zu Gräueltaten und Diskriminierung geführt haben. […] Danach wird in Kapitel drei der Bogen zur australischen Geschichte geschlagen, und auf Probleme der populären australischen Geschichtsschreibung hingewiesen. Im Besonderen soll dabei auf die Erfahrung des Exils, als Schlüsselerlebnis im australischen Bewusstsein, eingegangen werden. Anschließend wird die frühe Phase der Kolonisierung in New South Wales näher beleuchtet, und veranschaulicht, inwiefern das historische Wissen über diese Zeit durch literarische Werke und Mythen geprägt wurde. […] Vor diesem Hintergrund soll schließlich in Kapitel vier anhand der zwei Romane The Playmaker, von Thomas Keneally, und The Conversations at Curlow Creek, von David Malouf, der literarische Umgang zeitgenössischer Schriftsteller mit dem kolonialen Erbe demonstriert und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Begriffe der Geschichte und Geschichtsschreibung
- 2.1 Im Fokus poststrukturalistischer Theorien
- 2.1.1 Die Différance
- 2.1.2 Diskurs und Macht
- 2.1.3 New Historicism und Cultural Materialism
- 2.2 Im Fokus postmoderner Theorien
- 2.2.1 Das Konzept der Nation
- 2.2.2 Historiographische Metafiktion
- 3. Australiens koloniales Erbe
- 3.1 Problematisierung der Geschichtsdarstellung
- 3.2 Exile
- 3.3 Convicts und Bushrangers
- 4. Entwürfe australischer Geschichte
- 4.1 The Playmaker
- 4.1.1 Fakt und Fiktion
- 4.1.2 Raum und Zeit
- 4.1.3 Theater und Identität
- 4.2 The Conversations at Curlow Creek
- 4.2.1 Erinnerung
- 4.2.2 Reconciliation
- 4.2.3 Legenden und Träume
- 5. Schlussbemerkung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion australischer Geschichte in zwei ausgewählten literarischen Werken: Thomas Keneallys "The Playmaker" und David Maloufs "The Conversations at Curlow Creek". Ziel ist es, die Darstellung der australischen Vergangenheit in diesen Romanen im Kontext poststrukturalistischer und postmoderner Theorien zu analysieren und die damit verbundenen Herausforderungen der nationalen Identitätsbildung zu beleuchten.
- Die Konstruktion nationaler Identität in postkolonialem Kontext
- Die Rolle von Literatur bei der Gestaltung und Vermittlung von Geschichte
- Die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe Australiens
- Der Einfluss von Machtstrukturen und Diskursen auf die Geschichtsschreibung
- Die Bedeutung von Erinnerung und Reconciliation im Prozess der nationalen Selbstfindung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den geringen Bekanntheitsgrad australischer Literatur und Kultur in Deutschland beleuchtet und dies mit dem kolonialen Erbe und der komplexen Geschichte Australiens verbindet. Es wird gezeigt, wie die lange Dominanz britischer Perspektiven zu einem verzerrten Bild von Australien geführt hat und wie Klischees bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die Wahrnehmung prägten. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der australischen Geschichtsschreibung und Identitätsbildung.
2. Die Begriffe der Geschichte und Geschichtsschreibung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es untersucht die Konzepte der Geschichte und Geschichtsschreibung aus poststrukturalistischer und postmoderner Perspektive. Die Différance, Diskurs und Macht sowie der New Historicism und Cultural Materialism werden als wichtige analytische Werkzeuge vorgestellt, ebenso wie das Konzept der Nation und die historiographische Metafiktion. Die Kapitel analysieren, wie diese theoretischen Ansätze die Betrachtung von Geschichte und die Konstruktion nationaler Identitäten beeinflussen.
3. Australiens koloniales Erbe: Dieses Kapitel beleuchtet das koloniale Erbe Australiens und dessen Auswirkungen auf die Geschichtsdarstellung. Es thematisiert die Problematisierung der bestehenden Geschichtsnarrative und analysiert die Erfahrungen von Exilanten, Convicts und Bushrangers. Der Fokus liegt auf der Marginalisierung der indigenen Bevölkerung und der Konstruktion eines "weißen" Australiens durch den Prozess des othering. Es wird aufgezeigt, wie die Übernahme europäischer Geschichtskonzeptionen zu einer verzerrten und unvollständigen Darstellung der australischen Vergangenheit führte.
4. Entwürfe australischer Geschichte: In diesem Kapitel werden die literarischen Werke "The Playmaker" und "The Conversations at Curlow Creek" analysiert. Die jeweiligen Darstellungen der australischen Geschichte werden im Detail untersucht, wobei die Aspekte Fakt und Fiktion, Raum und Zeit, Theater und Identität ("The Playmaker") sowie Erinnerung, Reconciliation und Legenden und Träume ("The Conversations at Curlow Creek") im Mittelpunkt stehen. Der Vergleich der beiden Romane verdeutlicht unterschiedliche Zugänge zur Konstruktion und Interpretation australischer Geschichte.
Schlüsselwörter
Australien, Geschichte, Geschichtsschreibung, Poststrukturalismus, Postmoderne, Kolonialismus, Nationalität, Identität, Erinnerung, Reconciliation, "The Playmaker", "The Conversations at Curlow Creek", Keneally, Malouf, Diskurs, Macht, Aborigines.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse australischer Geschichtskonstruktionen in "The Playmaker" und "The Conversations at Curlow Creek"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Konstruktion australischer Geschichte in den Romanen "The Playmaker" von Thomas Keneally und "The Conversations at Curlow Creek" von David Malouf. Im Fokus steht die Darstellung der australischen Vergangenheit im Kontext poststrukturalistischer und postmoderner Theorien und deren Auswirkungen auf die nationale Identitätsbildung.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf poststrukturalistische und postmoderne Theorien. Konzepte wie die Différance, Diskurs und Macht, New Historicism, Cultural Materialism, die Konstruktion der Nation und historiographische Metafiktion werden als analytische Werkzeuge eingesetzt, um die Darstellung von Geschichte und die Herausforderungen der nationalen Identitätsbildung zu beleuchten.
Welche Aspekte des kolonialen Erbes werden behandelt?
Die Arbeit untersucht das koloniale Erbe Australiens und dessen Einfluss auf die Geschichtsdarstellung. Die Marginalisierung der indigenen Bevölkerung, die Konstruktion eines "weißen" Australiens durch Othering und die Übernahme europäischer Geschichtskonzeptionen werden kritisch beleuchtet. Die Erfahrungen von Exilanten, Convicts und Bushrangers werden ebenfalls thematisiert.
Wie werden "The Playmaker" und "The Conversations at Curlow Creek" analysiert?
Die Romane werden detailliert analysiert, wobei Aspekte wie Fakt und Fiktion, Raum und Zeit, Theater und Identität ("The Playmaker") sowie Erinnerung, Reconciliation und Legenden und Träume ("The Conversations at Curlow Creek") im Mittelpunkt stehen. Der Vergleich der beiden Romane verdeutlicht unterschiedliche Zugänge zur Konstruktion und Interpretation australischer Geschichte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion nationaler Identität in postkolonialem Kontext, die Rolle von Literatur bei der Gestaltung und Vermittlung von Geschichte, die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe Australiens, den Einfluss von Machtstrukturen und Diskursen auf die Geschichtsschreibung und die Bedeutung von Erinnerung und Reconciliation im Prozess der nationalen Selbstfindung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Begriffen der Geschichte und Geschichtsschreibung, ein Kapitel zu Australiens kolonialem Erbe, ein Kapitel zur Analyse der beiden Romane, eine Schlussbemerkung und ein Literaturverzeichnis. Die Kapitel sind detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Australien, Geschichte, Geschichtsschreibung, Poststrukturalismus, Postmoderne, Kolonialismus, Nationalität, Identität, Erinnerung, Reconciliation, "The Playmaker", "The Conversations at Curlow Creek", Keneally, Malouf, Diskurs, Macht, Aborigines.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit australischer Literatur, Geschichte, Postkolonialismus, Poststrukturalismus und Postmoderne beschäftigen. Sie ist für ein akademisches Publikum konzipiert und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Julia Emde (Author), 2008, Formen und Funktion der Konstruktion australischer Geschichte in Thomas Keneallys "The Playmaker" und David Maloufs "The Conversations at Curlow Creek", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118823