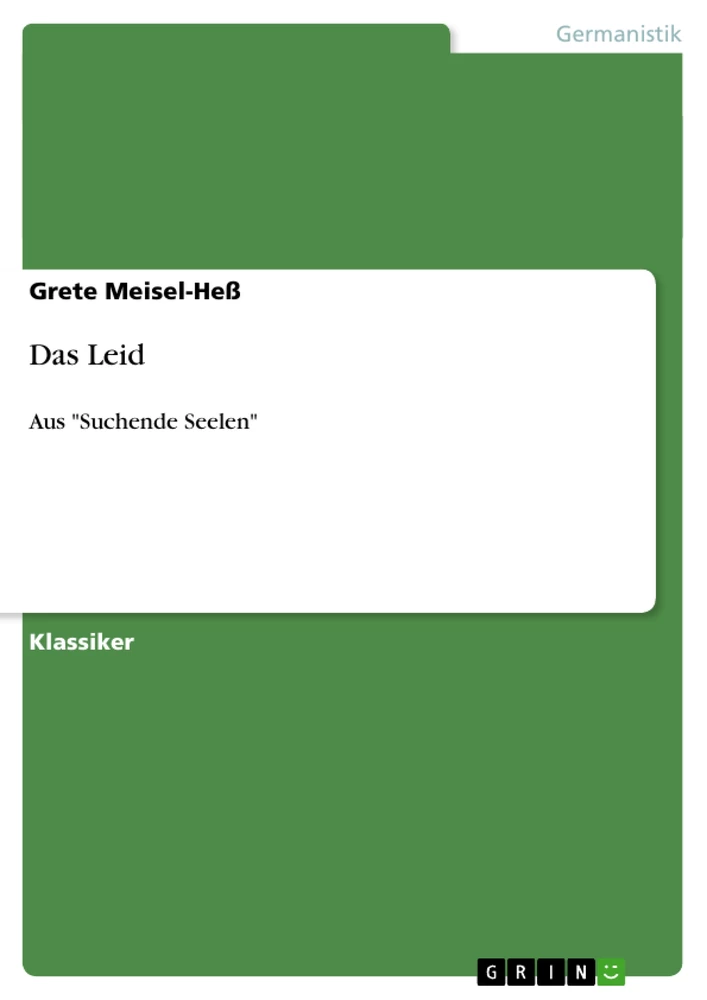Erstmalig erschienen 1903. Auszug: Stefan Feodor Ilitsch machte seiner Geliebten – nein: seiner Braut, die seit fünf Jahren auf ihn wartete – die große Eröffnung.
Sie saßen im Kaffeehaus beim Eckfenster, jedes in die rote Sammetbank hineingedrückt, vor sich die Melange und den Berg Zeitungen, in der bläulich feinen, Behagen ausströmenden Atmosphäre des „gutventilierten“ Wiener Cafés.
Draußen hatte ein lauer Februartag, den die Menschen für Frühling nahmen, eine Menge hinausgelockt, die geschäftig durcheinander schob, den Ring hinauf, von der Wollzeile bis zur Oper, und wieder hinab und wieder hinauf, mit wichtiger, strahlender Miene, wie jemand, der sich beim Empfang einer Majestät einfindet. Die Wiener Frauen strahlten und waren noch schöner als sonst: mit den kurzen Miederchen, die die Büste frei lassen, und den knappen, o so knappen Röcklein, eng, eng, die unten mächtig, weit, wogend, auseinander fluten, schleppend, rauschend, prächtig...
Die Lotti hatte auch solch ein Secessions-Röcklein. Denn sie war aus gutem Wiener Hausherrn-Haus, wo man mit der Mode gehen kann, Gott sei Dank. Aber sie hatte noch etwas anderes: große, dunkle, sehnsüchtige Augen. Und die hatte sonst niemand in der Hausherrn-Familie. Alle hatten sie runde, blitzblaue, wie auf Stäbchen herausgesteckte Augen und den Blick satter, zufriedener Kühe, samt dem dazu gehörigen Doppelkinn. Nur die Lotti war ganz aus der Art geschlagen – leider, leider. Der liebe Gott mochte wissen, wieso. Ganz aus der Art geschlagen. Denn Augen, das weiß man ja, machen’s nicht allein. Aber alles, was zu diesen Augen gehört: das war’s eben „Gelehrte“ Neigungen und wenig Pietät und sehr wenig Worte – zu Hause – und so ein Ausweichen überhaupt, so einen höchst befremdlichen Zug hinaus aus der Familie und lauter „draußige“ Freundschaften, wo einem doch die Verwandtschaft über alles gehen soll.
I.
Stefan Feodor Ilitsch machte seiner Geliebten – nein: seiner Braut, die seit fünf Jahren auf ihn wartete – die große Eröffnung.
Sie saßen im Kaffeehaus beim Eckfenster, jedes in die rote Sammetbank hineingedrückt, vor sich die Melange und den Berg Zeitungen, in der bläulich feinen, Behagen ausströmenden Atmosphäre des „gutventilierten“ Wiener Cafés.
Draußen hatte ein lauer Februartag, den die Menschen für Frühling nahmen, eine Menge hinausgelockt, die geschäftig durcheinander schob, den Ring hinauf, von der Wollzeile bis zur Oper, und wieder hinab und wieder hinauf, mit wichtiger, strahlender Miene, wie jemand, der sich beim Empfang einer Majestät einfindet. Die Wiener Frauen strahlten und waren noch schöner als sonst: mit den kurzen Miederchen, die die Büste frei lassen, und den knappen, o so knappen Röcklein, eng, eng, die unten mächtig, weit, wogend, auseinander fluten, schleppend, rauschend, prächtig...
Die Lotti hatte auch solch ein Secessions-Röcklein. Denn sie war aus gutem Wiener Hausherrn-Haus, wo man mit der Mode gehen kann, Gott sei Dank. Aber sie hatte noch etwas anderes: große, dunkle, sehnsüchtige Augen. Und die hatte sonst niemand in der Hausherrn-Familie. Alle hatten sie runde, blitzblaue, wie auf Stäbchen herausgesteckte Augen und den Blick satter, zufriedener Kühe, samt dem dazu gehörigen Doppelkinn. Nur die Lotti war ganz aus der Art geschlagen – leider, leider. Der liebe Gott mochte wissen, wieso. Ganz aus der Art geschlagen. Denn Augen, das weiß man ja, machen’s nicht allein. Aber alles, was zu diesen Augen gehört: das war’s eben „Gelehrte“ Neigungen und wenig Pietät und sehr wenig Worte – zu Hause – und so ein Ausweichen überhaupt, so einen höchst befremdlichen Zug hinaus aus der Familie und lauter „draußige“ Freundschaften, wo einem doch die Verwandtschaft über alles gehen soll.
Seit sie ihr aber auf das mit dem „Judenbuben“ gekommen waren, da war alles aus. Der Herr Gruber raste und tobte. Ein Judenbub, ein russischer noch dazu, sollte in seine urarische Familie hineinkommen? Er, Hausherr am Alsergrund, Christlich-Sozialer vom reinsten Wasser, Schwiegervater eines – eines –- Er hätte einen Ritualmord begehen können! Und noch dazu so eine Null: ein Student!
Aber es half ihm nichts. Die Lotti blieb fest. Trotzdem er ihr in die Ohren schrie, von den vierzigtausend Gulden, die als Mitgift für sie angelegt waren, bekäme sie nichts, aber schon gar nichts, einen Dr…, wenn sie dabei bleibe. „Ich warte, auf wen ich will und solange ich will,“ war ihre einzige Antwort.
Der Schädel, der verfluchte Schädel, den das Mädel hatte! Überhaupt war sie nie nach seinem Sinn gewesen. Weiß der Teufel!
Die Frau Hausherrin hatte ihm nicht mit gewohntem Temperament sekundiert. Wie sie von dem Juden hörte, war sie ganz bleich fortgeschlichen: „Jesses Marand Joseph, das ist die Straf’! Das ist die Straf’!...“
Seitdem waren fünf Jahre vergangen. Fünf gräßliche Jahre.
Schneller ging’s nicht. Seit einem halben Jahr war er Arzt und auf der Jagd nach Praxis. Er mußte es endlich möglich machen, er mußte Was hatte sie erlitten um ihn Qualen, Pein, Schande –, die Schande der Unfreiheit. Aber er war auch das Leben für sie gewesen. Wie die große Erweckung war er ihr gekommen. Sie: still, scheu, wie eingefrorenes Leben unter dem Eise, er: voll Kraft und Wollen, ein heißer Fön, hatte die Erstarrung gesprengt. Tiefes Staunen erst und dann ein Jubel! Das war das Glück...
Sie hatten gekämpft für ihre gemeinsame Zukunft mit wildem, unüberwindlichem Trotz. Den Verhältnissen die paar Stunden Beisammensein in den fünf Jahren unter tausend Schwierigkeiten abgerungen. Alles war schwer, kompliziert, alle Götter waren gegen sie. Stefan mußte sich durchfristen mit Stunden. Als kleines Kind war er nach Wien geschickt worden zu einer Verwandten, die gestorben war, als er fünfzehn Jahre gewesen. Seitdem brachte er sich allein durch. Seine Eltern, arme russische Juden, hatten kaum Brot und Zwiebeln für sich selbst. Vor zwei Jahren waren sie aus Rußland hinausgejagt worden; da waren sie nach Wien gekommen, hatten sich einen Branntweinschank aufgemacht in Hernals draußen und „ernährten“ sich. Damals hatte Stefan seine Eltern besucht, die ihm wie unsagbar traurige, groteske Gestalten einer verlorenen [12] Welt erschienen. Und er sann über das Wunder der Assimilation, die Blut und Rasse wandelt. Wie aber erst, wenn sie unterstützt wird durch bewußte Wahl: Mischlinge! Was würden er und Lotti für prächtige Kinder haben! Lotti! Mütterchen! Eine heiße Blutwelle durchflutete und erschütterte ihn...
Er arbeitete rastlos; er ließ nicht nach. Nicht mit ungeduldigem Rütteln wollte er das Schicksal zwingen, nein: mit zäher, eiserner Ausdauer. So mußten sie siegen. Natürlich, wenn kein Elementarereignis dazwischen kam. Das Elementarereignis räumten sie ein, devot, untertänig sich beugend, zitternd vor der Scheelsucht der Götter, dem kleinlich neidischen Pöbel, der das große Glück nicht duldet und in stupider Grausamkeit mit Tyrannen-Vollmacht protzt.
Die klingende Freiheit, die wollte er erobern, ja! Immer vorausgesetzt natürlich, daß nicht am Ende...
Wie eine schwarze Wolke schwebte es über ihnen. Lächerlich, daß sie so oft daran dachten; absurd. „Aber weißt du, es ist ein so unheimlicher Gedanke,“ sagte Lotti einmal, „daß alles an das gebunden sein soll, was fortwährend in tausend Gefahren schwebt...“ – - - - - –
Sollte es das sein? Alles war so behaglich da; unmöglich...
Langsam löste sich die Erstarrung:
„Was sagst du, Stefan?“
Und er wiederholte, langsam und deutlich – Er mußte es ihr sagen, er konnte nicht länger schweigen. Seit einem halben Jahr trug er es mit sich herum. Heute war er beim Professor gewesen. Der hatte es bestätigt.
Sie hörte Worte aus einer grauen, fremden, unendlichen Ferne. Etwas tönte, schwang, näherte sich, kroch bis ans Hirn und wollte sich hineinbohren. Es bohrte und bohrte – Draußen ging eine vorbei, die hatte das Kleid so hoch gehoben, daß unter dem schönen Seidenjupon ein gestreiftes Barchentröcklein zum Vorschein kam. Mit geschlungenen Zacken. Das sah spaßig aus –
Gedämpft fielen die Worte, wie stille Wassertropfen –
Sie faßte es nicht. Aber sie hätte schreien mögen, einen langen, wehen, tobenden Schrei. Lebte sie denn? War das wahr? Sie krallte sich unter dem Tisch mit den Nägeln der einen Hand in den Arm, bis sie wirklich einen Laut ausstieß. Und sie sah ihn an. Lippen, Lider, Nasenflügel vibrierten, das Kinn und die Mundlinien zogen scharfe, spitze Ecken. Der Zwicker hielt wie eine Klammer die Nase eingezwängt und zog einen roten Streif: die Augen aber waren fahl –
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Textausschnitt?
Der Textausschnitt beschreibt ein Gespräch zwischen Stefan und seiner Braut Lotti in einem Wiener Kaffeehaus. Stefan eröffnet Lotti etwas Wichtiges, das er seit einem halben Jahr mit sich herumträgt. Der Text beleuchtet ihre Beziehung, die durch gesellschaftliche Hindernisse (seine jüdische Herkunft und Armut, ihr wohlhabender, christlich-sozialer Hintergrund) erschwert wird, und die Opfer, die sie für ihre Liebe gebracht haben. Es wird auch angedeutet, dass Stefan gesundheitliche Probleme hat, die die Zukunft ihrer Beziehung bedrohen könnten.
Was sind die wichtigsten Themen im Text?
Zu den wichtigsten Themen gehören Liebe, Opferbereitschaft, gesellschaftliche Vorurteile (insbesondere Antisemitismus), Armut, Krankheit, und die Schwierigkeiten einer Beziehung, die gegen gesellschaftliche Normen verstößt. Auch die Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende und die Rolle der Frau werden thematisiert.
Wer sind die Hauptfiguren im Text?
Die Hauptfiguren sind Stefan und Lotti. Stefan ist ein armer jüdischer Arzt, der um seine Existenz kämpft und Lotti heiraten möchte. Lotti ist eine Frau aus wohlhabendem Haus, die seit fünf Jahren auf Stefan wartet und gegen den Willen ihrer Familie steht, um ihn heiraten zu können.
Welche Rolle spielt die Familie von Lotti?
Lottis Familie, insbesondere ihr Vater Herr Gruber, ist gegen die Beziehung zu Stefan. Sie sind besorgt über seine jüdische Herkunft und seinen sozialen Status. Der Text deutet an, dass Lottis Mutter eine Art Ahnung oder Schuldgefühl hat, das mit der Beziehung zu Stefan zusammenhängt.
Was bedeutet das Secessions-Röcklein?
Das Secessions-Röcklein ist ein Kleidungsstück, das die Zugehörigkeit Lottis zu einer wohlhabenden und modernen Wiener Gesellschaftsschicht symbolisiert. Es zeigt, dass sie sich modisch kleidet und aus gutem Hause stammt.
Welche Bedeutung hat das Kaffeehaus in der Szene?
Das Kaffeehaus ist ein typischer Wiener Treffpunkt und ein Ort des sozialen Austauschs. In diesem Fall dient es als Kulisse für das wichtige Gespräch zwischen Stefan und Lotti. Die Beschreibung der Atmosphäre im Kaffeehaus trägt zur Stimmung der Szene bei.
Was könnte Stefan Lotti eröffnet haben?
Der Text deutet an, dass Stefan Lotti von seiner Krankheit erzählt. Er hat ein halbes Jahr lang geschwiegen und eine Bestätigung von einem Professor erhalten. Seine Ausgezehrtheit und die Erwähnung eines "Elementarereignisses" legen dies nahe.
Was bedeutet die Bemerkung über die "Assimilation"?
Die Bemerkung über die Assimilation bezieht sich auf Stefans Gedanken über die Möglichkeit, dass Blut und Rasse durch bewusste Wahl verändert werden können. Er träumt von der Vermischung seiner jüdischen Herkunft mit Lottis arischem Hintergrund und hofft, dass ihre Kinder "prächtige Kinder" werden würden. Dies spiegelt die Auseinandersetzung mit Identität und Zugehörigkeit wider.
- Citation du texte
- Grete Meisel-Heß (Auteur), 2008, Das Leid, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118827