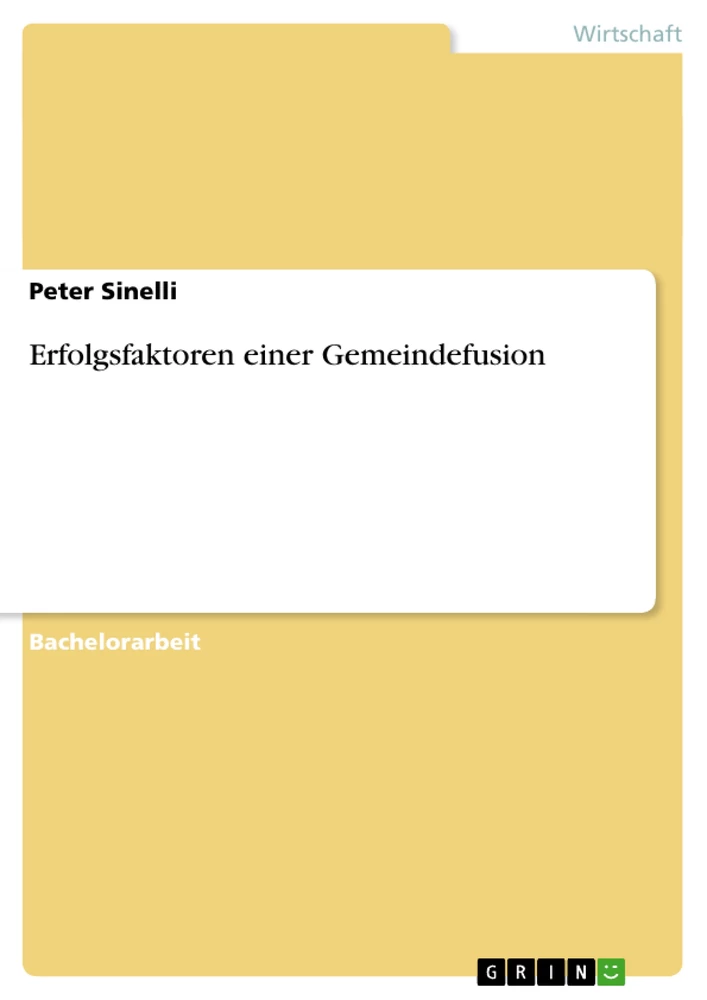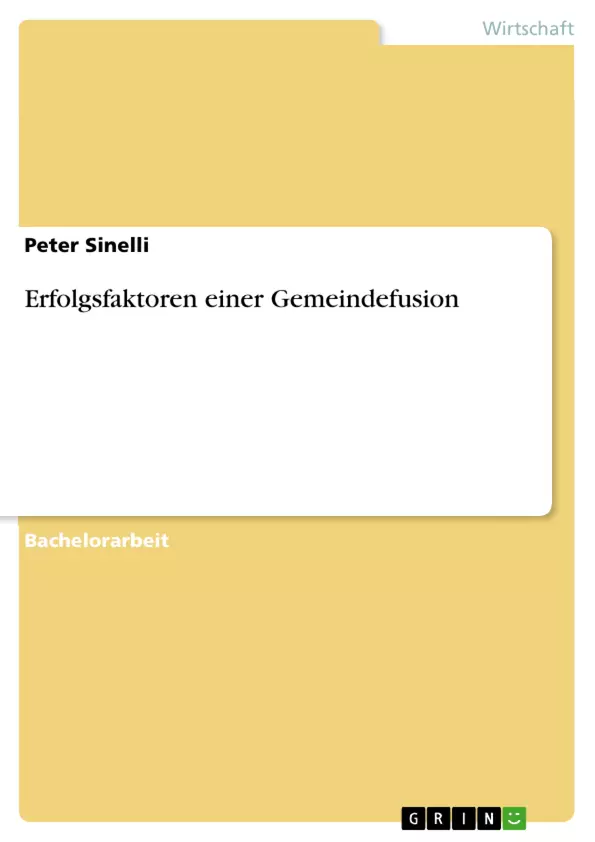Die Schweiz weist mit ihren rund 3000 Gemeinden sehr kleine Siedlungsstrukturen auf, was in gewissen Kantonen dazu führt, dass sich kleine Gemeinden zum Teil nicht mehr selbst tragen können und in finanzielle Notlagen geraten. Daher wird von verschiedenster Seite gefordert, derartige Strukturen zu verändern, indem die Gemeinden fusionieren. Die Kantone, aber auch der Bund verlangen verstärkt, dass die Probleme bereits auf der kleinsten Stufe, sprich der Gemeindeebene, angegangen werden. Der aktuellste Fall solcher umwälzenden Veränderungen wird sich im Kanton Glarus vollziehen, dessen Landsgemeinde im Mai 2006 beschlossen hat, seine Gemeindelandschaft komplett umzugestalten, indem die momentan 25 Gemeinden auf 3 reduziert werden.
Die zu erfüllenden Aufgaben werden für die Gemeinden immer breiter und die Problemkonstellationen immer komplexer, was gut ausgebildetes und professionelles Personal verlangt. Um eine kompetente Verwaltung zu besitzen, muss eine Gemeinde eine gewisse Grösse aufweisen, denn bloss auf diese Weise können in der Verwaltung Stellvertretungen geregelt werden und nur so kann in einer Gemeinde genügend Know-how aufgebaut werden. Das Subsidiaritätsprinzip wird meines Erachtens immer wichtiger, weshalb auch der Druck auf die Gemeinden wächst, da sie zu immer mehr Effizienz gezwungen werden. Zur Umsetzung solcher Effizienzsteigerungen, sind insbesondere bei kleinen Gemeinden Kooperationen untereinander nicht mehr wegzudenken. Doch auch in grösseren Agglomerationen treten verstärkt Koordinationsprobleme auf - beispielsweise in der Verkehrspolitik - welche kooperativ gelöst werden müssten. Kooperationen können in gewissen Bereichen mühsam und anstrengend werden, da mehrere Exekutivgremien, welche eigentlich nur ihrer Gemeindebevölkerung verpflichtet sind und zusätzlich noch aus verschiedensten Parteimitgliedern bestehen, sich auf die genau gleichen Entscheidungen einigen müssen, damit eine Kooperation überhaupt möglich wird.
Wenn daher eine Exekutive zu egoistisch handelt oder zwischenmenschliche Hürden bestehen, kommt eine sinnvolle Kooperation nicht zustande. Falls die Kooperation in einem externen Verband stattfindet, kann zwar die Entscheidungsfähigkeit sichergestellt werden, doch werden zugleich häufiger Demokratiedefizite beobachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der akteurzentrierte Institutionalismus
- 3. Gemeindefusionen: Grundsätzliche Argumente für und gegen Gemeindezusammenschlüsse
- 3.1 Optimale Gemeindegrösse
- 3.2 Ökonomische Argumente
- 3.3 Demokratieargumente
- 3.4 Verteilungsargumente
- 3.5 Entwicklungsargument
- 3.6 Studien zur Wichtigkeit von Gemeindefusionen
- 3.7 Zwischenfazit
- 4. Einflussfaktoren einer Gemeindefusion
- 4.1 Ökonomische Faktoren
- 4.1.1 Steuerunterschiede
- 4.1.2 Verschuldungsgrad
- 4.1.3 Effizienzfaktoren
- 4.1.4 Verfügbare Infrastrukturen und Kapazitäten
- 4.2 Kulturelle Faktoren
- 4.2.1 Vereinsleben
- 4.2.2 Kirchgemeinden
- 4.3 Geschichtliche Faktoren
- 4.3.1 Vergangenheitsgeschichte
- 4.3.2 Raumplanerische Entwicklung (Bevölkerungs- und Dienstleistungszentren)
- 4.4 Politische Faktoren
- 4.4.1 Bereits stattfindende interkommunale Zusammenarbeit
- 4.4.2 Auslöser/Initianten von Fusionsprojekten
- 4.4.3 Politische Parteien
- 4.4.4 Exekutive
- 4.4.5 Verwaltung
- 4.4.6 Kommissionen
- 4.4.7 Ortsbürger
- 4.4.8 Bürger/innen
- 4.5 Kantonale Unterstützungsfaktoren / Externe Beratung
- 4.5.1 Finanzielle Unterstützung
- 4.5.2 Rechtliche und politische Unterstützung durch Kanton und Externe
- 4.1 Ökonomische Faktoren
- 5 Zustandekommen einer Gemeindefusion am Beispiel Ober- und Unterehrendingen
- 5.1 Einführendes zu Ehrendingen
- 5.1.1 Oberehrendingen
- 5.1.2 Unterehrendingen
- 5.2 Ökonomische Faktoren
- 5.2.1 Steuerunterschied
- 5.2.2 Verschuldungsgrad
- 5.2.3 Effizienzsteigerungen
- 5.2.4 Verfügbare Kapazitäten und Infrastrukturen
- 5.3 Kulturelle Faktoren
- 5.3.1 Vereinsleben
- 5.3.2 Kirchgemeinden
- 5.4 Geschichtliche Faktoren
- 5.4.1 Vergangenheitsgeschichte
- 5.4.2 Raumplanerische Entwicklung (Bevölkerungs- und Dienstleistungszenter)
- 5.5 Politische Faktoren
- 5.5.1 Bereits stattfindende interkommunale Zusammenarbeit
- 5.5.2 Auslöser/Initiant von Fusionen
- 5.5.3 Politische Parteien
- 5.5.4 Politische Kultur
- 5.5.5 Exekutive
- 5.5.6 Verwaltung
- 5.5.7 Kommissionen
- 5.5.8 Ortsbürger
- 5.5.9 Bevölkerung
- 5.6 Kantonale Unterstützungsfaktoren / Externe Beratung
- 5.6.1 Finanzielle Unterstützung
- 5.6.2 Rechtliche und politische Unterstützung durch Kanton und Externe
- 5.7 Zwischenfazit
- 5.1 Einführendes zu Ehrendingen
- 6 Nicht Zustandekommen einer Gemeindefusion am Beispiel Nieder- und Oberrohrdorf
- 6.1 Einführendes zu Rohrdorf
- 6.1.1 Oberrohrdorf
- 6.1.2 Niederrohrdorf
- 6.2 Ökonomische Faktoren
- 6.2.1 Steuerunterschiede
- 6.2.2 Verschuldungsgrad
- 6.2.3 Effizienzsteigerungen
- 6.2.4 verfügbare Kapazitäten und Infrastrukturen
- 6.3 Kulturelle Faktoren
- 6.3.1 Vereinsleben
- 6.3.2 Kirchgemeinden
- 6.4 Geschichtliche Faktoren
- 6.4.1 Vergangenheitsgeschichte
- 6.4.2 Raumplanerische Entwicklung (Bevölkerungs- und Dienstleistungszentren)
- 6.5 Politische Faktoren
- 6.5.1 Bereits stattfindende interkommunale Zusammenarbeit
- 6.5.2 Auslöser / Initiant von Fusionen
- 6.5.3 Politische Parteien
- 6.5.4 Politische Kultur
- 6.5.5 Exekutive
- 6.5.6 Verwaltung
- 6.5.7 Kommissionen
- 6.5.8 Ortsbürger
- 6.5.9 Bürger/innen
- 6.6 Kantonale Unterstützungsfaktoren / externe Beratungen
- 6.6.1 Finanzielle Unterstützung
- 6.6.2 Rechtliche und politische Unterstützung durch Kanton und Externe
- 6.7 Zwischenfazit
- 6.1 Einführendes zu Rohrdorf
- 7. Gegenüberstellung und Interpretation
- 7.1 Gegenüberstellung der Beispielsgemeinden
- 7.2 Handlungsfelder und Akteurskonstellationen welche eine Gemeindefusion positiv beeinflussen können
- 8. Literaturverzeichnis
- 9. Internetverzeichnis
- 10. Interviewverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit den Erfolgsfaktoren einer Gemeindefusion. Sie analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren, die zum Gelingen oder Scheitern einer Fusion beitragen können. Die Arbeit analysiert sowohl ökonomische, kulturelle, geschichtliche und politische Faktoren als auch die Rolle des Kantons und externer Berater. Die Untersuchung basiert auf zwei Fallstudien: der erfolgreichen Fusion von Ober- und Unterehrendingen und der gescheiterten Fusion von Nieder- und Oberrohrdorf.
- Die Bedeutung von ökonomischen Faktoren wie Steuerunterschiede, Verschuldungsgrad und Effizienzsteigerungen
- Die Rolle von kulturellen Faktoren wie Vereinsleben und Kirchgemeinden bei der Fusion von Gemeinden
- Der Einfluss von geschichtlichen Faktoren wie Vergangenheitsgeschichte und raumplanerische Entwicklung auf Fusionen
- Die Bedeutung von politischen Faktoren wie interkommunale Zusammenarbeit, Auslöser von Fusionsprojekten, politische Parteien und die Rolle von Exekutive, Verwaltung, Kommissionen, Ortsbürgern und Bürgern/innen
- Die Bedeutung von kantonaler Unterstützung und externer Beratung für das Gelingen von Gemeindefusionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der kleinen Gemeinden in der Schweiz dar und zeigt die Notwendigkeit von Gemeindefusionen auf. Das zweite Kapitel führt den akteurzentrierten Institutionalismus ein, der als theoretischer Rahmen für die Analyse der Einflussfaktoren dient. Das dritte Kapitel beleuchtet die grundsätzlichen Argumente für und gegen Gemeindezusammenschlüsse. Die Kapitel 4 und 5 analysieren die Einflussfaktoren einer Gemeindefusion am Beispiel von Ober- und Unterehrendingen, während Kapitel 6 die gescheiterte Fusion von Nieder- und Oberrohrdorf beleuchtet. Das siebte Kapitel stellt die beiden Fallstudien gegenüber und interpretiert die Ergebnisse. Die Arbeit endet mit einem Literaturverzeichnis, einem Internetverzeichnis und einem Interviewverzeichnis.
Schlüsselwörter
Gemeindefusion, Erfolgsfaktoren, Einflussfaktoren, Ökonomische Faktoren, Kulturelle Faktoren, Geschichtliche Faktoren, Politische Faktoren, Kantonale Unterstützung, Externe Beratung, Fallstudien, Ober- und Unterehrendingen, Nieder- und Oberrohrdorf.
Häufig gestellte Fragen
Warum fusionieren Gemeinden in der Schweiz?
Häufige Gründe sind finanzielle Notlagen kleiner Strukturen, der Bedarf an professioneller Verwaltung und die zunehmende Komplexität öffentlicher Aufgaben.
Was sind ökonomische Erfolgsfaktoren einer Fusion?
Dazu zählen der Abbau von Steuerunterschieden, die Senkung des Verschuldungsgrades sowie Effizienzsteigerungen in der Infrastrukturnutzung.
Welche Rolle spielen kulturelle Faktoren?
Ein gemeinsames Vereinsleben und die Zusammenarbeit der Kirchgemeinden können eine Fusion erleichtern, während starke lokale Identitäten oft Hürden darstellen.
Welches Beispiel für eine erfolgreiche Fusion wird genannt?
Die Fusion von Ober- und Unterehrendingen dient als positives Praxisbeispiel, bei dem politische und ökonomische Faktoren gut ineinandergriffen.
Was führte zum Scheitern der Fusion in Rohrdorf?
Am Beispiel von Nieder- und Oberrohrdorf werden politische Widerstände und kulturelle Differenzen analysiert, die den Zusammenschluss verhinderten.
- Quote paper
- B.A. Peter Sinelli (Author), 2006, Erfolgsfaktoren einer Gemeindefusion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118889