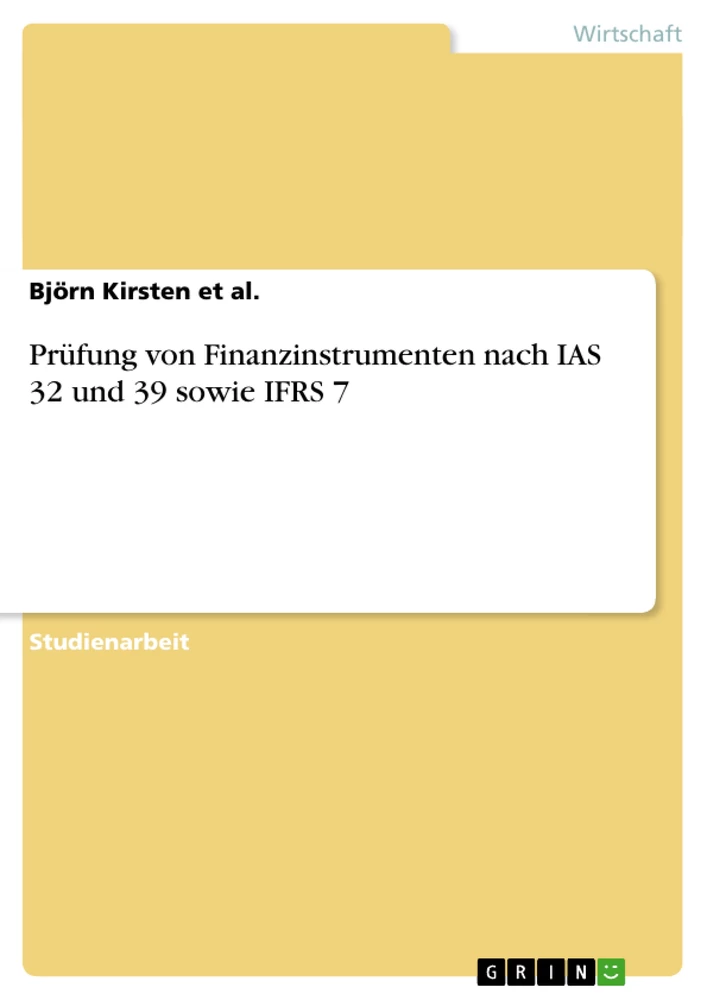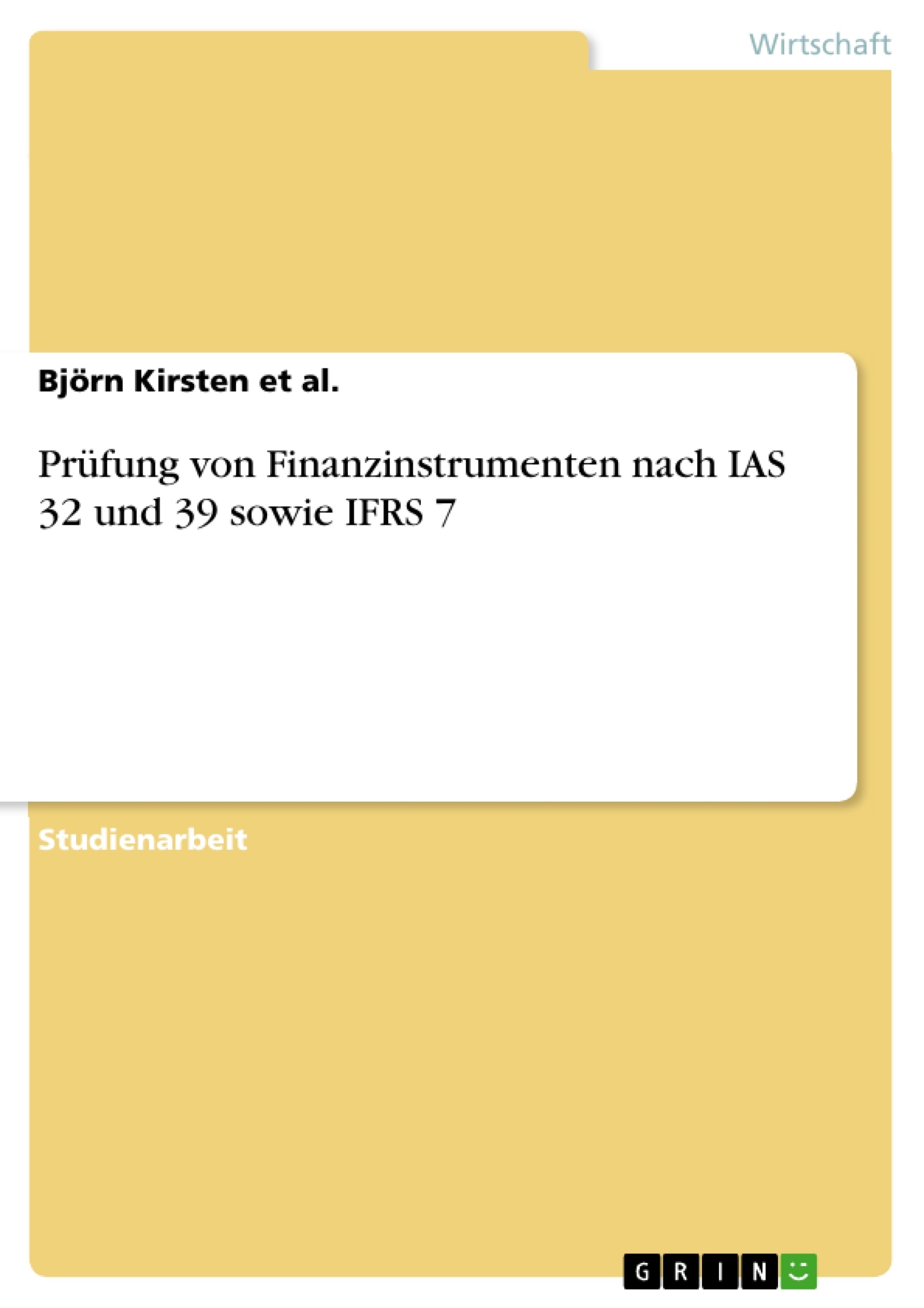Das Bestreben zur Vereinheitlichung der Rechnungslegungsstandards auf internationaler
Ebene bewirkt ständige Reformen und stellt somit nicht nur die bilanzierenden
Unternehmen, sondern auch die jeweiligen Abschlussprüfer vor große
Herausforderungen. Während bis April 1998 sämtliche Abschlüsse von Unternehmen
in Deutschland gemäß HGB angefertigt werden mussten, bestand mit
dem Inkrafttreten des Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetztes für kapitalmarktorientierte
Konzerne ein Wahlrecht auch nach IFRS oder anderen international
anerkannten Rechnungslegungsstandards bilanzieren zu können. Dieses Wahlrecht
wurde wiederum 2007 im Rahmen des Bilanzrechtsreformgesetzes endgültig
durch ein Gebot zur Bilanzierung nach IFRS für o. g. Konzerne abgelöst und
zusätzlich ein solches Wahlrecht für nicht-kapitalmarktorientierte Konzerne
eingeführt. Zur Ermittlung der Ausschüttungsbemessungs- und Besteuerungsgrundlage
sind allerdings weiterhin die nach handelsrechtlichen Vorschriften
aufgestellten Einzelabschlüsse zu verwenden.1 Somit besteht für diese Unternehmen
die Notwendigkeit stets nach zwei Rechnungslegungsvorschriften zu bilanzieren.
Auch wenn durch die geplante Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes
(BilMoG) zum 01.01.2009 dieser Umstand teilweise vereinfacht
werden soll, ist zurzeit eine Überleitungsrechnung vom HGB- zum IFRSAbschluss
die Regel. Durch diese soll erreicht werden, dass ein zweiter Jahresabschluss
nicht in seiner Gesamtheit neu erstellt werden muss, sondern lediglich
eine Anpassung der abweichenden Positionen vorgenommen wird. Die notwendige
Prüfung beider Abschlüsse kann analog aufgebaut werden.
Einen besonderen Unterschied stellt in diesem Zusammenhang die Handhabung
von Finanzinstrumenten dar. Beginnend bei der Begrifflichkeit, die nach HGB in
dieser Art nicht existiert, über Differenzen hinsichtlich Ausweis, Ansatz und
Bewertung wird die besondere bilanzielle Behandlung dieser Positionen nach
IFRS durch ihre hohen Wertschwankungen und dem damit verbundenen Risikopotential
begründet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sukzessives Vorrücken internationaler Bilanzierungsrichtlinien
- 2. Finanzinstrumente nach IAS 32 und 39 sowie IFRS 7
- 2.1 Definition
- 2.2 Ansatz und Ausbuchung
- 2.3 Erst- und Folgebewertung sowie Umklassifizierung
- 2.4 Gewinne und Verluste sowie Wertminderungen
- 2.5 Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen
- 2.6 Ausweisfragen und Anhangangaben
- 3. Spezfische Unterschiede zwischen HGB und IFRS
- 3.1 Zwischen Gläubigerschutz und Informationsfunktion
- 3.2 Finanzielle Vermögenswerte
- 3.3 Finanzielle Verbindlichkeiten
- 3.4 Eigenkapitalinstrumente
- 3.5 Sicherungsbeziehungen
- 4. Prüfung der Überleitungsrechnung
- 4.1 Prüfungsziele und ihre Relevanz für das Prüfprogramm
- 4.2 Allgemeine Fragen
- 4.3 Finanzielle Vermögenswerte
- 4.4 Finanzielle Verbindlichkeiten
- 4.5 Eigenkapitalinstrumente
- 4.6 Sicherungsbeziehungen
- 5. Schleichender Abschied von der traditionellen handelsrechtlichen Rechnungslegung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prüfung von Finanzinstrumenten nach IAS 32 und 39 sowie IFRS 7 im Kontext des Übergangs von HGB zu IFRS in Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich sowohl für Unternehmen als auch für Wirtschaftsprüfer aus dieser Entwicklung ergeben.
- Die Entwicklung und Auswirkungen internationaler Bilanzierungsrichtlinien
- Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IAS/IFRS
- Die Unterschiede zwischen HGB und IFRS bezüglich der Bilanzierung von Finanzinstrumenten
- Die Prüfung von Überleitungsrechnungen zwischen HGB und IFRS
- Der Übergangsprozess von HGB zu IFRS und dessen Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Sukzessives Vorrücken internationaler Bilanzierungsrichtlinien: Dieses Kapitel beschreibt die schrittweise Einführung internationaler Bilanzierungsstandards in Deutschland, beginnend mit dem Wahlrecht für kapitalmarktorientierte Konzerne bis hin zur Pflicht zur IFRS-Bilanzierung. Es hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, sowohl nach HGB als auch nach IFRS zu bilanzieren, und die Rolle der Überleitungsrechnung zur Vereinfachung dieses Prozesses. Die besondere Bedeutung der unterschiedlichen Behandlung von Finanzinstrumenten unter HGB und IFRS wird betont, was die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse dieser Instrumente im weiteren Verlauf der Arbeit begründet.
2. Finanzinstrumente nach IAS 32 und 39 sowie IFRS 7: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition, dem Ansatz, der Ausbuchung, der Bewertung und der Umklassifizierung von Finanzinstrumenten nach IAS 32, 39 und IFRS 7. Es analysiert die verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten, die jeweiligen Bewertungsmethoden und die Behandlung von Gewinnen, Verlusten und Wertminderungen. Die Kapitel erläutern ebenfalls die komplexe Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Bedeutung der Transparenz und die Notwendigkeit detaillierter Anhangangaben werden hervorgehoben.
3. Spezifische Unterschiede zwischen HGB und IFRS: Das Kapitel vergleicht die Bilanzierung von Finanzinstrumenten unter HGB und IFRS, indem es den Unterschied zwischen Gläubigerschutz und Informationsfunktion herausarbeitet und die Behandlung finanzieller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapitalinstrumente und Sicherungsbeziehungen in beiden Systemen gegenüberstellt. Es wird deutlich, wie die unterschiedlichen regulatorischen Ziele und der Fokus auf verschiedene Aspekte zu unterschiedlichen bilanzrechtlichen Ausgestaltungen führen. Die Notwendigkeit einer detaillierten Kenntnis beider Systeme wird hervorgehoben, um eine korrekte Überleitungsrechnung und Prüfung zu gewährleisten.
4. Prüfung der Überleitungsrechnung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Prüfung der Überleitungsrechnung vom HGB- zum IFRS-Abschluss. Es beschreibt die Prüfungsziele und deren Relevanz für die Gestaltung des Prüfprogramms. Der Fokus liegt auf den spezifischen Prüfungsschritten für die verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten: finanzielle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapitalinstrumente und Sicherungsbeziehungen. Die Bedeutung einer systematischen und gründlichen Prüfung, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der Überleitungsrechnung sicherzustellen, wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Finanzinstrumente, IAS 32, IAS 39, IFRS 7, HGB, Rechnungslegung, Bilanzierung, Prüfung, Überleitungsrechnung, Wertminderung, Sicherungsbeziehungen, Gläubigerschutz, Informationsfunktion, Konzern, Kapitalmarktorientierung.
FAQ: Prüfung von Finanzinstrumenten nach IAS/IFRS im Kontext des Übergangs von HGB zu IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Prüfung von Finanzinstrumenten nach IAS 32, 39 und IFRS 7 im Kontext des Übergangs von der Handelsbilanzierung (HGB) zu den International Financial Reporting Standards (IFRS) in Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen für Unternehmen und Wirtschaftsprüfer, die sich aus diesem Übergang ergeben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Auswirkungen internationaler Bilanzierungsrichtlinien, die Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IAS/IFRS, die Unterschiede zwischen HGB und IFRS in der Bilanzierung von Finanzinstrumenten, die Prüfung von Überleitungsrechnungen zwischen HGB und IFRS sowie den Übergangsprozess von HGB zu IFRS und dessen Herausforderungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beschreibt die sukzessive Einführung internationaler Bilanzierungsstandards. Kapitel 2 behandelt die Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IAS 32, 39 und IFRS 7. Kapitel 3 vergleicht die Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach HGB und IFRS. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Prüfung der Überleitungsrechnung zwischen HGB und IFRS. Kapitel 5 diskutiert den Abschied von der traditionellen handelsrechtlichen Rechnungslegung.
Welche Aspekte der Finanzinstrumentenbilanzierung werden im Detail betrachtet?
Kapitel 2 analysiert die Definition, den Ansatz, die Ausbuchung, die Bewertung und die Umklassifizierung von Finanzinstrumenten. Es behandelt verschiedene Arten von Finanzinstrumenten, Bewertungsmethoden, Gewinne, Verluste, Wertminderungen und die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Die Bedeutung von Transparenz und detaillierten Anhangangaben wird hervorgehoben.
Wie werden die Unterschiede zwischen HGB und IFRS bezüglich der Finanzinstrumente dargestellt?
Kapitel 3 vergleicht die Bilanzierung von Finanzinstrumenten unter HGB und IFRS, wobei der Unterschied zwischen Gläubigerschutz und Informationsfunktion im Vordergrund steht. Die Behandlung finanzieller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapitalinstrumente und Sicherungsbeziehungen in beiden Systemen wird gegenübergestellt. Die unterschiedlichen regulatorischen Ziele und deren Auswirkungen auf die bilanzrechtliche Ausgestaltung werden erläutert.
Was ist der Schwerpunkt von Kapitel 4?
Kapitel 4 konzentriert sich auf die Prüfung der Überleitungsrechnung vom HGB- zum IFRS-Abschluss. Es beschreibt die Prüfungsziele und das Prüfprogramm, mit besonderem Fokus auf die Prüfungsschritte für verschiedene Arten von Finanzinstrumenten (finanzielle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapitalinstrumente und Sicherungsbeziehungen).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Finanzinstrumente, IAS 32, IAS 39, IFRS 7, HGB, Rechnungslegung, Bilanzierung, Prüfung, Überleitungsrechnung, Wertminderung, Sicherungsbeziehungen, Gläubigerschutz, Informationsfunktion, Konzern, Kapitalmarktorientierung.
- Quote paper
- Björn Kirsten et al. (Author), 2008, Prüfung von Finanzinstrumenten nach IAS 32 und 39 sowie IFRS 7 , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118892