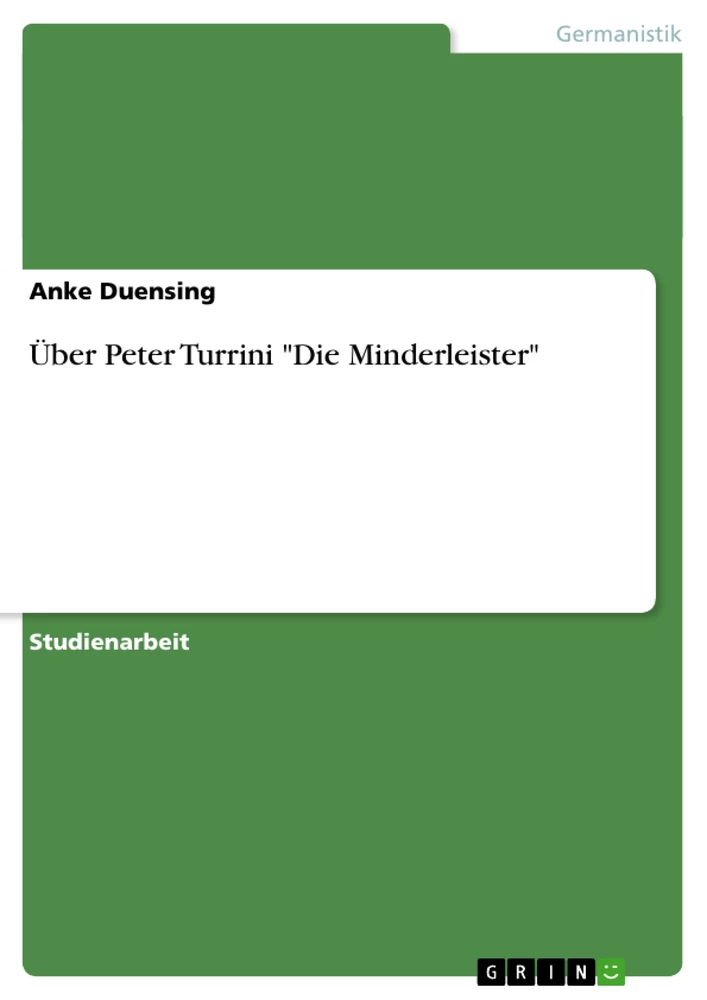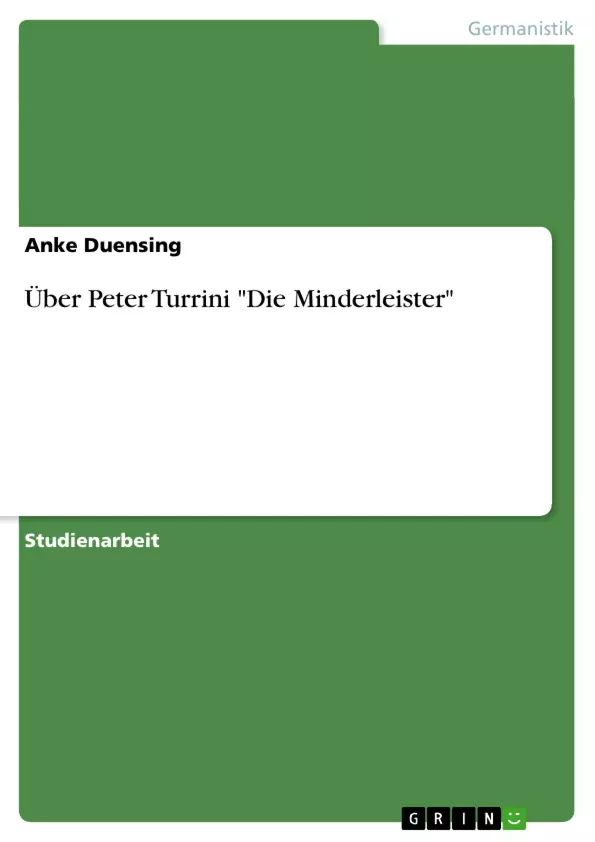Das Volksstück hat in der deutschen Literatur einen festen Platz eingenommen, wenngleich
auch der Begriff des kritischen Volksstücks nicht unproblematisch ist.
Das kritische oder auch moderne Volksstück wird je nach Autor oder Nachschlagewerk
unterschiedlich konnotiert – einhergehend mit der Frage, ob dieser Terminus nicht nur ein
theoretischer sei. Eine eigene Gattungsgeschichte ist nicht erkennbar – das Volksstück
definiert sich nahezu ausschließlich über Merkmale.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen in wie fern Die Minderleister von Peter Turrini
dem Begriff des kritischen Volksstück entspricht. Es werden von mir inhaltliche und formale
Kriterien untersucht. Hierbei stütze ich mich hauptsächlich auf die Publikationen von Thomas
von Dach und Thomas Schmitz.
Des Weiteren bringe ich Die Minderleister in Zusammenhang mit der Biografie Turrinis um
die Konsistenz seiner Bemühungen zu hinterfragen.
Die Informationen über Turrini sind spärlich und Angaben zur Person wirken angesichts der
Aufzählung ausgeübter Berufe an sich schon wie eine kleine Inszenierung.
Das diskutierte Stück wird momentan weder aufgeführt noch verlegt – die Gründe dafür
werden ebenfalls aufgezeigt.
[...]
Inhalt
0. Einleitung
1. Peter Turrini
2. Peter Turrini und das kritische Volksstück
3. Die Minderleister (1988) 3.1. Sozialgeschichtlicher Hintergrund
3.2. Intention
3.3. Personenkonstellation
3.4.Handlungsverlauf
3.5. Formale Aspekte
4. Resümee
Literatur
Anhang
0. Einleitung
Das Volksstück hat in der deutschen Literatur einen festen Platz eingenommen, wenngleich auch der Begriff des kritischen Volksstücks nicht unproblematisch ist.
Das kritische oder auch moderne Volksstück wird je nach Autor oder Nachschlagewerk unterschiedlich konnotiert – einhergehend mit der Frage, ob dieser Terminus nicht nur ein theoretischer sei. Eine eigene Gattungsgeschichte ist nicht erkennbar – das Volksstück definiert sich nahezu ausschließlich über Merkmale.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen in wie fern Die Minderleister von Peter Turrini dem Begriff des kritischen Volksstück entspricht. Es werden von mir inhaltliche und formale Kriterien untersucht. Hierbei stütze ich mich hauptsächlich auf die Publikationen von Thomas von Dach und Thomas Schmitz.
Des Weiteren bringe ich Die Minderleister in Zusammenhang mit der Biografie Turrinis um die Konsistenz seiner Bemühungen zu hinterfragen.
Die Informationen über Turrini sind spärlich und Angaben zur Person wirken angesichts der Aufzählung ausgeübter Berufe an sich schon wie eine kleine Inszenierung.
Das diskutierte Stück wird momentan weder aufgeführt noch verlegt – die Gründe dafür werden ebenfalls aufgezeigt.
1. Peter Turrini
Peter Turrini: - geboren am 26.09.1944 in St. Margarethen / Oberösterreich
- in Maria Saal aufgewachsen
- bis 1971 in unterschiedlichsten Berufen tätig
- seit 1971 als freier Schriftsteller, Regisseur, Drehbuchautor in Wien
- Würdigungspreis des Landes Niedersachsen (2003),
Gerhard-Hauptmann-Preis (1981) u.a.
Werkauswahl:1973 „Kindsmord“
1978 Lesebuch eins. Stücke, Pamphlete, Filme, Reaktionen
1980 „Die Alpensaga“
1980 „Josef und Maria“
1993 „Alpenglühen“
1996 „Liebe Mörder! Von der Gegenwart, dem Theater und vom lieben Gott.“
1999 „Ein irrer Traum“ Lesebuch eins.
1999 „Das Gegenteil ist wahr“ Lesebuch zwei
2002 „Da Ponte in Santa Fe”
Auszeichnungen: 1972 Förderungspreis des Landes Kärnten für Literatur
1976 Förderungspreis der Stadt Wien für Literatur
1979 Fernsehpreis der Österreichischen Volksbildung (gemeinsam mit Dieter Berner und Wilhelm Pevny)
1981 Gerhart-Hauptmann-Preis der Freien Volksbühne Berlin
1988 Buchprämie des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst
2. Peter Turrini und das kritische Volksstück
„Mich hat dieser Terminus Volksstück nie sonderlich interessiert. Ich könnte behaupten, alle meine Stücke sind Volksstücke. Es geht mir auch nicht um eine Neubewertung des Volksstücks, ich hab halt so meine Schwierigkeiten, da irgendwie eine Germanistennahrung zu liefern. [...] Was mich im Augenblick mehr interessiert: Inwieweit kann Literatur helfen, inwieweit kann Literatur stören [...] Ich bin einer jener größenwahnsinniger Autoren, die der Meinung sind, Literatur soll sich, muss sich aus den Ghettos ästhetischer Einordnung grundsätzlich herausbewegen, sei es durch Geschmacklosigkeit, sei es durch extremen Dialekt, sei es durch pornografische Mittel, durch welche Mittel auch immer. [...]
Ein Mensch, der nicht arbeitet, ist kein Mensch. Was bedeutet das in dieser Gesellschaft, die immer weniger Menschen Arbeit geben kann? Das ist mein Thema, das ist mein Impuls.“[1]
Es wird deutlich, dass Turrini sich weigert, sein Schaffen zu kategorisieren und eine von außen eventuell erfolgte Einordnung nicht kommentieren oder bewerten möchte. Ihn selbst interessiert die Definition des Begriffs nicht sonderlich. Dieser erscheint ihm theoretisch, die Einordnung entspricht nicht dem Anliegen seiner Literatur.
Trotz allem Widerwillen gegen das Theoretisieren lassen sich bei Turrini die von von Dach konstatierten Merkmale finden, die den Schriftsteller zum Produzenten von Volksstücken macht[2].
1) Die verwendete Sprache ist, entsprechend der sozialen Schicht der Figur(en), dialektisch gefärbt.[3]
2) Nutzung der Sprache um zu irritieren bzw. provozieren.
Gerade Die Minderleister ist hochdeutsch formuliert. Die Protagonisten sprechen keinen Dialekt sondern exaktes hochdeutsch. Ziel ist, durch eben diese Art des Sprachgebrauchs zu irritieren.
„Die Milieuzuordnung heute - das sind halt die Arbeiter und die reden halt so im Dialekt – ist so selbstverständlich, dass die Irritation, die mir vorschwebt, über den Dialekt nicht mehr gegeben wäre.
[ ... ] Wenn ein Stahlarbeiter hochdeutsch spricht, manchmal ein streng geformtes und rhythmisches Deutsch, bringt dies vielleicht einen irritierenden Blick auf die Wirklichkeit.“[4]
3) Zur Sprache kommt die Mimik und Gestik mit vergleichsweise verstärkter Bedeutung.
So entladen sich bedeutungsschwangere Momente in surrealen Szenen, etwa durch das Auftreten des Quizmasters.
„ [ ... ] Die Assistentin Uschi und Barbera bringen drei Puppen herein. Jede Puppe hat eine Maske und einen Mantel. [ ... ] Hans schlägt auf die Puppe ein. Die Puppe fällt mit einem komischen Geräusch zu Boden. Das Publikum applaudiert. Der Quizmaster zeigt auf die nächste Puppe. [ ... ] Hans schlägt auf die Puppe ein. Die Puppe fällt mit einem komischen Geräusch zu Boden. Das Publikum applaudiert. Der Quizmaster zeigt auf die nächste Puppe. [ ... ] Hans hebt die Hand. Die Puppe dreht sich um. Die Maske ist hinten. Das Gesicht von Anna ist vorne. Sie schaut Hans an. Stille. Hans lässt seine Hand sinken. Der Quizmaster, die Assistentin, das ganze Drumherum verschwindet wie ein Spuk. Anna umarmt Hans. Hans umarmt Anna.“[5]
4) Milieugebundener Themenkreis und Aktualität
Von Dach bemerkt in diesem Zusammenhang, dass mit einem „Milieurismus“ der Wirkungsbereich eingeschränkt wäre. Die Aktualität des modernen Volksstücks gehe mit der Zeit naturgemäß verloren und somit erschiene es nur billig, dass ein Teil der Literatur nur noch aus nostalgischen Gründen rezipiert würde.[6]
In der Tat sind die Themen Turrinis hauptsächlich im Milieu der sozial niederen Schichten angesiedelt. Die Figuren in Die Minderleister sind gezwungen sich mit tagesaktuellen Problemen der Arbeiter in der Stahlindustrie der achtziger Jahre auseinanderzusetzen. Sicherlich hätte man damals annehmen können, dass die Wirtschaft saniert und somit auch Die Minderleister zu einem „alten Hut“ werden. Das Gegenteil war der Fall – und somit ist das Stück thematisch wieder auf der Höhe der Zeit. Fragen, wie die nach Einkommensverzicht verunsichern hinsichtlich der Entstehungszeit des Stücks.
„Quizmaster: „6 aus 45“. Fünfundvierzig brauchen eine Arbeit, aber nur 6 können eine bekommen[7]. Sind Sie bereit auf 10 Prozent Ihres bisherigen Lohnes zu verzichten? [ ... ] Auf 20 Prozent? [ ... ] Auf 30 Prozent? [ ... ] Auf 40 Prozent? [ ... ] Bravo, Hans, Sind Sie bereit, drei Stunden täglich Fahrzeit auf sich zu nehmen? [ ... ] Vier Stunden? [ ... ] Sind Sie bereit, jede nur denkbare Arbeit anzunehmen? Tag oder Nacht? So weit Sie von Ihrem Wohnort auch entfernt sein mag? So schlimm der Chef auch sein mag?“
[...]
[1] Turrini in Wolfgang Schuch, S. 318 f
[2] vgl. von Dach, S. 103 f
[3] Die Minderleister liegt auch in einer ersten Fassung Sprach im Dialekt vor, welche mir allerdings nicht zugänglich war. Im Übrigen bezieht sich Pkt. 1) auf andere Stücke.(etwa Rozzenjogd).
[4] [4] Turrini in Wolfgang Schuch, S. 317 f
[5] Turrini in Wolfgang Schuch, S. 70 f
[6] Von Dach, S. 104 f
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung des Textes?
Die Einleitung beschäftigt sich mit dem Begriff des kritischen Volksstücks in der deutschen Literatur. Es wird die Problematik der Definition und die Frage, ob es sich um einen rein theoretischen Begriff handelt, angesprochen. Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung, inwiefern Peter Turrinis "Die Minderleister" dem Begriff des kritischen Volksstücks entspricht.
Wer ist Peter Turrini?
Peter Turrini ist ein österreichischer Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor, geboren am 26. September 1944. Er war bis 1971 in verschiedenen Berufen tätig und ist seitdem freier Schriftsteller in Wien. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und Werke wie "Kindsmord", "Die Alpensaga" und "Josef und Maria" verfasst.
Wie steht Peter Turrini zum Begriff "Volksstück"?
Turrini lehnt die Kategorisierung seines Schaffens ab und möchte keine Einordnung von außen kommentieren. Die Definition des Begriffs "Volksstück" interessiert ihn nicht, da sie ihm zu theoretisch erscheint und nicht seinem literarischen Anliegen entspricht.
Welche Merkmale eines Volksstücks lassen sich bei Turrini finden?
Trotz Turrinis Widerwillen gegen die Theorie lassen sich Merkmale bei ihm finden, die ihn zum Produzenten von Volksstücken machen, wie die Verwendung dialektisch gefärbter Sprache, die Nutzung der Sprache zur Irritation, die Bedeutung von Mimik und Gestik sowie ein milieugebundener Themenkreis und Aktualität.
Inwiefern ist "Die Minderleister" ein Beispiel für ein kritisches Volksstück?
Obwohl "Die Minderleister" hochdeutsch formuliert ist, dient dies der Irritation. Das Stück behandelt aktuelle Probleme der Arbeiter in der Stahlindustrie der 1980er Jahre und stellt Fragen nach Einkommensverzicht, die auch heute noch relevant sind.
Was wird über die Sprache in "Die Minderleister" gesagt?
Anders als in traditionellen Volksstücken, in denen Dialekt üblich ist, ist "Die Minderleister" in Hochdeutsch verfasst. Dies dient dazu, eine Irritation beim Publikum zu erzeugen und einen neuen Blick auf die Realität zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die Mimik und Gestik in "Die Minderleister"?
Mimik und Gestik spielen eine wichtige Rolle, um bedeutungsschwangere Momente in surrealen Szenen zu entladen, wie beispielsweise durch das Auftreten des Quizmasters und die Puppenszene.
Welche Themen werden in "Die Minderleister" behandelt?
Das Stück behandelt Themen wie Arbeitslosigkeit, Einkommensverzicht und die Bereitschaft, jede Arbeit anzunehmen, unabhängig von den Bedingungen. Diese Themen sind im Milieu der sozial niedrigeren Schichten angesiedelt und waren in den 1980er Jahren aktuell, sind aber auch heute noch relevant.
Was bedeutet der Quizmaster im Stück?
Der Quizmaster symbolisiert die schwierige Situation von Arbeitssuchenden. Er stellt zermürbende Fragen über die Bereitschaft, auf Einkommen zu verzichten und schwierige Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen.
Warum wird "Die Minderleister" momentan nicht aufgeführt oder verlegt?
Der Text erwähnt, dass die Gründe dafür ebenfalls aufgezeigt werden. Die Gründe dafür werden im Text noch weiter erläutert.
- Citar trabajo
- Anke Duensing (Autor), 2004, Über Peter Turrini "Die Minderleister", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118924