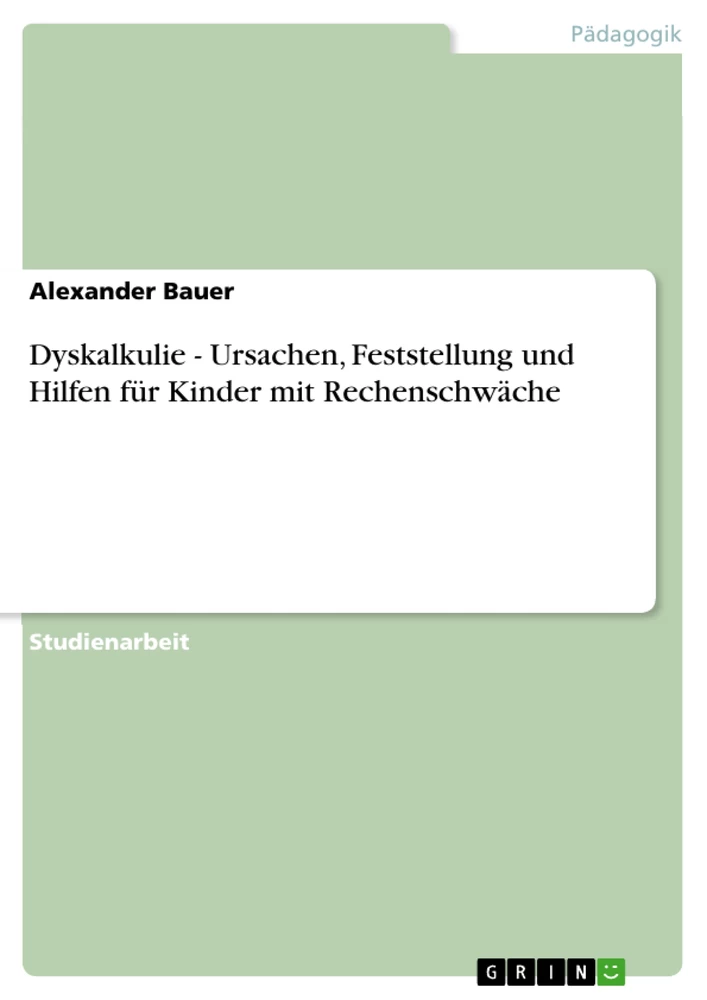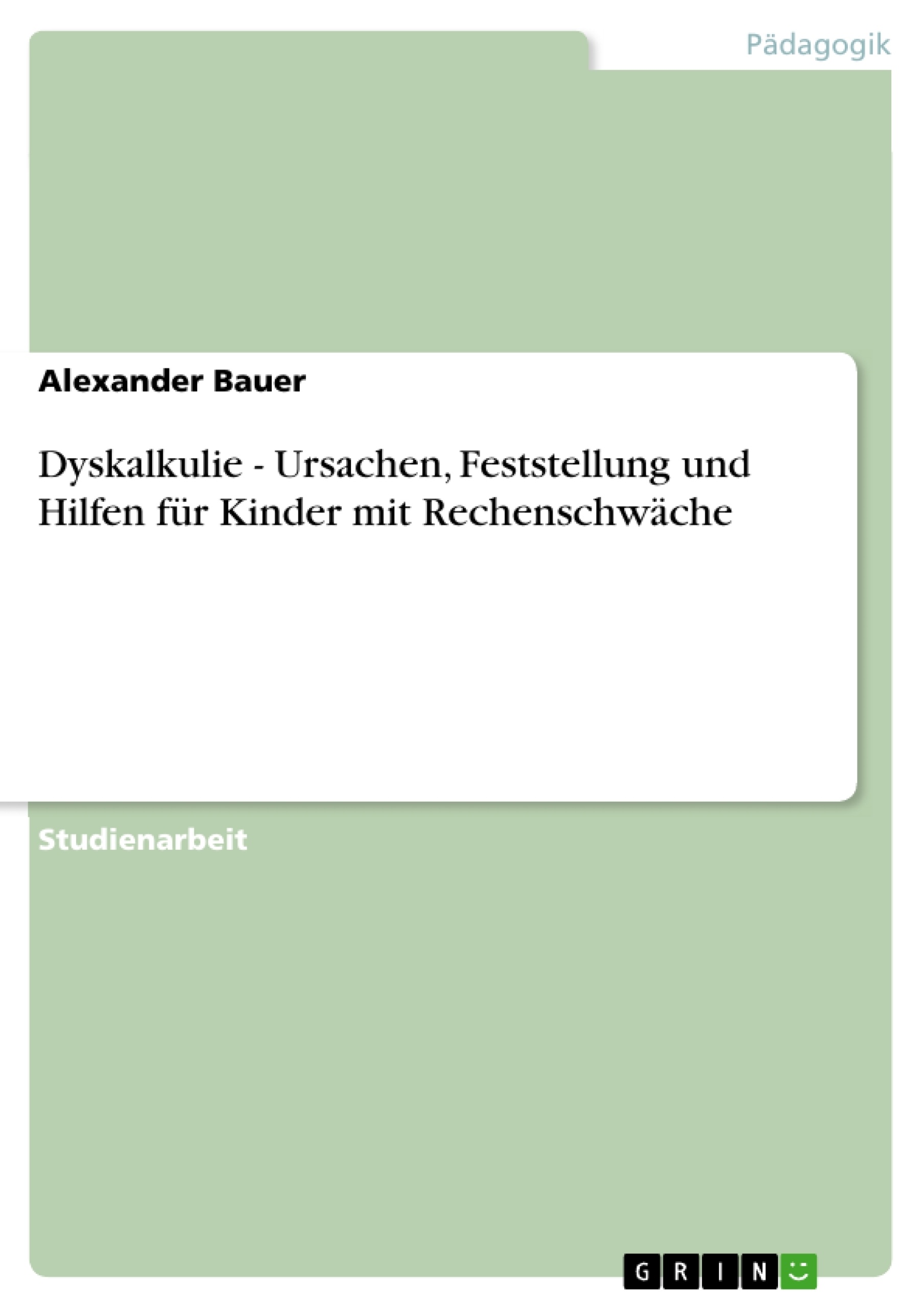Unter dem Begriff der Dyskalkulie versteht man eine „Rechenstörung“/ bzw.
„Rechenschwäche“, wobei letztere Begriffe von vielen Verfassern synonym verwendet werden. Andere aber ziehen auch den Gebrauch eines der Wörter vor.
Nach der internationalen Klassifikation der WHO wird die Rechenstörung als eine
Teilleistungsschwäche angesehen, die aus verschiedenen Ursachen entstehen kann „Diese Störung beinhaltet eine umschriebene Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine eindeutig unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten“ (DSM-III-R, Beltz-Verlag Weinheim, Basel 1989, 277, zit. n. Ganser, 2001, S.7).
Demnach kann bei einer Rechenstörung eine Intelligenzminderung vorliegen und eine besondere Beschulung nötig sein, muss aber nicht unbedingt. Die Klassifikation klammert andere Faktoren, die zu einer Rechenschwäche führen können, aus.
Rechenschwäche wird auch als „anhaltende Schwierigkeiten im Erfassen rechnerischer Sachverhalte“ (Ortner und Ortner, 1991, S.244 ff. zit. n. Ganser, 2001, S.7) gesehen. Dabei ist der Umgang mit Zahlen und den Rechentechniken gemeint.
Sucht man eine Definition, die sich besonders auf die Form des Unterrichtes bezieht, kann man sagen, dass alle Schüler eine Rechenschwäche haben, „ die einer Förderung jenseits des Standardsunterrichts bedürfen“ (Lorenz, Radatz 1993, S.16 zit. n. Ganser, 2001, S.7).
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Rechenschwäche/ Rechenstörung über eine längere Zeit anhält, den Betroffenen das Folgen des Matheunterrichts sehr erschwert und sich auf das Selbstbewusstsein auswirken kann, so dass letzteres die Schwierigkeit des Begreifens wiederum verstärken kann.
Wie entsteht aber eine Rechenschwäche, woran erkennt man sie, oder wie kann den
Kindern, die rechenschwach sind geholfen werden? Darauf wird im Folgenden
eingegangen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ursachen einer Rechenschwäche
- 2.1 Der neuropsychologische Ansatz
- 2.1.1 Störungen in der visuellen und taktilen Wahrnehmung
- 2.1.2 Störungen in der auditiven Wahrnehmung
- 2.1.3 Störungen in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung
- 2.1.4 Soziokulturelle und familiäre Ursachen für Rechenschwäche
- 2.2 Schulische Ursachen für Rechenschwäche
- 3. Feststellung einer Rechenschwäche
- 4. Verschiedene Hilfen für rechenschwache Kinder
- 4.1 Die Förderarbeit in der Schule
- 4.2 Die Dyskalkulietherapie
- 4.3 Elternarbeit als unterstützende Hilfe für das rechenschwache Kind
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Dyskalkulie, auch bekannt als Rechenschwäche. Ziel ist es, die Ursachen, die Feststellung und verschiedene Fördermöglichkeiten dieser Teilleistungsschwäche zu beleuchten. Der Fokus liegt auf einem umfassenden Verständnis der Problematik und der Bereitstellung von Hilfestellungen für betroffene Kinder.
- Neuropsychologische Ursachen von Rechenschwäche
- Rolle von Wahrnehmungsstörungen (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch)
- Feststellung und Diagnostik von Dyskalkulie
- Fördermöglichkeiten im schulischen Kontext
- Bedeutung der Elternarbeit bei der Unterstützung rechenschwacher Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff Dyskalkulie und Rechenschwäche, wobei die Synonymität dieser Begriffe in der Literatur diskutiert wird. Sie stellt die Dyskalkulie als Teilleistungsschwäche dar, deren Ursachen vielschichtig sind und nicht allein durch Intelligenzminderung oder ungeeignete Beschulung erklärt werden können. Die Einleitung leitet über zu den zentralen Fragen nach den Ursachen, der Diagnose und der Förderung von Rechenschwäche.
2. Ursachen einer Rechenschwäche: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für Rechenschwäche. Es wird betont, dass das Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu Defiziten führt, die zur Entstehung einer Rechenschwäche beitragen. Der neuropsychologische Ansatz wird im Detail behandelt, wobei die Bedeutung verschiedener Wahrnehmungsbereiche (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) für die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten herausgestellt wird. Die Bedeutung einer intakten Auge-Hand-Koordination und die Schwierigkeiten rechenschwacher Kinder beim Ordnen, Vergleichen und Zählen werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Teilleistungsschwäche, neuropsychologischer Ansatz, Wahrnehmungsstörungen, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Fördermöglichkeiten, Schule, Elternarbeit, Diagnostik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Dyskalkulie - Ursachen, Feststellung und Förderung
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Dyskalkulie (Rechenschwäche). Sie behandelt die Ursachen, die Feststellung und verschiedene Fördermöglichkeiten dieser Teilleistungsschwäche. Der Fokus liegt auf einem umfassenden Verständnis der Problematik und der Bereitstellung von Hilfestellungen für betroffene Kinder. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Ursachen für Rechenschwäche werden behandelt?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Erklärungsansätze für Rechenschwäche, wobei der neuropsychologische Ansatz im Detail behandelt wird. Hierbei wird die Bedeutung verschiedener Wahrnehmungsbereiche (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) für die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten hervorgehoben. Auch soziokulturelle und familiäre Faktoren sowie schulische Ursachen werden berücksichtigt.
Welche Wahrnehmungsstörungen spielen eine Rolle bei Dyskalkulie?
Die Hausarbeit betont die Rolle von Störungen in der visuellen, auditiven und taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bei der Entstehung von Rechenschwäche. Schwierigkeiten beim Ordnen, Vergleichen und Zählen werden im Zusammenhang mit diesen Wahrnehmungsdefiziten erläutert.
Wie wird Dyskalkulie festgestellt?
Die Hausarbeit beschreibt den Prozess der Feststellung einer Rechenschwäche, geht aber nicht detailliert auf spezifische Diagnoseverfahren ein. Sie erwähnt die Diagnostik als wichtigen Aspekt der Auseinandersetzung mit Dyskalkulie.
Welche Fördermöglichkeiten für rechenschwache Kinder werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Fördermöglichkeiten, darunter die Förderarbeit in der Schule, die Dyskalkulietherapie und die unterstützende Rolle der Elternarbeit. Die Bedeutung einer individuellen und umfassenden Förderung wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Eltern bei der Unterstützung rechenschwacher Kinder?
Die Hausarbeit betont die wichtige Bedeutung der Elternarbeit bei der Unterstützung rechenschwacher Kinder. Eltern werden als wichtige Partner im Förderprozess gesehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Dyskalkulie, Rechenschwäche, Teilleistungsschwäche, neuropsychologischer Ansatz, Wahrnehmungsstörungen, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Fördermöglichkeiten, Schule, Elternarbeit, Diagnostik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Hausarbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die Kernaussagen jedes Kapitels prägnant darstellen.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist es, die Ursachen, die Feststellung und verschiedene Fördermöglichkeiten von Dyskalkulie zu beleuchten und ein umfassendes Verständnis der Problematik sowie Hilfestellungen für betroffene Kinder zu bieten.
- Citar trabajo
- Diplom Sozialpädagoge Alexander Bauer (Autor), 2006, Dyskalkulie - Ursachen, Feststellung und Hilfen für Kinder mit Rechenschwäche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118931