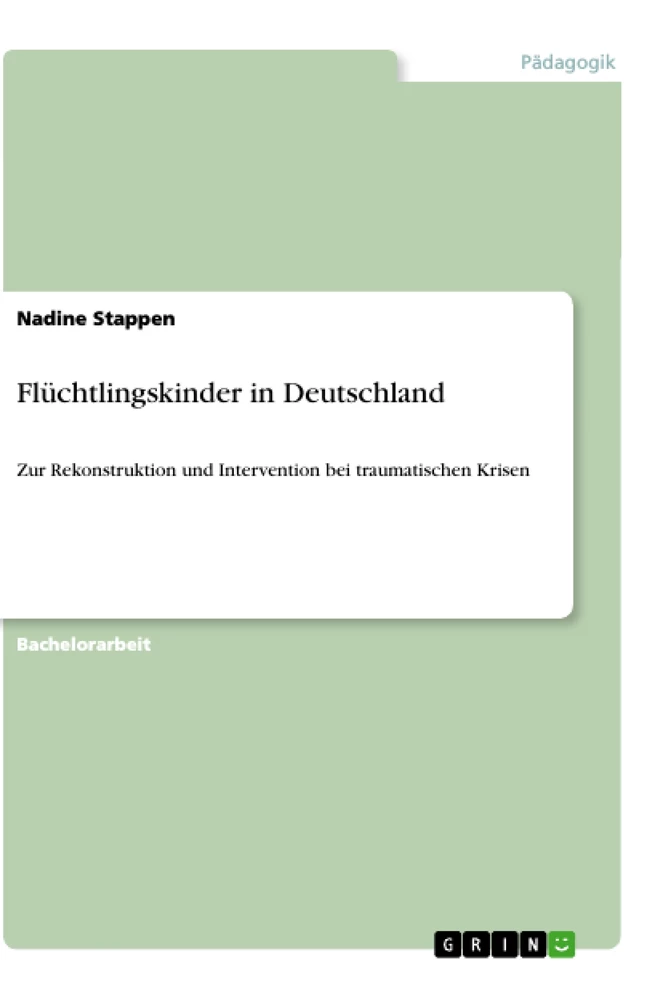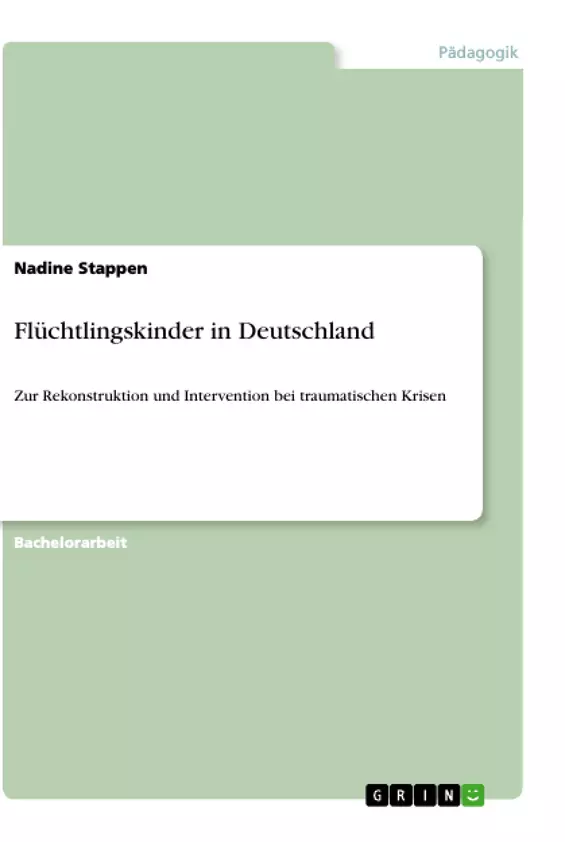Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt das Thema der Flüchtlingskinder in Deutschland im Zusammenhang mit der Rekonstruktion und der Intervention von traumatischen Krisen.
Zuallererst wird die Thematik der Flüchtlingsbewegung in einen Kontext eingeordnet. Im zweiten Kapitel werden anschließend Eckdaten zur Flüchtlingsbewegung weltweit und in Deutschland genannt. Daraufhin werden Ursachen für die Flucht beschrieben, um danach die Beweggründe zur Flucht speziell auf Kinder zu beziehen.
Im dritten Kapitel wird die Rekonstruktion traumatischer Krisen näher erläutert. Vor der Definition der Traumatisierungskrise wird diese in einen Zusammenhang gebracht. Dies soll Kenntnisse erbringen, warum einige Situationen, beispielsweise Kriegserlebnisse mit anschließender Flucht, eine Krise auslösen und einige im Gegensatz dazu nicht. Dieses Verständnis wird dem des Medizinischen gegenübergestellt, weil dadurch der pädagogische Blickwinkel in den Vordergrund gerückt werden kann. Im vierten Kapitel wird beschrieben, wie eine Krise entsteht. Daraufhin wird die Flucht mit der Traumatisierung in Verbindung gesetzt. Was für Symptome die Erlebnisse der Flucht bei den Flüchtlingskindern auslösen sowie, welche die Auswirkungen von Traumata daraus resultieren, werden beschrieben.
Das fünfte Kapitel thematisiert das Ausmaß von Traumata und inwieweit Ereignis, Risiko-, und Schutzfaktoren diese beeinflussen. Das sechste Kapitel bezieht sich auf die traumapädagogische Intervention von Traumatisierungskrisen. Zunächst wird der Begriff der Traumapädagogik näher betrachtet, wobei auf spezielle Ziele und Aufgaben eingegangen wird. Danach wird demonstriert, welche Ziele und Aufgaben sich die Traumapädagogik im Hinblick auf die Flüchtlingskinder setzt, was gleichermaßen die Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Therapie mit diesen Kindern zum Ausdruck bringt. Das siebte Kapitel schildert die drei Phasen der traumapädagogischen Therapie. Im achten und abschließenden Kapitel werden verschiedene Konzepte der Traumapädagogik dargelegt, die zur Krisenbewältigung bei Flüchtlingskindern nützlich sind. Die Arbeit fasst abschließend die wichtigsten Erkenntnisse in einem Fazit zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zahlen und Fakten zur Flucht in Deutschland
- 2.1 Gründe der Flucht
- 2.2 Fluchtursachen der Kinder
- 3. Rekonstruktion traumatischer Krisen
- 3.1 Definition der Lebenspraxis
- 3.2 Definition der Routine
- 3.3 Definition der Traumatisierungskrise
- 3.4 Medizinisches Verständnis von Traumata
- 4. Entstehung einer Krise
- 4.1 Flucht als Grund von Traumatisierung
- 4.2 Sequentielle Traumatisierung
- 4.3 Traumata-Symptome
- 4.4 Auswirkungen von Traumata
- 4.5 Das Ausmaß von Traumata und die Einflussfaktoren
- 5. Intervention
- 5.1 Definition der Traumapädagogik
- 5.2 Ziele und Aufgaben der Traumapädagogik
- 5.3 Ziele auf Aufgaben der Traumapädagogik bei Flüchtlingskindern
- 5.4 Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Therapie mit Flüchtlingskindern
- 6. Konzepte und die Phasen der Traumapädagogik
- 6.1 Rolle der Bindungsbeziehung
- 6.2 Voraussetzung für einen Bindungsaufbau
- 6.3 Kriterien einer sicheren Bindung in Bezug auf Flüchtlingskinder
- 6.4 Die drei Säulen in der traumapädagogischen Praxis
- 6.4.1 Pädagogik, des sicheren Ortes'
- 6.4.2,Der emotional orientierte Dialog'
- 6.4.3, Der geschützte Handlungsraum'
- 6.5 Interkulturelle Pädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel, die Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland im Kontext traumatischer Krisen zu beleuchten. Sie untersucht sowohl die Rekonstruktion der Traumatisierung als auch die Intervention durch Traumapädagogik.
- Rekonstruktion traumatischer Krisen bei Flüchtlingskindern
- Einflussfaktoren und Auswirkungen von Traumata auf die Entwicklung von Kindern
- Anwendungen und Methoden der Traumapädagogik
- Ziele und Herausforderungen der Traumapädagogik bei Flüchtlingskindern
- Sicherung eines geschützten und unterstützenden Umfelds für traumatisierte Flüchtlingskinder
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Thematik der Flüchtlingskinder in Deutschland vor und verdeutlicht die Bedeutung der Unterstützung dieser Kinder. Kapitel 2 beleuchtet die Fluchtbewegung weltweit und in Deutschland sowie die Gründe und Ursachen der Flucht, insbesondere für Kinder. Kapitel 3 befasst sich mit der Rekonstruktion traumatischer Krisen, definiert die Lebenspraxis, Routine und Traumatisierungskrise und erläutert das medizinische Verständnis von Traumata. Kapitel 4 untersucht die Entstehung einer Krise, wobei die Flucht als Grund von Traumatisierung, die sequentielle Traumatisierung, die Symptome und Auswirkungen sowie das Ausmaß von Traumata und Einflussfaktoren betrachtet werden. Kapitel 5 widmet sich der Intervention durch Traumapädagogik, definiert diese, erläutert ihre Ziele und Aufgaben sowie deren Anwendung bei Flüchtlingskindern und beleuchtet die Besonderheiten und Schwierigkeiten der Therapie. Kapitel 6 behandelt Konzepte und Phasen der Traumapädagogik, einschließlich der Rolle der Bindungsbeziehung, der Voraussetzungen für einen Bindungsaufbau, Kriterien einer sicheren Bindung bei Flüchtlingskindern, die drei Säulen der traumapädagogischen Praxis und die Interkulturelle Pädagogik.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Themen Flucht, Traumatisierung, Traumapädagogik, Flüchtlingskinder, Intervention, Bindungsbeziehung und Interkulturelle Pädagogik. Die Untersuchung beinhaltet die Rekonstruktion traumatischer Krisen und die Herausforderungen bei der Betreuung und Unterstützung traumatisierter Flüchtlingskinder.
Häufig gestellte Fragen
Welche Themen behandelt die Bachelorarbeit über Flüchtlingskinder?
Die Arbeit befasst sich mit der Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland, insbesondere mit der Rekonstruktion traumatischer Krisen und traumapädagogischen Interventionen.
Was versteht man unter einer Traumatisierungskrise bei Kindern?
Es handelt sich um eine Krise, die durch traumatische Erlebnisse wie Krieg und Flucht ausgelöst wird und die normale Lebenspraxis und Routine der Kinder massiv stört.
Welche Ziele verfolgt die Traumapädagogik?
Die Traumapädagogik zielt darauf ab, Kindern einen „sicheren Ort“ zu bieten, ihre Selbstwirksamkeit zu stärken und sie bei der Bewältigung ihrer traumatischen Erfahrungen zu unterstützen.
Warum ist die Bindungsbeziehung für traumatisierte Flüchtlingskinder so wichtig?
Eine sichere Bindung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie und Entwicklung. Sie bietet den Kindern den nötigen emotionalen Halt, um Erlebtes zu verarbeiten.
Was sind die „drei Säulen“ der traumapädagogischen Praxis?
Die drei Säulen umfassen die Pädagogik des sicheren Ortes, den emotional orientierten Dialog und den geschützten Handlungsraum.
- Citation du texte
- Nadine Stappen (Auteur), 2017, Flüchtlingskinder in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189487