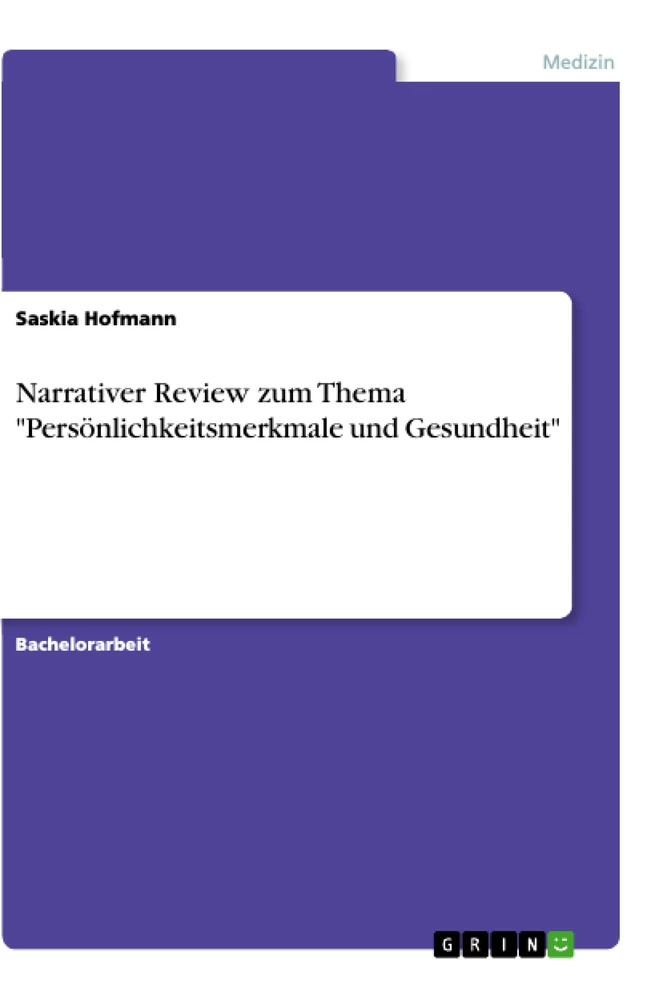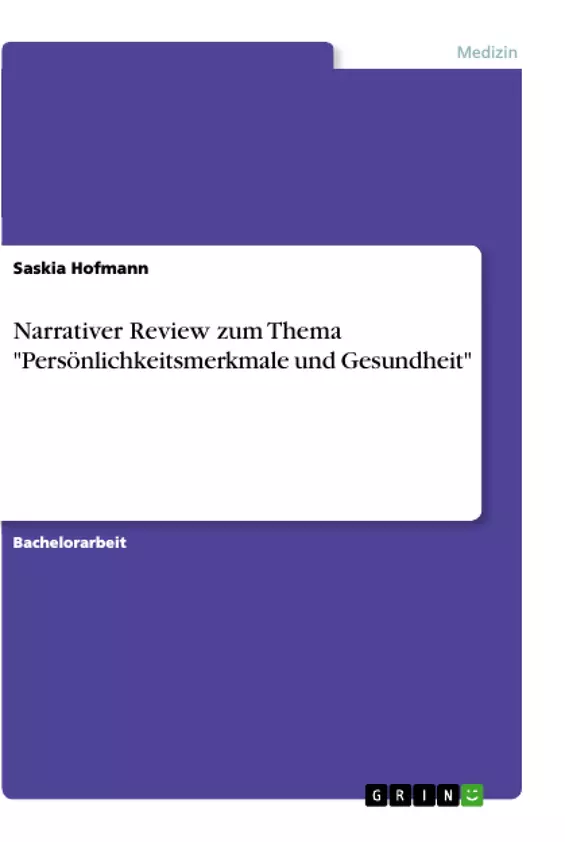Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, anhand ausgewählter wissenschaftlicher Literaturbeiträge herauszuarbeiten, inwieweit sich bestimmte Persönlichkeitsstrukturen und Eigenschaftskonstellationen des Menschen durch Faktoren des Erlebens und Verhaltens auf die Erhaltung der Gesundheit und die Entstehung von Krankheiten auswirken.
Es wird aufgezeigt, welche Persönlichkeitseigenschaften sowie Merkmalkonstellationen es gibt, die eine robuste Gesundheit bedingen und welche zu bestimmten Krankheiten disponieren.
Die aufgestellte Hypothese wird dargestellt und darauffolgend mithilfe wissenschaftlicher Studien bestätigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- 2 ZIELSETZUNG
- 3 GEGENWÄRTIGER KENNTNISSTAND
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 3.1.1 Definition: Gesundheit
- 3.1.2 Definition: Persönlichkeit und Persönlichkeitsmerkmale
- 3.1.3 Persönlichkeitsmerkmale und Gesundheit
- 3.2 Modelle der Persönlichkeitspsychologie
- 3.2.1 Kohlmann's Modell (2003) der Persönlichkeitsmerkmale
- 3.2.2 ,,Big Five\" der Persönlichkeit
- 3.3 Gesundheitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale
- 3.3.1 Überzeugungen und Erwartungen
- 3.3.2 Emotionalität
- 3.3.3 Typenmodelle
- 3.4 Resilienz
- 3.4.1 Resilienzforschung
- 3.4.2 Resilienz als Personeneigenschaft
- 3.4.3 Resilienz als Personen-Umwelt-Konstellation
- 3.5 ,,Sensation Seeking“
- 3.5.1 Risikoverhalten
- 3.5.2 ,,Sensation Seeking“ als Determinante von Risikoverhalten
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 4 METHODIK
- 4.1 Forschungsfrage
- 4.2 Untersuchungsobjekte
- 4.3 Datenerhebung
- 4.4 Auswertung der Literaturquellen
- 5 ERGEBNISSE
- 6 DISKUSSION
- 7 ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit verfolgt das Ziel, anhand wissenschaftlicher Literatur zu beleuchten, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale und -konstellationen einen Einfluss auf den Gesundheitszustand und die Entstehung von Krankheiten haben. Dazu werden verschiedene Modelle der Persönlichkeitspsychologie und relevante Persönlichkeitsmerkmale untersucht, die für die Gesundheit von Bedeutung sind.
- Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf Gesundheit und Krankheit
- Analyse verschiedener Modelle der Persönlichkeitspsychologie
- Bedeutung von Resilienz und "Sensation Seeking" für die Gesundheit
- Zusammenhang zwischen Überzeugungen, Erwartungen und Emotionalität
- Identifizierung von Persönlichkeitsmerkmalen, die zu einer robusten Gesundheit beitragen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und Problemstellung, in der die Komplexität des Begriffs "Gesundheit" und die Bedeutung des Zusammenspiels zwischen psychischen und somatischen Aspekten erläutert werden. Anschließend wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt, welche darin besteht, den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf den Gesundheitszustand zu untersuchen.
Das Kapitel "Gegenwärtiger Kenntnisstand" stellt die theoretischen Grundlagen dar, indem es die Begriffe "Gesundheit" und "Persönlichkeit" definiert und verschiedene Modelle der Persönlichkeitspsychologie beleuchtet, darunter Kohlmanns Modell und die "Big Five". Darüber hinaus werden gesundheitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale wie Überzeugungen, Erwartungen und Emotionalität, sowie die Konzepte der Resilienz und "Sensation Seeking" näher betrachtet.
Das Kapitel "Methodik" beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit, die Forschungsfrage, die Untersuchungsobjekte, die Datenerhebung und die Auswertung der Literaturquellen.
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche und beleuchtet die Ergebnisse verschiedener Studien zum Thema Persönlichkeitsmerkmale und Gesundheit.
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse, einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Persönlichkeitsmerkmale, Gesundheit, Krankheit, Persönlichkeitspsychologie, Resilienz, "Sensation Seeking", Überzeugungen, Erwartungen, Emotionalität, Risikoverhalten, wissenschaftliche Literatur, Forschungsfrage, Datenerhebung, Auswertung.
- Arbeit zitieren
- Saskia Hofmann (Autor:in), 2016, Narrativer Review zum Thema "Persönlichkeitsmerkmale und Gesundheit", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189648