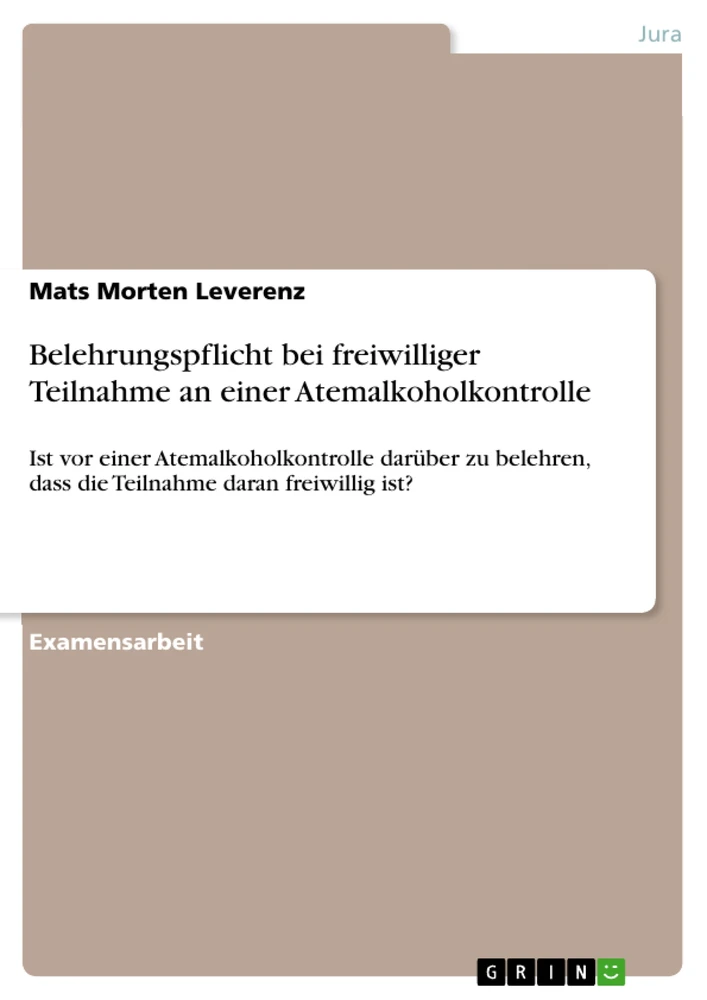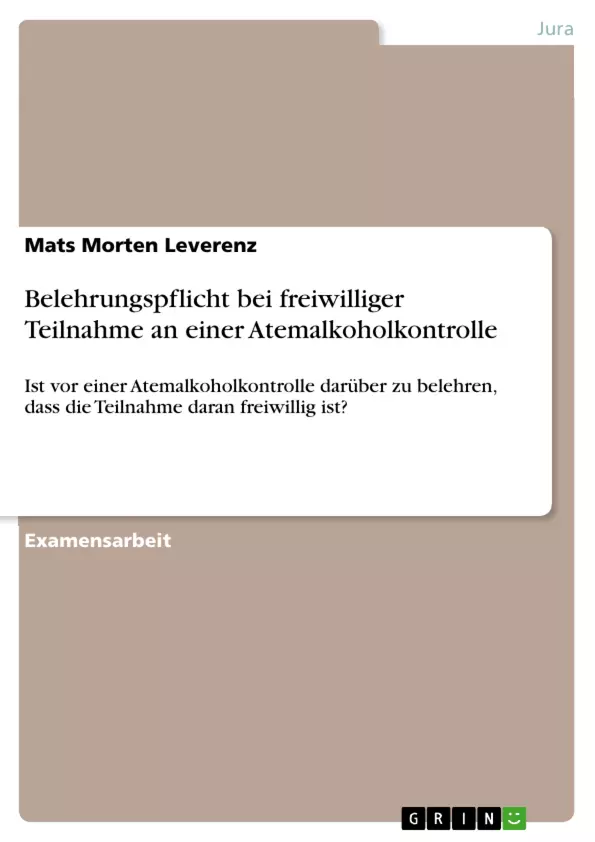In der Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob de lege lata vor einer Atemalkoholkontrolle über die Freiwilligkeit der Teilnahme zu belehren ist. Um die Tragweite der Beurteilung einordnen zu können, wird im Anschluss daran erörtert, ob eine rechtswidrige Atemalkoholmessung Beweisverwertungsverbote nach sich zieht. Diesen Fragenkomplexen soll zur Orientierung ein chronologischer Überblick über die bisherige Diskussion vorangestellt werden.
Atemalkoholkontrollen sind freiwillig. Eine Pflicht zur Belehrung über die Freiwilligkeit ist gesetzlich nicht geregelt. Gleichwohl sprechen zwingende Gründe für eine Belehrungspflicht über die Freiwilligkeit bei Atemalkoholkontrollen.
Selbst wenn die Ermittlungsbehörden dem Belehrungserfordernis nachkommen, bleibt zu berücksichtigen, dass Atemalkoholkontrollen de lege lata datenschutzrechtswidrig sind. Wünschenswert wäre es, wenn der Gesetzgeber mit einer konkreten gesetzlichen Vorschrift die Möglichkeit der Einwilligung in eine Datenerhebung durch Atemalkoholkontrollen ausdrücklich regeln würde, um diese im Vergleich zur Blutentnahme körperlich weniger eingriffsintensive Praxis wieder zu legalisieren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Entwicklung der Diskussion
- C. Praktische Relevanz der Atemalkoholkontrolle
- D. Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Atemalkoholkontrolle
- I. Selbstbelastungsfreiheit
- II. Mangelnde gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
- E. Belehrungspflicht über die Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle
- I. Innerministerielle Richtlinien zur Belehrung bei Atemalkoholkontrollen
- II. Systematische Folgerungen aus § 81a StPO
- 1. Einwilligung in eine Blutentnahme
- a) Qualitative Anforderungen an die Freiwilligkeit
- b) Ansätze zur Einschränkung der Belehrungspflicht
- 2. Rückschlüsse für die Einwilligung in eine Atemalkoholkontrolle
- 3. Zwischenergebnis
- 1. Einwilligung in eine Blutentnahme
- III. Analogie zu § 136 I 2 StPO
- 1. Planwidrige Regelungslücke
- a) Ausdrückliche Regelung von Belehrungspflichten in besonderen Fällen
- b) Bewusste Beschränkung der Belehrungspflichten auf die Aussagefreiheit
- 2. Vergleichbare Interessenlage
- a) Belehrung in Vernehmungssituationen
- b) Belehrung des Beschuldigten
- c) Belehrung über die Aussagefreiheit
- 3. Zwischenergebnis
- 1. Planwidrige Regelungslücke
- IV. Wertungen des Nemo-tenetur-Prinzips und des Fair-trial-Grundsatzes
- V. Datenschutzrechtliche Anforderungen an Atemalkoholkontrollen
- 1. Richtlinie (EU) 2016/680
- 2. Deutsche Umsetzung im 3. Teil des BDSG
- a) Datenschutzrechtliche Vorgaben an eine Einwilligung
- b) Zulassung der Einwilligung durch eine Rechtsvorschrift
- 3. Zwischenergebnis
- VI. Ergebnis
- F. Beweisverwertungsverbote bei einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung
- I. Verwertbarkeit der Atemalkoholmessung
- 1. Absolutes Beweisverwertungsverbot nach § 136a III 2 StPO
- 2. Relatives Beweisverwertungsverbot nach der Abwägungslehre
- a) Beweisverwertungsverbot bei ordnungsgemäßer Belehrung
- b) Beweisverwertungsverbot bei unterlassener Belehrung
- II. Fernwirkung einer unverwertbaren Atemalkoholmessung
- I. Verwertbarkeit der Atemalkoholmessung
- G. Gesamtergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die Frage der Belehrungspflicht vor einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen und die praktische Relevanz dieser Thematik zu beleuchten und die bestehenden Rechtsauffassungen kritisch zu analysieren.
- Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle und ihre Grenzen
- Rechtliche Anforderungen an eine wirksame Belehrung
- Relevanz des Nemo-tenetur-Prinzips und des Fair-trial-Grundsatzes
- Datenschutzrechtliche Aspekte der Atemalkoholkontrolle
- Folgen einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Belehrungspflicht bei freiwilligen Atemalkoholkontrollen ein und skizziert den Forschungsstand und die Fragestellung der Arbeit. Sie benennt die zentrale Problematik der Abgrenzung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Beteiligung an der Kontrolle und die damit verbundenen rechtlichen Implikationen.
B. Entwicklung der Diskussion: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Rechtsprechung und der Diskussion um die Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle. Es analysiert die verschiedenen Argumentationslinien und die sich daraus ergebenden Rechtsauffassungen.
C. Praktische Relevanz der Atemalkoholkontrolle: Der Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Atemalkoholkontrolle im Strafverfahren und im Kontext der Verkehrssicherheit. Es werden die praktischen Herausforderungen und die Notwendigkeit einer klaren rechtlichen Regelung diskutiert. Die häufigkeit der Anwendung und die möglichen Konsequenzen einer falsch durchgeführten oder ausgewerteten Messung werden erläutert.
D. Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Atemalkoholkontrolle: Dieses Kapitel untersucht die Frage der Freiwilligkeit im Detail. Es analysiert den Begriff der Selbstbelastungsfreiheit und die mangelnde gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für bestimmte Aspekte der Kontrolle.
E. Belehrungspflicht über die Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle: Das Kernstück der Arbeit analysiert die Belehrungspflicht. Es untersucht innerministerielle Richtlinien, systematische Folgerungen aus § 81a StPO, Analogien zu § 136 I 2 StPO, sowie die Wertungen des Nemo-tenetur-Prinzips und des Fair-trial-Grundsatzes. Der Abschnitt untersucht die Anforderungen an eine wirksame Einwilligung, die Bedeutung der Informationspflicht und die Folgen einer fehlerhaften Belehrung.
F. Beweisverwertungsverbote bei einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung und den damit verbundenen Beweisverwertungsverboten. Es differenziert zwischen absoluten und relativen Verwertungsverboten und analysiert deren Auswirkungen auf das Strafverfahren. Die möglichen Rechtsmittel und die praktische Relevanz der verschiedenen Beweisverwertungsverbote werden erläutert.
Schlüsselwörter
Atemalkoholkontrolle, Freiwilligkeit, Belehrungspflicht, § 81a StPO, Nemo-tenetur-Prinzip, Fair-trial-Grundsatz, Beweisverwertungsverbot, Datenschutz, Einwilligung.
Häufig gestellte Fragen zur Examensarbeit: Belehrungspflicht bei freiwilligen Atemalkoholkontrollen
Was ist der Gegenstand dieser Examensarbeit?
Die Examensarbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und die praktische Relevanz der Belehrungspflicht vor einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle. Sie analysiert die Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle, die Anforderungen an eine wirksame Belehrung, die Relevanz des Nemo-tenetur-Prinzips und des Fair-trial-Grundsatzes, datenschutzrechtliche Aspekte und die Folgen einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die rechtlichen Grundlagen der Belehrungspflicht bei freiwilligen Atemalkoholkontrollen zu beleuchten, die bestehenden Rechtsauffassungen kritisch zu analysieren und die praktische Relevanz dieser Thematik aufzuzeigen. Es geht darum, die Abgrenzung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Beteiligung an der Kontrolle und die damit verbundenen rechtlichen Implikationen zu klären.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle und ihre Grenzen, rechtliche Anforderungen an eine wirksame Belehrung, Relevanz des Nemo-tenetur-Prinzips und des Fair-trial-Grundsatzes, datenschutzrechtliche Aspekte der Atemalkoholkontrolle und Folgen einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Entwicklung der Diskussion, Praktische Relevanz der Atemalkoholkontrolle, Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Atemalkoholkontrolle, Belehrungspflicht über die Freiwilligkeit der Atemalkoholkontrolle, Beweisverwertungsverbote bei einer rechtswidrigen Atemalkoholmessung und Gesamtergebnis. Kapitel E (Belehrungspflicht) bildet dabei den Kern der Arbeit.
Welche Rechtsgrundlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem § 81a StPO, § 136 I 2 StPO, innerministerielle Richtlinien zur Belehrung bei Atemalkoholkontrollen, Richtlinie (EU) 2016/680 und die deutsche Umsetzung im 3. Teil des BDSG. Sie analysiert das Nemo-tenetur-Prinzip und den Fair-trial-Grundsatz.
Welche Konsequenzen hat eine rechtswidrige Atemalkoholmessung?
Eine rechtswidrige Atemalkoholmessung kann zu Beweisverwertungsverboten führen. Die Arbeit unterscheidet zwischen absoluten und relativen Verwertungsverboten nach § 136a III 2 StPO und der Abwägungslehre. Die Folgen hängen von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere davon, ob eine ordnungsgemäße Belehrung erfolgt ist.
Welche Rolle spielt der Datenschutz?
Die Arbeit berücksichtigt die datenschutzrechtlichen Anforderungen an Atemalkoholkontrollen, insbesondere die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 und der deutschen Umsetzung im BDSG. Sie untersucht die datenschutzrechtlichen Vorgaben an eine Einwilligung und die Zulassung der Einwilligung durch eine Rechtsvorschrift.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
(Das konkrete Ergebnis muss aus der vollständigen Arbeit entnommen werden. Die Zusammenfassung enthält nur eine Übersicht der behandelten Themen.)
- Citar trabajo
- Mats Morten Leverenz (Autor), 2020, Belehrungspflicht bei freiwilliger Teilnahme an einer Atemalkoholkontrolle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189807