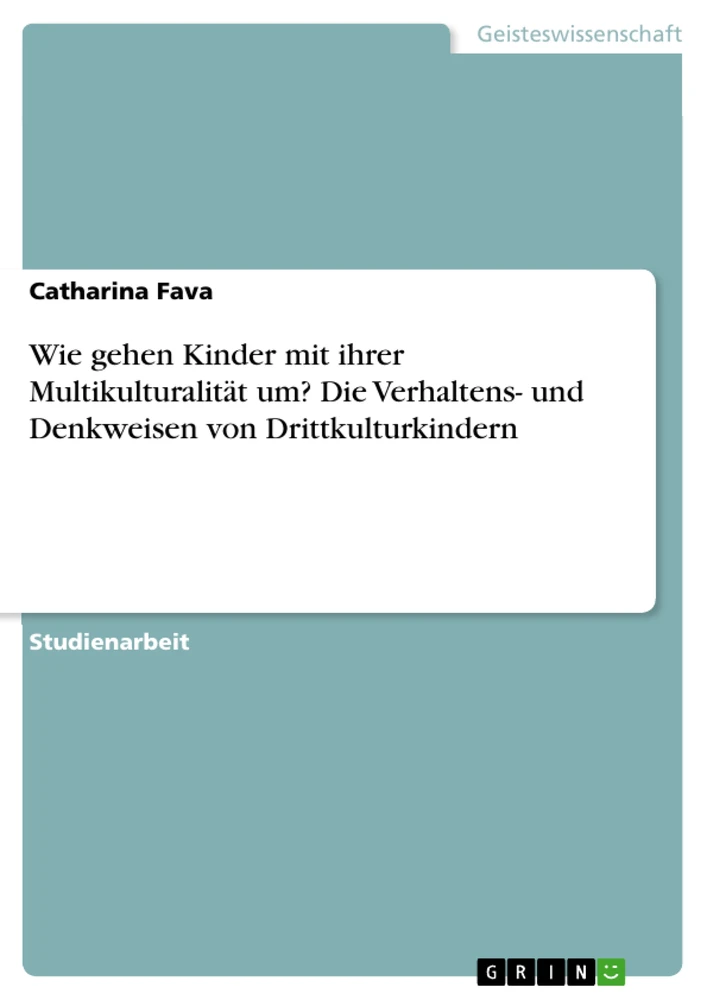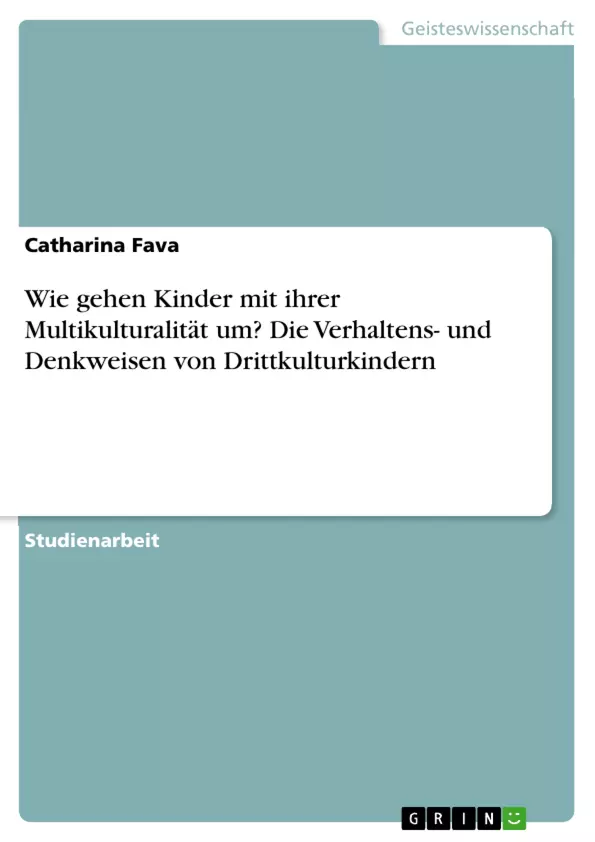Im Zuge der Globalisierung steigt die internationale Mobilität ständig an. In der Folge leben auch immer mehr Kinder in einem Land, in dem sie nicht geboren wurden, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen oder in dem ihre Eltern nicht geboren wurden. Die zunehmende Migration kann einerseits zu kultureller Entwurzelung führen, andererseits bietet sie auch Chancen für interkulturelle Kompetenz. Solche Kinder werden als Drittkulturkinder (in der englischsprachigen Literatur Third Culture Kids) bezeichnet.
In meiner Arbeit untersuche ich die Verhaltens- und Denkweisen von Drittkulturkinder und beschreibe, wie die Kinder mit ihrer Multikulturalität umgehen. Da ich als gebürtige Dänin seit fast zehn Jahren in der Schweiz wohne, beschäftigt mich dieses Thema sehr, weil ich täglich damit in Berührung komme.
Meine Arbeit geht vier Fragestellungen nach, die ein besseres Verständnis für das Leben der Drittkulturkinder liefern sollten. Dabei beschäftige ich mich in der Arbeit mit dem Ethnozentrismus und dem Ethnorelativismus von Drittkulturkindern, wobei der Vergleich zu nicht-Drittkulturkindern ebenfalls eine Rolle spielt. Die ethnozentrische beziehungsweise ethnorelativistische Denkweise der Drittkulturkinder gibt ein Bild ihrer kulturelle Wahrnehmung. Eine hochmobile Kindheit kann zu Wurzellosigkeit führen, was ein erschwertes Verständnis der Kinder für ihre Herkunft und Kultur b-wirken kann. Ich frage mich deswegen zusätzlich in dieser Arbeit, in welchem Land sich Drittkulturkinder am meisten zu Hause und mit welchem Land sie sich am meisten verbunden fühlen. Ihr Gefühl von Zuhause kann möglicherweise mit ihrem Freundeskreis zu tun haben, weshalb ich weiterführend der Frage nachgehe, mit welche Gruppe von Kindern Drittkulturkinder ihre Freizeit verbringen. Geben sie sich mit den lokalen Kindern des Gastlandes ab? Suchen sie sich Freundinnen und Freunde aus ihrem Heimatland, die ebenfalls ihre Muttersprache sprechen? Oder verbringen sie ihre Freizeit mit anderen Drittkulturkindern?
Letztlich beschäftige ich mich mit der Offenheit der Drittkulturkinder und ob diese mit der Offenheit der nicht-Drittkulturkinder zu vergleichen ist. Dadurch, dass Drittkulturkinder ein so vielfältiges Leben führen mit täglichen Eindrücken kultureller Unterschiede, ist eine allgemeine offenere Weltsicht denkbar.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- LITERATURÜBERBLICK
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Drittkulturkinder
- Interkulturelle Kompetenz
- Verstecken, Ablehnung und Wurzellosigkeit
- Ethnozentrismus und Ethnorelativismus
- Ethnozentrismus
- Ethnorelativismus
- Modelle der interkulturellen Kompetenz
- Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS)
- Intercultural Development Inventory (IDI)
- METHODIK
- Definition von Drittkulturkindern
- Fragestellungen
- Ethnozentrismus und Ethnorelativismus
- Das Gefühl von Zuhause
- Das soziale Umfeld
- Offenheit und Neugier
- Durchführung der Umfrage
- ERGEBNISSE
- Ethnozentrismus und Ethnorelativismus unter Drittkulturkindern
- Das Wohlbefinden von Drittkulturkindern
- Das soziale Umfeld von Drittkulturkindern
- Neue Kulturen kennenlernen und fremde Länder bereisen
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verhaltens- und Denkweisen von Drittkulturkindern und beleuchtet, wie sie mit ihrer Multikulturalität umgehen. Sie verfolgt das Ziel, ein tieferes Verständnis für die Erfahrungen und Herausforderungen dieser Kinder zu gewinnen.
- Ethnozentrismus und Ethnorelativismus von Drittkulturkindern
- Das Gefühl von Zuhause und die Verbindung zu verschiedenen Kulturen
- Das soziale Umfeld von Drittkulturkindern und ihre Freundschaftsbeziehungen
- Offenheit und Neugier von Drittkulturkindern im Vergleich zu nicht-Drittkulturkindern
- Die Auswirkungen von Multikulturalität auf die Entwicklung von interkultureller Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, nämlich die Verhaltens- und Denkweisen von Drittkulturkindern. Sie skizziert die wachsende Bedeutung dieses Themas im Zuge der Globalisierung und Migration und erläutert die vier zentralen Fragestellungen, die die Arbeit beleuchtet.
- Literaturüberblick: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die bisherige Forschung zu Drittkulturkindern. Es werden verschiedene Studien und Publikationen zu Themen wie Wohlbefinden, Ethnozentrismus und Ethnorelativismus sowie interkulturelle Kompetenz vorgestellt.
- Theoretische Grundlagen: In diesem Kapitel werden die wichtigsten theoretischen Konzepte, die für die Arbeit relevant sind, genauer erläutert. Dazu zählen die Definition von Drittkulturkindern, interkulturelle Kompetenz, Ethnozentrismus, Ethnorelativismus und verschiedene Modelle der interkulturellen Kompetenzentwicklung.
- Methodik: Das Kapitel erläutert die Methodik der Arbeit. Es beschreibt die Definition von Drittkulturkindern, die vier zentralen Fragestellungen, die in der Arbeit untersucht werden, sowie die Durchführung der Umfrage, die als Grundlage für die Auswertung dient.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Umfrage. Es werden die Ergebnisse zu den vier zentralen Fragestellungen vorgestellt und analysiert. Es geht auf die Unterschiede in der Denkweise und dem sozialen Umfeld von Drittkulturkindern im Vergleich zu nicht-Drittkulturkindern ein.
Schlüsselwörter
Drittkulturkinder, interkulturelle Kompetenz, Ethnozentrismus, Ethnorelativismus, Multikulturalität, Globalisierung, Migration, soziale Integration, Wohlbefinden, Umfrage, Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind „Drittkulturkinder“ (Third Culture Kids)?
Es sind Kinder, die in einem Land aufwachsen, das weder das Geburtsland ihrer Eltern noch ihr eigenes Geburtsland ist, und dabei eine eigene, hybride Kultur entwickeln.
Was bedeutet Ethnozentrismus bei Drittkulturkindern?
Die Arbeit untersucht, ob diese Kinder eher dazu neigen, die eigene Kultur als Maßstab zu sehen (Ethnozentrismus) oder verschiedene Kulturen als gleichwertig zu betrachten (Ethnorelativismus).
Wo fühlen sich Drittkulturkinder am meisten zu Hause?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob das Gefühl von „Zuhause“ an ein Land, eine Sprache oder eher an den spezifischen Freundeskreis gebunden ist.
Wie sieht das soziale Umfeld dieser Kinder aus?
Es wird analysiert, ob sie eher Kontakt zu lokalen Kindern, Kindern aus ihrem Herkunftsland oder bevorzugt zu anderen Drittkulturkindern suchen.
Sind Drittkulturkinder offener gegenüber fremden Kulturen?
Die Arbeit vergleicht die Offenheit und Neugier von Drittkulturkindern mit Kindern, die in einer stabilen kulturellen Umgebung aufwachsen.
- Quote paper
- Catharina Fava (Author), 2021, Wie gehen Kinder mit ihrer Multikulturalität um? Die Verhaltens- und Denkweisen von Drittkulturkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190073