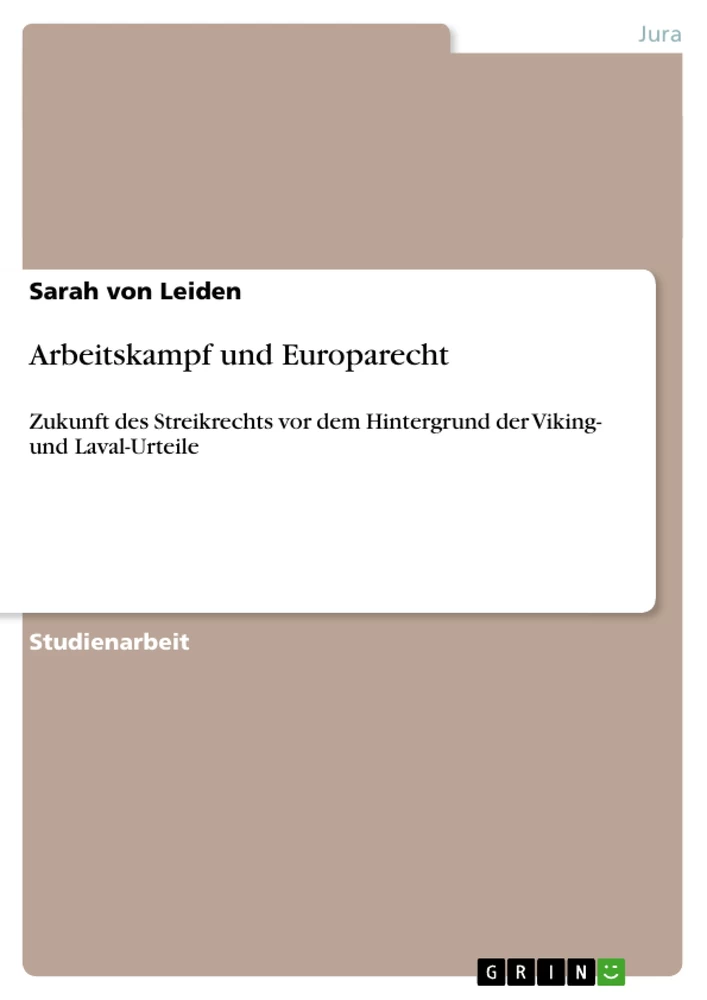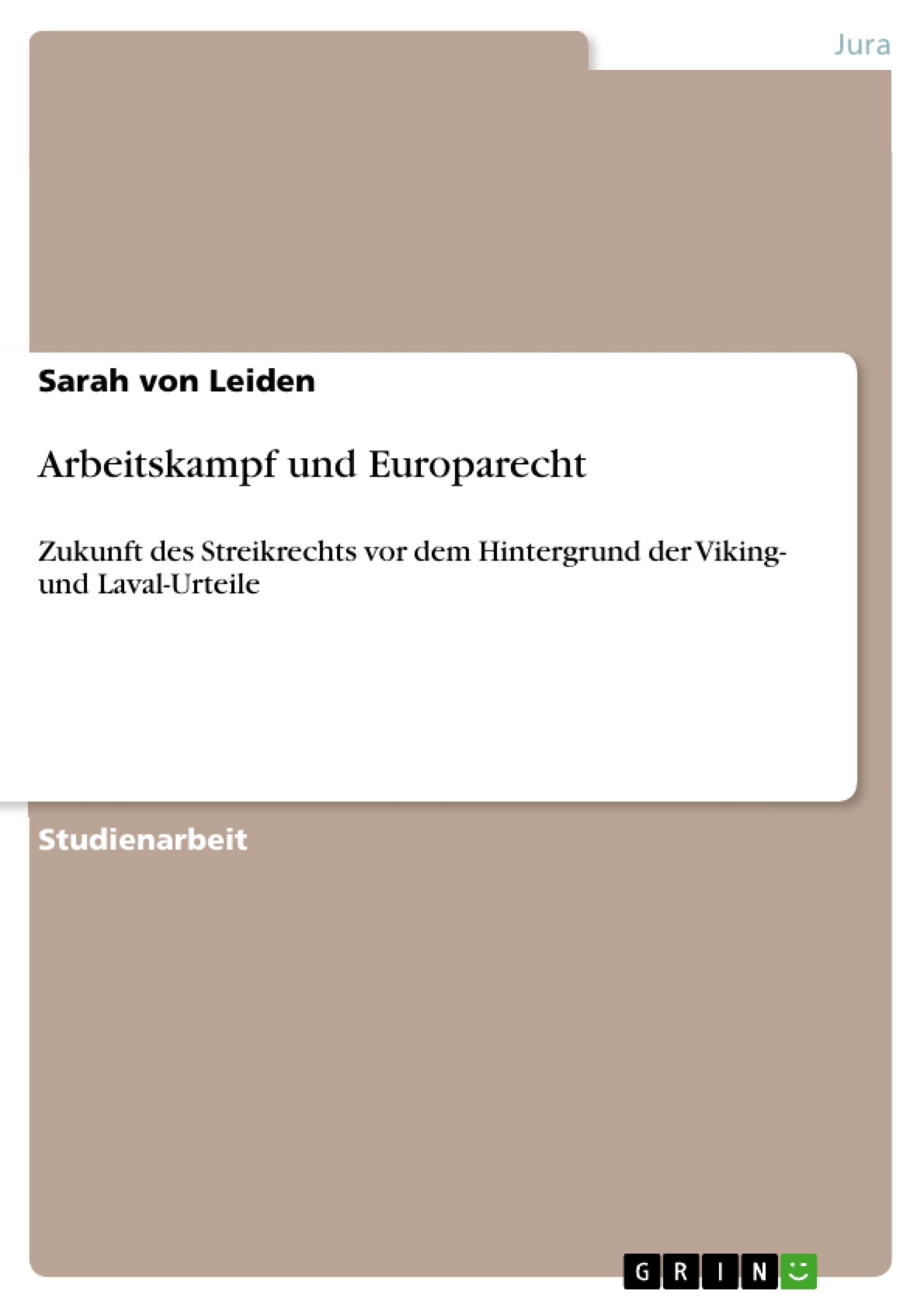Die neuere EuGH-Rechtsprechung im Bereich des Arbeitsrechts erhitzt die Gemüter.
Während die Urteile in der Vergangenheit oft auch von arbeitnehmernahen
Kreisen als Fortschritt verstanden wurden, haben die Streikrechtsentscheidungen
zu Viking und Laval, aber auch die Rüffert-Entscheidung zu scharfer
Kritik geführt. Die Gegner dieser Entscheidungen sehen darin zum einen nicht
weniger als einen Paradigmenwechsel. Insbesondere werden massive Auswirkungen
auf das im Laufe der Jahrzehnte durch die Rechtsprechung fein austarierte
deutsche Arbeitskampf befürchtet. Lagerübergreifend werden Bedenken
geäußert angesichts der Sprengkraft, die diese Rechtsprechung u. U. für die
deutsche Tariflandschaft mit sich bringt. Welche Konsequenzen sind für die Geltung
koalitionsrechtlicher Grundsätze auf lange Sicht zu erwarten, die sich immerhin
aus Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes ableiten lassen? Auch wenn sich
deshalb noch lange nicht alle zu skurrilen Vorschlägen verleiten lassen, wie
etwa der oben zitierte Fritz Scharpf, denken womöglich viele zumindest in eine
ähnliche Richtung.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand eines Rechtsprechungsvergleichs
aufzuarbeiten, inwieweit die Viking- und Laval-Urteile einen Paradigmenwechsel
gegenüber dem Arbeitskampfrecht deutscher Prägung bedeuten. In diesem
Rahmen wird notwendig auch das Verhältnis der sozialen zu den Marktgrundfreiheiten Gegenstand der Betrachtung sein, denn das war auch ein Ausgangspunkt
für das EuGH. Eine Prognose darüber, wie sich die beiden Entscheidungen
auf das Arbeitskampfgeschehen in der Bundesrepublik auswirken werden,
scheint naheliegend. Das in der Literatur bislang kaum jemand den Versuch unternimmt,
eine solche Voraussage zu wagen ist allerdings ebenso naheliegend
– die Rechtsprechung des EuGH ist im Moment noch zu unausgegoren und
konfus, um seriöserweise Voraussagen wagen zu können. Zu solchen Prognosen
kann es daher auch in der vorliegenden Arbeit nicht kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Kollektivverhandlungen nach Art. 137, 138 und 139 des EG-Vertrages (EGV)
- Ausgewählte Entscheidungen mit maßgeblicher Tragweite
- Das Viking-Urteil
- Das Laval-Urteil
- Überblick über das Arbeitskampfrecht des BAG
- Tarifautonomie als Kollektivgrundrecht
- Rechtmäßigkeit des Streiks
- Ausrichtung auf die tarifvertraglichen Ziele
- Rechtmäßigkeit des Unterstützungsstreiks
- Verbot der Tarifzensur
- Die „feinen Unterschiede“ – Eine kritische Beleuchtung der Viking- und Laval-Urteile
- Unausgewogener Eingriff in die Tarifautonomie
- Die Selbstermächtigung des EuGH
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen der Viking- und Laval-Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf das deutsche Arbeitskampfrecht. Im Vordergrund steht die Frage, ob diese Urteile einen Paradigmenwechsel im Vergleich zum etablierten Arbeitskampfrecht deutscher Prägung darstellen. Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis von sozialer und Marktfreiheit im Kontext der EuGH-Rechtsprechung und untersucht die Konsequenzen für die Geltung koalitionsrechtlicher Grundsätze, die sich aus Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes ableiten lassen.
- Bewertung der Auswirkungen der Viking- und Laval-Urteile auf das deutsche Arbeitskampfrecht
- Analyse des Verhältnisses von sozialer und Marktfreiheit im Kontext der EuGH-Rechtsprechung
- Untersuchung der Konsequenzen für die Geltung koalitionsrechtlicher Grundsätze
- Diskussion der Bedeutung der Tarifautonomie im deutschen Arbeitsrecht
- Einordnung der EuGH-Rechtsprechung in den Rahmen des deutschen Arbeitskampfrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Problematik der EuGH-Rechtsprechung im Bereich des Arbeitsrechts. Im zweiten Kapitel werden die relevanten Normen des EG-Vertrages (EGV) behandelt, die die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern auf EU-Ebene regeln. Das dritte Kapitel widmet sich den maßgeblichen Entscheidungen des EuGH, insbesondere den Urteilen zu Viking und Laval, und analysiert deren Auswirkungen auf das Arbeitskampfrecht. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über das Arbeitskampfrecht des Bundesarbeitsgerichts (BAG), insbesondere die Tarifautonomie als Kollektivgrundrecht und die Rechtmäßigkeit des Streiks. Im fünften Kapitel werden die Viking- und Laval-Urteile kritisch beleuchtet und ihre Auswirkungen auf die Tarifautonomie und die Rolle des EuGH diskutiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Arbeitskampfrecht, Tarifautonomie, Streikrecht, Viking-Urteil, Laval-Urteil, EuGH-Rechtsprechung, Sozialpartnerschaft, Marktfreiheit, Koalitionsrecht, Grundgesetz, Bundesarbeitsgericht.
Häufig gestellte Fragen
Was besagen die Viking- und Laval-Urteile des EuGH?
Diese Urteile schränken das Streikrecht ein, wenn es die wirtschaftlichen Grundfreiheiten (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit) im EU-Binnenmarkt beeinträchtigt. Sie fordern eine Verhältnismäßigkeitsprüfung von Arbeitskampfmaßnahmen.
Warum wird in Deutschland ein "Paradigmenwechsel" befürchtet?
Kritiker befürchten, dass die soziale Marktwirtschaft und das durch das Grundgesetz (Art. 9 Abs. 3) geschützte Streikrecht den Marktfreiheiten der EU untergeordnet werden könnten.
Welche Auswirkungen hat das Rüffert-Urteil?
Das Rüffert-Urteil besagt, dass öffentliche Auftraggeber ausländische Unternehmen nicht zwingen dürfen, ihren Mitarbeitern bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen den lokalen Tariflohn zu zahlen, sofern dieser nicht allgemeinverbindlich ist.
Was bedeutet Tarifautonomie im deutschen Recht?
Tarifautonomie ist das Recht von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, Arbeitsbedingungen eigenverantwortlich und ohne staatliche Einmischung in Tarifverträgen zu regeln.
Ist das Streikrecht in der EU absolut geschützt?
Nein, laut EuGH ist das Streikrecht zwar ein Grundrecht, muss aber gegen die wirtschaftlichen Grundfreiheiten abgewogen werden, was in der deutschen Rechtslehre auf scharfe Kritik stößt.
Was ist ein Unterstützungsstreik?
Ein Unterstützungsstreik (oder Solidaritätsstreik) dient dazu, den Arbeitskampf in einem anderen Betrieb zu unterstützen. Die Rechtmäßigkeit solcher Streiks wird durch die neue EU-Rechtsprechung kritisch hinterfragt.
- Citar trabajo
- Sarah von Leiden (Autor), 2007, Arbeitskampf und Europarecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119026