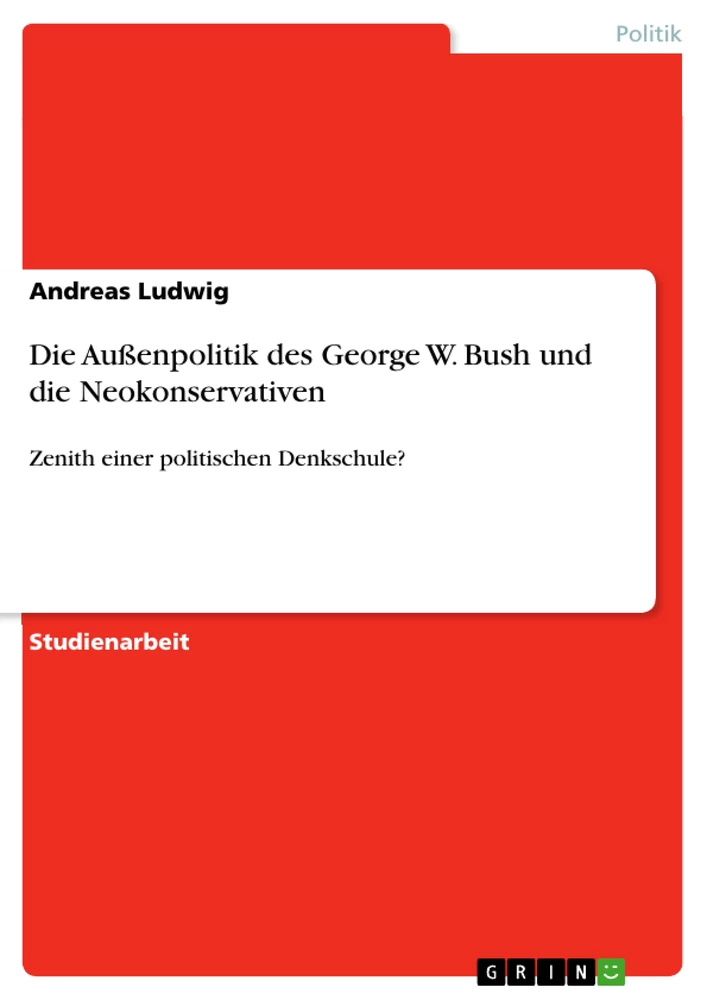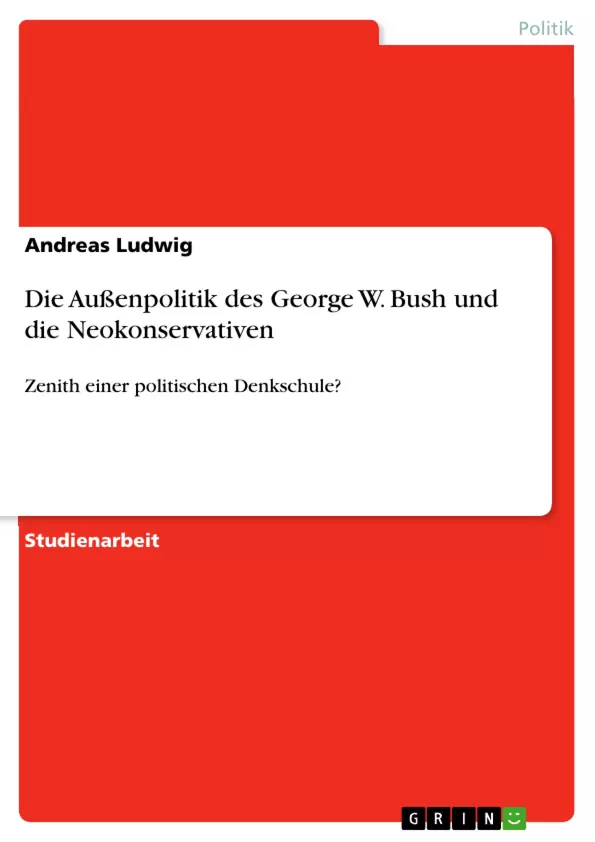“America can exercise power without arrogance and pursue its interests without hectoring and bluster. When it does so in concert with those who share its core values, the world becomes more prosperous, democratic, and peaceful. That has been America’s special role in the past,
and it should be again as we enter the next century.” Mit dieser Vision beendet Condoleezza RICE ihre Skizze einer künftigen republikanischen Außenpolitik im
Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2000, der sich als einer der ungewöhnlichsten der USGeschichte herausstellen sollte. Der äußerst knappe, daher umstrittene und erst durch Urteil des Supreme Court ermöglichte Sieg George W. BUSHS, hat in den Vereinigten Staaten und in aller Welt zu regen Debatten über die Legitimität und Befähigung des ehemaligen texanischen
Gouverneurs für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten geführt – gerade auch in außenpolitischen Fragen, in denen BUSH, wie vielen seiner Vorgänger, nachweislich die Erfahrung zu Beginn der Präsidentschaft fehlte.
Der Mangel an Legitimität durch des Fehlen eines „eindeutigen“ Votums der US-Amerikaner, gepaart mit dem großen Misstrauen gegenüber dem 4. Präsidenten der Vereinigten Staaten, gerade von europäischer Seite, tragen von Anbeginn der Administration zu schwierigen Beziehungen zwischen beiden Seiten des Atlantiks bei. Abgesehen von den Solidaritätsbekundungen der Europäer nach den Ereignissen des 11. September 2001, verharren die Beziehungen dauerhaft auf unterkühltem Niveau. Der Irak-Konflikt verschärft die gespannten Verhältnisse weiter. BUSHS Gegner, die den Präsidenten „von Anfang an für
einen geistig unterentwickelten, christlich-fundamentalistischen Eiferer“3 halten, sehen sich in dieser Ansicht mehr denn je bestätigt. Richard HERZINGER fängt diese negative Grundhaltung von Teilen der deutschen Öffentlichkeit mit einem angepassten Zitat von Margaret THATCHER am besten ein, wenn er schreibt: „Bush könnte morgen über das Wasser laufen, und alle würden sagen: „Wir wussten es, er kann nicht einmal schwimmen.“
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I. Der Beginn der Präsidentschaft - Berater und Prioritäten eines,accidental president'
- 1. Die „Vulcans“ – ein Kompetenzteam für den Präsidenten
- 2. Außenpolitische Schwerpunkte nach dem Amtsantritt
- II. Der 11. September 2001 - Wendepunkt der Präsidentschaft.
- 1. Die Bush-Doktrin - Außenpolitik nach 9/11
- 2. Hintergründe des neokonservativen Charakters der Doktrin
- III. Der Irak-Krieg - Zenith neokonservativer Macht?
- 1. Realisten vs. Neokonservatige - Widerstreit der Denkschulen.
- 2. Niedergang neokonservativer Dominanz in der Außenpolitik durch die Folgen des Krieges
- Abschlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Außenpolitik von George W. Bush und untersucht, inwieweit der Neokonservatismus in dieser Ära eine dominierende Rolle spielte. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der US-Außenpolitik von den ersten Tagen der Präsidentschaft bis hin zum Irak-Krieg. Es wird insbesondere untersucht, wie der 11. September 2001 die Außenpolitik der USA veränderte und welche Rolle der Neokonservatismus dabei spielte.
- Die Rolle des Neokonservatismus in der Außenpolitik von George W. Bush
- Die Auswirkungen des 11. Septembers 2001 auf die US-Außenpolitik
- Die Entstehung und Entwicklung der Bush-Doktrin
- Der Irak-Krieg und seine Folgen für die US-Außenpolitik
- Der Einfluss des Neokonservatismus auf die Strukturen der US-Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Kontext der Präsidentschaft von George W. Bush und die Bedeutung des Neokonservatismus für die US-Außenpolitik beleuchtet. Das erste Kapitel analysiert die personellen Strukturen des außenpolitischen Beraterstabes von George W. Bush und die ersten Schritte in der Außenpolitik nach den Wahlen im Jahr 2000. Das zweite Kapitel widmet sich den Auswirkungen des 11. Septembers 2001 auf die US-Außenpolitik und der Entstehung der Bush-Doktrin. Das dritte Kapitel untersucht den Einfluss des Neokonservatismus am Beginn des Irak-Krieges 2003 und die damit verbundenen Auseinandersetzungen und Folgen für die Strukturen der US-Außenpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenbereiche US-Außenpolitik, Neokonservatismus, George W. Bush, 11. September 2001, Bush-Doktrin, Irak-Krieg, Realismus, Denkschulen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatten die Neokonservativen auf George W. Bush?
Die Neokonservativen spielten eine dominierende Rolle in der Gestaltung der US-Außenpolitik, insbesondere nach dem 11. September 2001.
Was war der Wendepunkt in der Außenpolitik von Bush?
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 markierten den entscheidenden Wendepunkt und führten zur Entwicklung der sogenannten Bush-Doktrin.
Wer waren die „Vulcans“?
Die „Vulcans“ waren ein außenpolitisches Kompetenzteam von Beratern, die Bush bereits während des Wahlkampfes und nach seinem Amtsantritt unterstützten.
Wie veränderte der Irak-Krieg die Macht der Neokonservativen?
Während der Irak-Krieg zunächst als Zenith neokonservativer Macht galt, führten die Folgen des Krieges langfristig zu einem Niedergang ihrer Dominanz.
Welche Rolle spielte Condoleezza Rice in diesem Kontext?
Rice skizzierte bereits im Wahlkampf 2000 die Vision einer künftigen republikanischen Außenpolitik und war eine zentrale Figur in Bushs Beraterstab.
- Citar trabajo
- Andreas Ludwig (Autor), 2008, Die Außenpolitik des George W. Bush und die Neokonservativen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119042