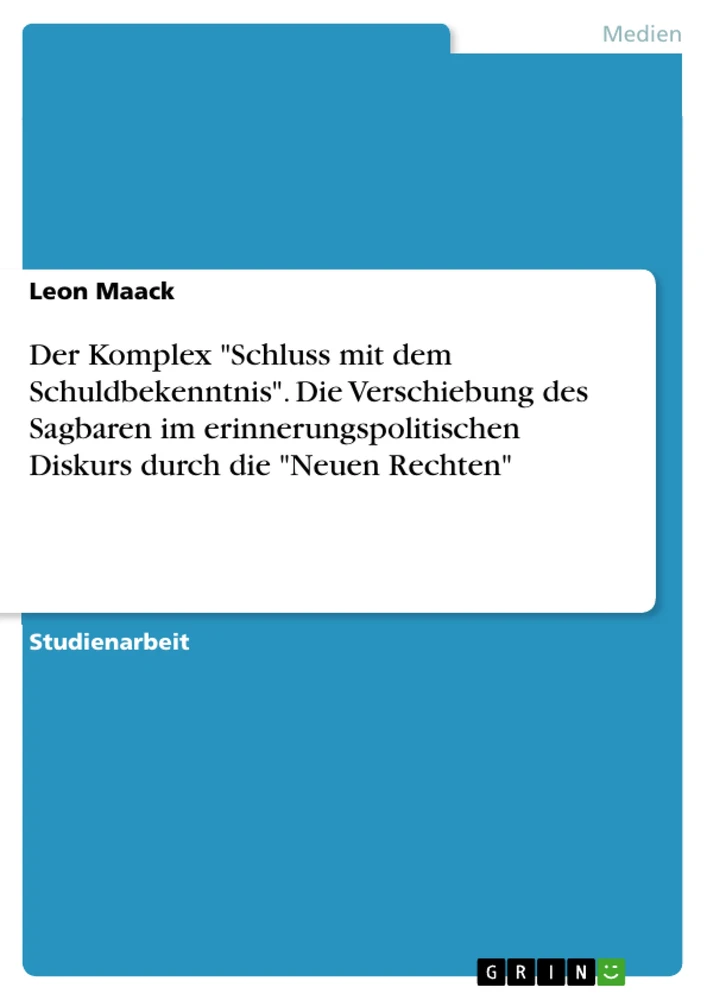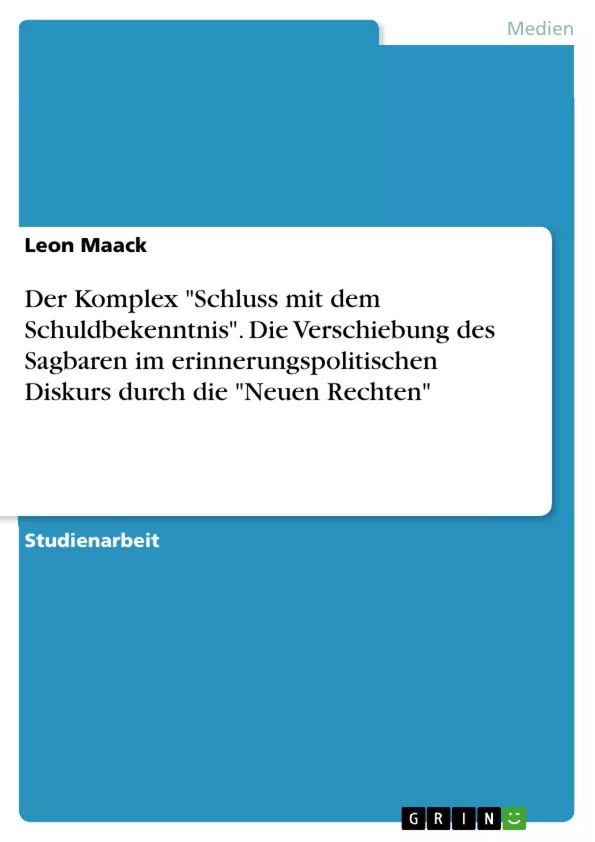Ausgehend von der viel beachteten Rede bei der "Jungen Alternative Sachsen" des AfD-Politikers Björn Höcke im Jahre 2017 ergründet diese Hausarbeit die Geschichte des sekundären Antisemitismus und der "Schlussstrich"-Forderung im bundesdeutschen Diskurs.
Auf Einladung des Verbandes Sozialistischer Studenten Österreichs hielt Theodor W. Adorno am 6. April 1967 an der Wiener Universität einen Vortrag, der im Hinblick auf die jüngsten Wahlerfolge der extrem rechten Partei Alternative für Deutschland erschreckend aktuell wirkt. Adorno attestierte den Menschen in Deutschland eine "immerwährende […] Angst um ihre Nationale Identität" und einen "Komplex Schluss mit dem Schuldbekenntnis".
Diese Diagnose scheint heute genauso auf die sogenannte "Neue Rechte" und ihren parlamentarischen Arm, die AfD, zuzutreffen. Zentral für das politische Profil der Partei sind seit der Einreise von mehr als einer Million Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 vor allem offene Xenophobie und gebetsmühlenartige Kritik an der deutschen Migrationspolitik. Mit dieser Kritik geht neben der Diffamierung der "Altparteien" auch eine Forderung nach einem patriotischen Nationalbewusstsein einher, die häufig sekundär antisemitisch ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die AfD und die Schlussstrich-Forderung
- Björn Höckes Dresdner Rede
- Martin Walsers Rede in der Paulskirche
- Richard von Weizsäckers Rede zum 8. Mai
- Die Kollektivschuldthese und deutsche Erinnerungspolitik seit 1945
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die aktuelle Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland, insbesondere im Kontext der AfD und der sogenannten „Neuen Rechten“. Er analysiert die Forderung nach einem „Schlussstrich“ mit der deutschen Vergangenheit und die Verschiebung des Sagbaren im erinnerungspolitischen Diskurs.
- Die AfD und ihr antisemitisches Potenzial
- Die „Schlussstrich“-Forderung und ihre Bedeutung im aktuellen politischen Kontext
- Die Rolle der „Neuen Rechten“ in der Verbreitung von sekundärem Antisemitismus
- Die Bedeutung von Erinnerungskultur für die Bewältigung der Vergangenheit
- Die Gefahr der Relativierung des Holocaust und die Wiederkehr von antisemitischen Stereotypen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die AfD und die Schlussstrich-Forderung: Dieses Kapitel stellt die AfD als eine Partei vor, die durch Xenophobie und Kritik an der Migrationspolitik geprägt ist. Es wird zudem der „Schuldabwehrantisemitismus“ erläutert, der sich aus der Täter-Opfer-Umkehr speist.
- Björn Höckes Dresdner Rede: Dieses Kapitel analysiert die Rede von Björn Höcke, in der er einen „Schlussstrich“ mit der deutschen Vergangenheit fordert und die Bedeutung der Erinnerungskultur in Frage stellt. Höckes Rede wird in Bezug auf Adornos These vom „Komplex Schluss mit dem Schuldbekenntnis“ eingeordnet.
- Martin Walsers Rede in der Paulskirche: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rede von Martin Walser, die ebenfalls die Forderung nach einem Schlussstrich unter das Gedenken an die NS-Vergangenheit suggerierte. Walsers Rede wird in Bezug auf die Kontroverse um den „Schlussstrich“-Diskurs beleuchtet.
- Richard von Weizsäckers Rede zum 8. Mai: Dieses Kapitel behandelt die Rede von Richard von Weizsäcker, die als ein wichtiger Beitrag zur deutschen Erinnerungspolitik gilt. Weizsäckers Rede wird als Gegenposition zur Forderung nach einem „Schlussstrich“ präsentiert.
- Die Kollektivschuldthese und deutsche Erinnerungspolitik seit 1945: Dieses Kapitel analysiert die Kollektivschuldthese im Kontext der deutschen Erinnerungspolitik. Es wird untersucht, inwiefern die Erinnerung an den Holocaust die deutsche Identität beeinflusst und wie sie im aktuellen Diskurs wiederaufgegriffen wird.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, AfD, Neue Rechte, Schlussstrich-Forderung, Erinnerungskultur, Holocaust, Kollektivschuld, Sekundärer Antisemitismus, Xenophobie, Migrationspolitik, Geschichtsklitterung, Opferrolle, Täter-Opfer-Umkehr.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die "Schlussstrich-Forderung"?
Es ist die Forderung, die intensive Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zu beenden, um ein "unbefangenes" nationales Selbstbewusstsein zu ermöglichen.
Was ist sekundärer Antisemitismus?
Diese Form des Antisemitismus entsteht nicht trotz, sondern wegen der Erinnerung an den Holocaust (Schuldabwehr), oft geäußert durch die Täter-Opfer-Umkehr.
Welche Rolle spielt Björn Höcke in diesem Diskurs?
Seine Dresdner Rede von 2017 gilt als zentrales Beispiel für die Verschiebung des Sagbaren, indem er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte.
Warum wird Martin Walsers Paulskirchenrede thematisiert?
Walser kritisierte 1998 die "Dauerpräsentation unserer Schande", was eine Debatte über die Instrumentalisierung des Holocaust und die Grenzen des Gedenkens auslöste.
Was war die Kernaussage von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985?
Er definierte den 8. Mai als "Tag der Befreiung" und betonte die Notwendigkeit des Erinnerns als Voraussetzung für Versöhnung, was heute als Gegenposition zur Neuen Rechten dient.
- Citation du texte
- Leon Maack (Auteur), 2020, Der Komplex "Schluss mit dem Schuldbekenntnis". Die Verschiebung des Sagbaren im erinnerungspolitischen Diskurs durch die "Neuen Rechten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190637