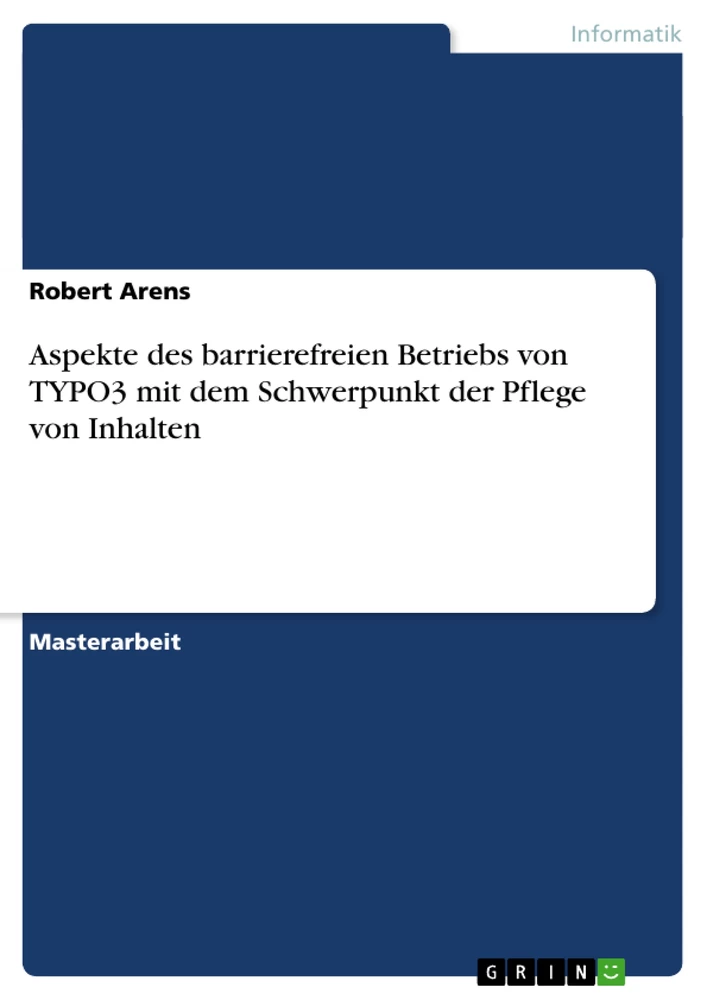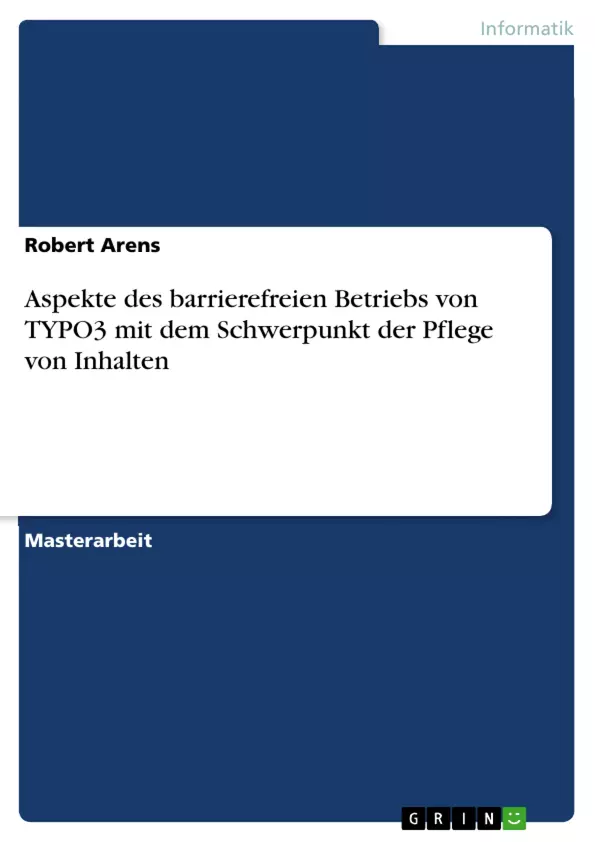Der Aufwand für die Erstellung und Pflege einer Internetpräsenz erhöht sich mit wach-sendem Umfang und steigender Aktualisierungsrate. Während Webdesinger kleinere Präsenzen lokal erstellen und im Quelltext optimieren können, werden im Umfeld größerer Umgebungen hierfür meist Content Management Systeme (CMS) eingesetzt. Diese bieten den Vorteil, dass die anfallenden Aufgaben auf entsprechend spezialisierte Personengruppen verteilt werden können. Für die Erstellung des Inhaltes sind in diesem Fall Redakteure verantwortlich. Durch ein CMS können sie ihre Aufgaben ohne Kenntnisse der zu Grunde liegenden Techniken, wie HTML oder CSS, ausführen. Die Kombination aus Verantwortung für den Inhalt sowie fehlendem Grundlagenwissen kann zu Barrieren innerhalb der Internetseiten führen. Hierdurch können Personengruppen mit bestimmten persönlichen oder technischen Einschränkungen den bereitgestellten Inhalt nicht oder nur bedingt nutzen. Dies ist zu vermeiden. Neben Gesetzen und Verordnungen, welche das Einhalten einer Barrierefreiheit für meist öffentliche Träger vorschreiben, führt der Abbau von Hindernissen zu der Erhöhung der Anzahl potenzieller Besucher. Da das primäre Ziel jeder Internetseite zunächst das Generieren von Aufmerksamkeit darstellt, tragen Aspekte der Barrierefreiheit zur Zielmaximierung bei. Für die Auswahl eines geeigneten CMS steht eine Vielzahl an kommerziellen und nicht-kommerziellen Systemen zur Verfügung. Für die nachfolgenden Betrachtungen wurde TYPO3 ausgewählt. Dieses kann aufgrund seines Funktionsumfangs als Enterprise-Lösung eingestuft werden. Durch das Open Source Lizenzmodell und seine Gestaltung als plattformunabhängige Serverapplikation ist es vielseitig und auch in nichtkommerziellen Umgebungen einsetzbar. Letztlich umgibt TYPO3 eine, vor allem in Deutschland, aktive Anwendergruppe, welche durch das Programmieren von Extensions den Funktionsumfang des Systems ständig erweitert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der Barrierefreiheit
- 2.1 Barrieregründe
- 2.1.1 Sehbehinderungen
- 2.1.1.1 Blindheit
- 2.1.1.2 Fehlsichtigkeit
- 2.1.1.3 Farbfehlsichtigkeit
- 2.1.1.4 Weitere Sehbehinderungen
- 2.1.2 Sonstige Behinderungen
- 2.1.2.1 Hörbehinderungen
- 2.1.2.2 Kognitive Behinderungen
- 2.1.2.3 Motorische Behinderungen
- 2.1.3 Weitere Barrieregründe
- 2.1.3.1 Senioren
- 2.1.3.2 Fremdsprachler
- 2.1.3.3 Technische Einschränkungen
- 2.1.1 Sehbehinderungen
- 2.2 Rahmenbedingungen
- 2.2.1 WCAG
- 2.2.1.1 W3C / WAI
- 2.2.1.2 WCAG 1.0
- 2.2.1.3 WCAG 2.0
- 2.2.2 BITV
- 2.2.2.1 Allgemeines
- 2.2.2.2 Kriterien
- 2.2.2.3 Prioritäten & Konformität
- 2.2.3 Weitere
- 2.2.3.1 ISO 9241
- 2.2.3.2 Section 508
- 2.2.3.3 Proprietäre Richtlinien
- 2.2.1 WCAG
- 2.1 Barrieregründe
- 3 Anforderungen an Inhalte
- 3.1 Texte
- 3.1.1 Gliederung von Text
- 3.1.2 Semantische Auszeichnungen
- 3.1.3 Optische Auszeichnungen
- 3.1.4 Einfache Sprache
- 3.2 Bilder und Grafiken
- 3.2.1 Auswahl
- 3.2.2 Alternativen
- 3.3 Links
- 3.3.1 Linkformen
- 3.3.2 Weitere Aspekte
- 3.4 Tabellen
- 3.4.1 Tabellen-, Zeilen- und Spaltenüberschriften
- 3.4.2 Zusammenfassungen
- 3.4.3 Optische Gestaltung
- 3.5 Formulare
- 3.5.1 Feldbeschriftung
- 3.5.2 Gruppierung
- 3.5.3 Gestaltung
- 3.6 sonstige Inhalte
- 3.6.1 Audio- und Videodateien
- 3.6.2 PDF und andere Formate
- 3.6.3 Aktive Inhalte
- 3.1 Texte
- 4 Umsetzung in TYPO3
- 4.1 Allgemeines
- 4.1.1 Abgrenzung
- 4.1.2 BITV für den TYPO3 Einsatz
- 4.1.2.1 Bedingungen für den Redakteur
- 4.1.2.2 Bedingungen an TYPO3
- 4.1.2.3 Bedingungen an sonstige Personen
- 4.2 Grundlegende Anpassungen in TYPO3
- 4.3 Extensions
- 4.1 Allgemeines
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk untersucht die Aspekte des barrierefreien Betriebs von TYPO3, wobei der Schwerpunkt auf der Pflege von Inhalten liegt. Es werden die Grundlagen der Barrierefreiheit erläutert und Anforderungen an barrierefreie Inhalte definiert. Die Umsetzung dieser Anforderungen im Content Management System TYPO3 wird detailliert beschrieben.
- Grundlagen der Barrierefreiheit und relevante Richtlinien (WCAG, BITV etc.)
- Anforderungen an barrierefreie Inhalte (Texte, Bilder, Tabellen, Formulare etc.)
- Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen in TYPO3
- Relevante TYPO3-Erweiterungen zur Unterstützung der Barrierefreiheit
- Praktische Tipps und Hinweise zur barrierefreien Gestaltung von Inhalten in TYPO3
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik des barrierefreien Webdesigns und die Bedeutung für TYPO3.
Kapitel 2 (Grundlagen der Barrierefreiheit): Definition von Barrieren für verschiedene Personengruppen (Seh-, Hör-, motorische Behinderungen, kognitive Einschränkungen, Senioren, etc.) und Vorstellung relevanter Richtlinien und Normen (WCAG, BITV, ISO 9241, Section 508).
Kapitel 3 (Anforderungen an Inhalte): Detaillierte Beschreibung der Anforderungen an barrierefreie Inhalte, einschließlich Texte, Bilder, Links, Tabellen und Formulare.
Kapitel 4 (Umsetzung in TYPO3): Praktische Anleitung zur Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen in TYPO3, einschließlich grundlegender Anpassungen und der Verwendung relevanter Extensions.
Schlüsselwörter
Barrierefreiheit, TYPO3, WCAG, BITV, Webdesign, inklusive Gestaltung, Content Management System, Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit, Semantik, Bilder, Texte, Tabellen, Formulare, Extensions.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Barrierefreiheit für TYPO3-Webseiten wichtig?
Barrierefreiheit ermöglicht Menschen mit Seh-, Hör- oder motorischen Behinderungen den Zugang zu Inhalten und steigert zudem die allgemeine Benutzerfreundlichkeit und Reichweite.
Welche Richtlinien müssen für barrierefreie Inhalte beachtet werden?
Zentral sind die internationalen WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) und die deutsche BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung).
Wie können Redakteure Barrieren in TYPO3 vermeiden?
Durch korrekte semantische Textgliederung, das Hinzufügen von Alternativtexten für Bilder und die Verwendung einfacher Sprache.
Gibt es spezielle TYPO3-Erweiterungen für Barrierefreiheit?
Ja, es existieren verschiedene Extensions, die den Funktionsumfang erweitern und Redakteure bei der Erstellung barrierefreier Inhalte unterstützen.
Was sind typische Barrieregründe im Web?
Dazu zählen Sehbehinderungen (Blindheit, Farbfehlsichtigkeit), kognitive Einschränkungen sowie technische Hürden bei der Nutzung von Hilfsmitteln wie Screenreadern.
- Citation du texte
- Robert Arens (Auteur), 2008, Aspekte des barrierefreien Betriebs von TYPO3 mit dem Schwerpunkt der Pflege von Inhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119088