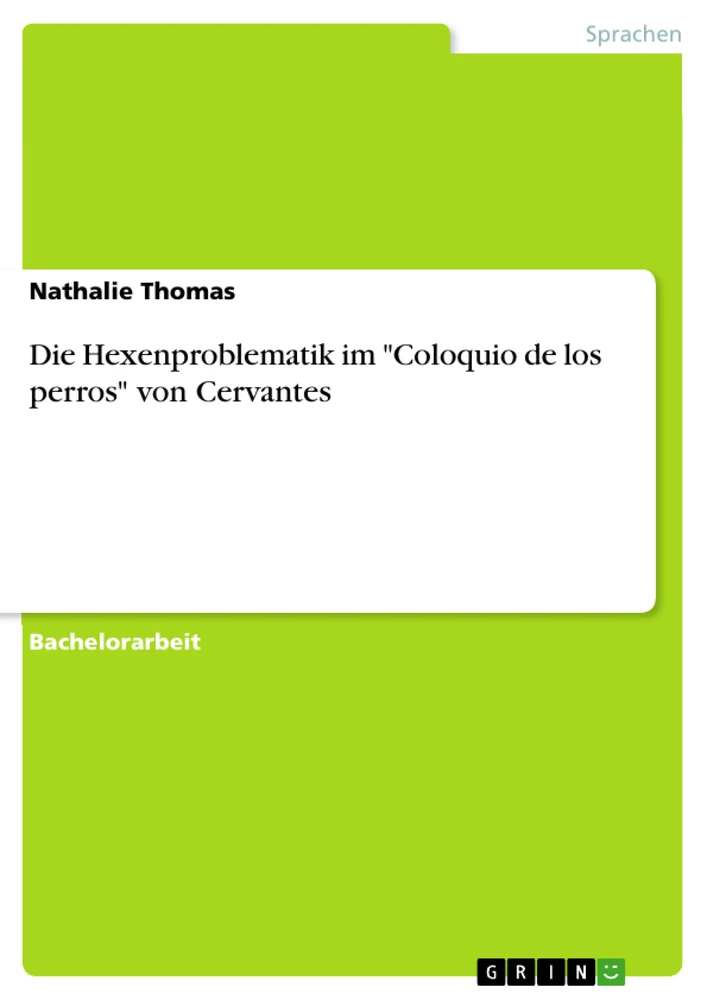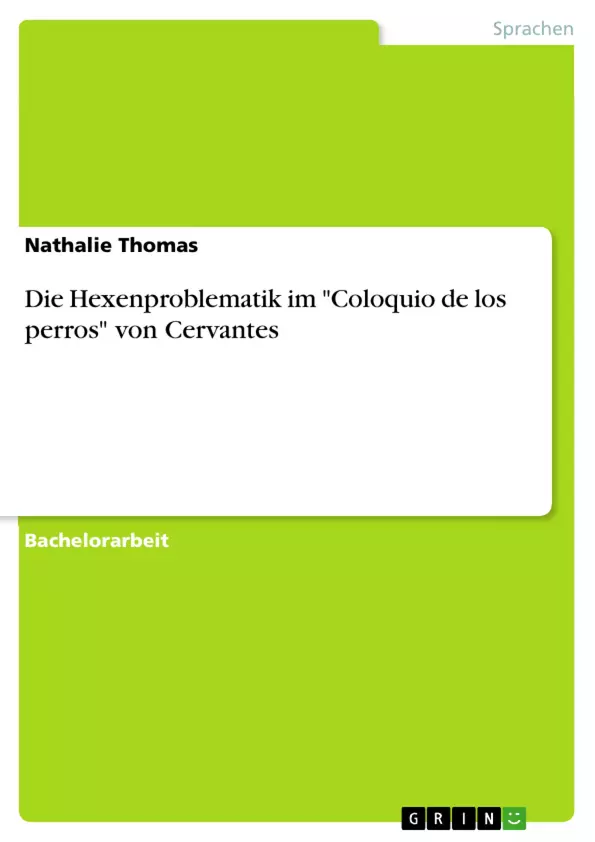Die Arbeit untersucht, welche Lehre(n) der Leser aus der zwölften "Novela ejemplar", dem "Coloquio de los perros", hinsichtlich der Hexenproblematik ziehen soll. Hierfür wird im Einleitungsteil als erstes der geschichtliche Hintergrund rund um den Hexenbegriff und die Hexenproblematik im Spanien des 16. und 17. Jahrhunderts dargestellt.
Anschließend wird kurz erläutert, wo und wie man diese Problematik bei Cervantes wiederfindet. Für die eigentliche Analyse wird dann zunächst die vorhergehende Novelle, "El Casamiento engañoso", als Rahmenerzählung des "Coloquio", sowie sein Inhalt und seine Leitmotive vorgestellt. Im Anschluss wird das "Coloquio" selbst als zentrale Quelle dieser Arbeit hinsichtlich Inhalt, Aufbau und Thematik erläutert. Schließlich wird dann die Hexenszene als Schlüsselszene der Novelle behandelt und im Sinne der Fragestellung analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I - Einleitung
- 1. Historische und literarische Einordnung der Novelle
- a. Cervantes und die Novelas ejemplares
- b. Das Konzept der Hexerei: Teufelspakt, Ziegenbock, Hexensabbat, Salbung, Verwandlung
- c. Magie und Hexerei in Spanien im 16. und 17. Jahrhundert
- d. Magie und Hexerei bei Cervantes
- 1. Historische und literarische Einordnung der Novelle
- Teil II - Analyse
- 2. El casamiento engañoso als Rahmenhandlung des Coloquio de los perros
- 3. El coloquio de los perros
- a. Inhalt, Aufbau, Thematik der Novelle
- b. Die Hexen von Montilla
- c. Das Konzept der Hexerei im Coloquio de los Perros.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hexenproblematik in Miguel de Cervantes' Novelle "Coloquio de los perros". Sie befasst sich mit der historischen und literarischen Einordnung der Novelle im Kontext des Siglo de Oro und dem Hexenglauben des 16. und 17. Jahrhunderts in Spanien. Die Arbeit beleuchtet, wie Cervantes das Konzept der Hexerei in seine Novelle integriert und welche Lehre der Leser in Bezug auf die Hexenproblematik ziehen soll.
- Die literarische und historische Einordnung der Novelle "Coloquio de los perros" im Kontext der Novelas ejemplares und des Siglo de Oro.
- Die Analyse des Hexenkonzepts in der Novelle und seine Verbindung zu den zeitgenössischen Vorstellungen von Magie und Hexerei in Spanien.
- Die Untersuchung der Rolle der Hexenszene in "Coloquio de los perros" und ihre Bedeutung für die Gesamtgeschichte.
- Die Interpretation von Cervantes' Intentionen und seiner Positionierung im Hinblick auf das Übernatürliche und die Hexenproblematik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine historische und literarische Einordnung der Novelle und beleuchtet das Konzept der Hexerei im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien. Sie untersucht die spezifische Verwendung dieses Konzepts bei Cervantes.
Der Analyseteil befasst sich zunächst mit der Rahmenhandlung "El casamiento engañoso" und widmet sich dann dem "Coloquio de los perros" selbst. Er analysiert Inhalt, Aufbau und Thematik der Novelle und untersucht die Rolle der Hexenszene als Schlüsselstelle der Geschichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: "Coloquio de los perros", Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, Hexenproblematik, Magie, Hexerei, Teufelspakt, Hexensabbat, Siglo de Oro, Spanien.
Häufig gestellte Fragen
Wie thematisiert Cervantes Hexerei im "Coloquio de los perros"?
In der zwölften "Novela ejemplar" integriert Cervantes eine zentrale Hexenszene, um zeitgenössische Vorstellungen wie den Teufelspakt und den Hexensabbat zu verarbeiten.
Welches Hexenkonzept herrschte im Spanien des 16./17. Jahrhunderts?
Es war geprägt von Vorstellungen über magische Salbungen, Verwandlungen und Versammlungen mit dem Teufel (Ziegenbock-Motiv), die Cervantes literarisch aufgreift.
Was ist die Rolle der Rahmenhandlung "El Casamiento engañoso"?
Sie bildet den erzählerischen Rahmen, in dem die sprechenden Hunde ihre Geschichte und damit auch die Begegnung mit den Hexen von Montilla präsentieren.
Welche Lehre soll der Leser aus der Hexenproblematik ziehen?
Die Arbeit analysiert, inwieweit Cervantes das Übernatürliche kritisch hinterfragt und welche moralischen oder sozialen Botschaften hinter der Darstellung der Hexerei stehen.
Wie ordnet sich das Werk in das "Siglo de Oro" ein?
Es ist Teil der "Novelas ejemplares", in denen Cervantes versucht, Unterhaltung mit moralischer Belehrung und einer Reflexion der spanischen Gesellschaft zu verbinden.
- Quote paper
- Nathalie Thomas (Author), 2019, Die Hexenproblematik im "Coloquio de los perros" von Cervantes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191127