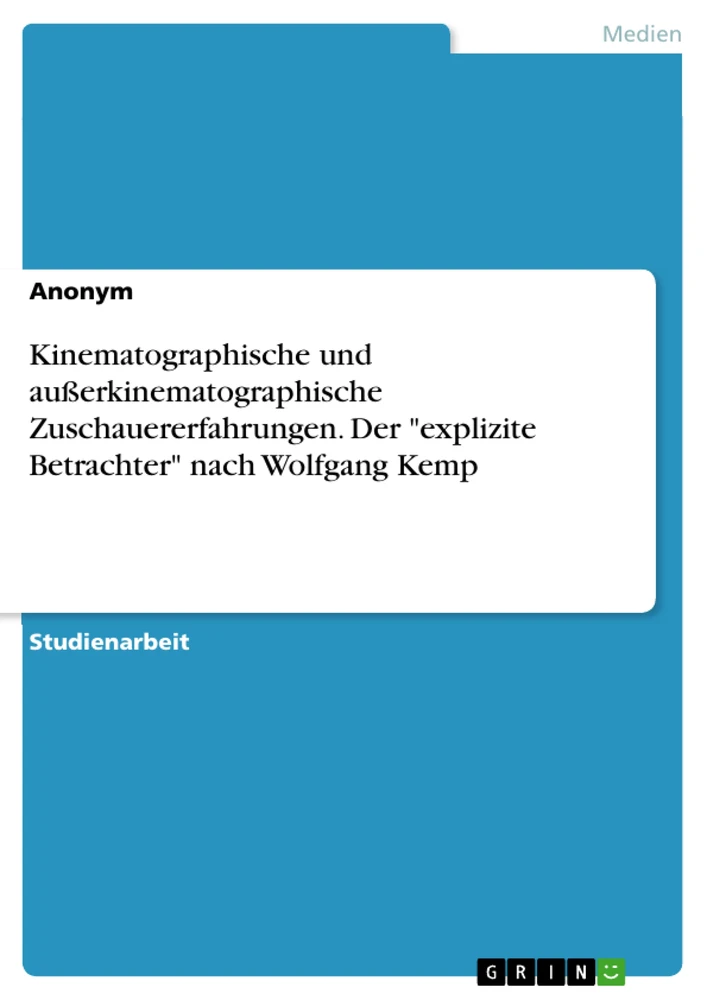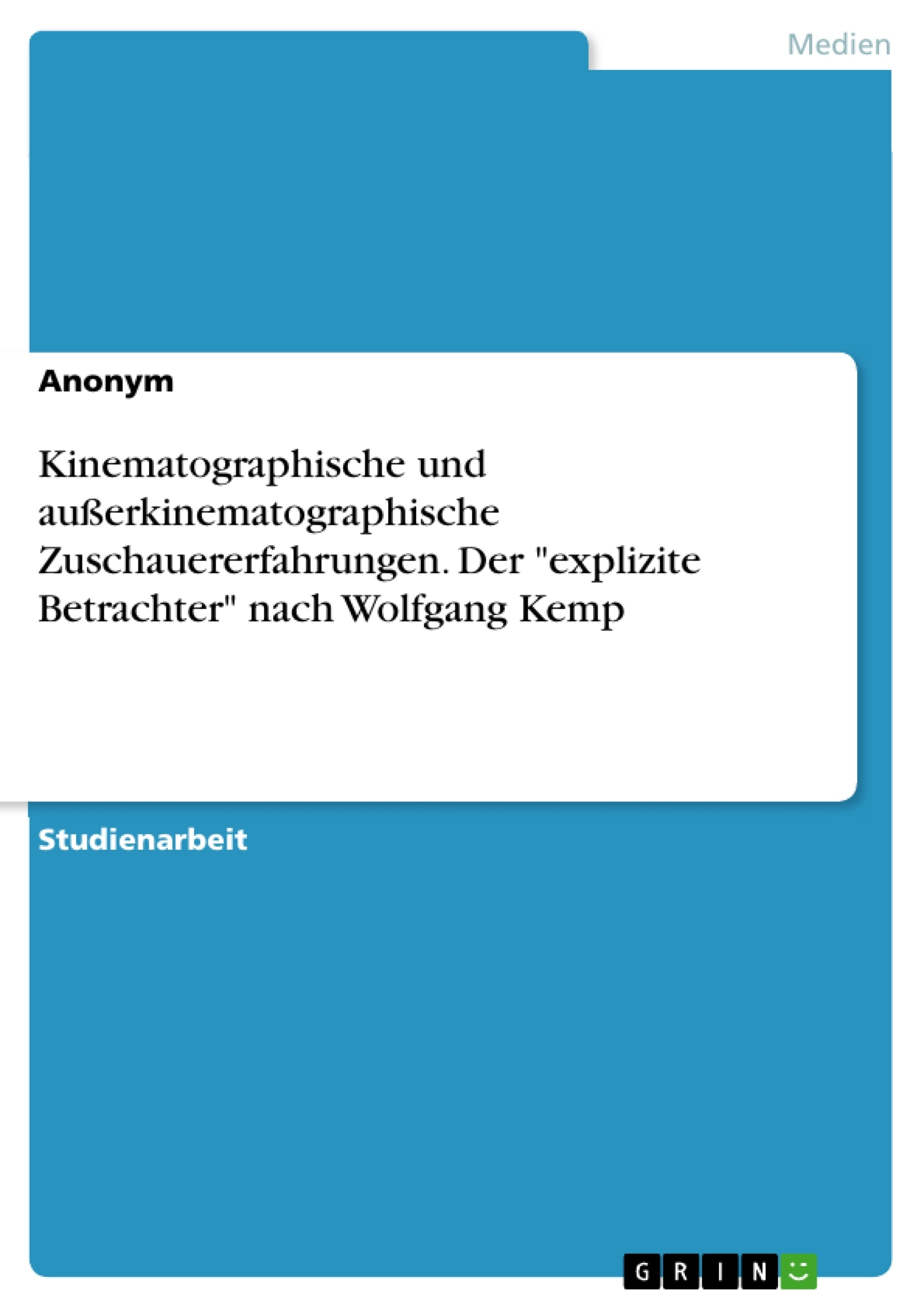Die folgende Ausarbeitung soll sich mit der Frage beschäftigen, ob und wenn ja wann und wie es in der kinematographischen Historie eine rezeptionsästhetische Auseinandersetzung mit dem Rezipienten implizit, aber vor allem auch explizit, wie Wolfgang Kemp den expliziten Betrachter formuliert, gibt.
Im Bereich der Literatur wurden erst Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts rezeptionsästhetische Ansätze mit Iser und Jauß und der Konstanzer Schule geprägt, indem die Fragen Wie hat man im neunzehnten Jahrhundert gelesen? und Wie sehen andere Autoren einen bestimmten Text? oder Wie sehen verschiedenen einen bestimmten Text?, also eine Hinwendung zum Erkenntnisinteresse des Lesers/Rezipienten, ausgerichtet wurden. Doch diese literarhistorische neue Art, ein Werk als dialogisch und mit dem Interesse an den Gedanken des Lesers zu analysieren, wurde auch die Möglichkeit für andere Künste, ihre rezeptionsästhetische Grundkonzeption zu reflektieren. Besonders deutlich wurde dies in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als in der klassischen Kunst, der Bildenden Kunst, eine neue Art des Zuschauers/Betrachters installiert wurde, nach Wolfgang Kemp der sogenannte explizite Betrachter. Kemp versteht hierunter einen Betrachter/Rezipienten, der das Werk durch einen Eigenbeitrag vollendet; hierauf wird jedoch unter 2.1. noch genauer eingegangen. Dieser werkvollendende Betrachter nach Kemp gibt es also in der Kunst ab den 60ern des 20. Jahrhunderts zu prognostizieren, jedoch stellt sich hier die Frage, ob Kemps Theorie des expliziten Betrachters nicht auch in anderen Kunstgattungen - wie z. B. der Kinematographie - aufzufinden bzw. auf andere Kunstgattungen anzuwenden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Kino und sein Zuschauer – implizit passiv oder explizit aktiv?
- Der explizite/implizite Betrachter nach Kemp: eine theoretische Einführung
- Kinematolgraphische Zuschauertheorien nach Hanich und Pauleit
- Der implizite Kinozuschauer: Theorie und Praxis
- Das Kino der Attraktionen nach Gunning
- Das Kino der Narrativität nach Gaudreault
- Der fraktale Zuschauer der Moderne nach Åkervall
- Der explizite Kinozuschauer: Theorie und Praxis
- Der Ausstellungsfilm oder die Filmausstellung
- Der interaktive Dokumentarfilm
- Zwischen implizit und explizit: der Haptische Raum nach Benjamin
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die kinematographische Geschichte und beleuchtet, ob und inwiefern es in der Rezeptionsästhetik eine Auseinandersetzung mit dem Rezipienten, sowohl implizit als auch explizit, gibt. Sie untersucht die Relevanz der Theorie des expliziten Betrachters nach Wolfgang Kemp im Kontext des Films und beleuchtet die Frage, ob und wie diese Theorie auf andere Kunstgattungen anzuwenden ist.
- Die Entwicklung des Kinozuschauers in Theorie und Praxis
- Die Rolle des expliziten Betrachters in der kinematographischen Historie
- Die Integration von Film in die Bildende Kunst und das Museum
- Die Verfransungstendenz der Künste und die Beziehung zwischen Bildender Kunst und Film
- Die Frage nach der Rezeption und dem Erkenntnisinteresse des Zuschauers/Betrachters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Entstehung der rezeptionsästhetischen Ansätze in der Literatur und deren Anwendung auf andere Kunstgattungen, insbesondere den Film. Die Einleitung diskutiert die Etablierung des Films als Bildende Kunst und analysiert die Rolle des expliziten Betrachters in der zeitgenössischen Kunst nach Kemp.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Kino und seinem Zuschauer. Es analysiert die Theorie des expliziten und impliziten Betrachters nach Kemp und setzt diese in Bezug zu kinematographischen Zuschauertheorien. Das Kapitel untersucht die Entwicklung des impliziten und expliziten Kinozuschauers anhand verschiedener kinematographischer Phänomene wie dem Kino der Attraktionen, dem Kino der Narrativität und dem fraktalen Zuschauer der Moderne.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie den expliziten und impliziten Betrachter, kinematographische Zuschauertheorien, das Kino der Attraktionen, das Kino der Narrativität, der fraktale Zuschauer der Moderne, der Ausstellungsfilm, der interaktive Dokumentarfilm, die Verfransungstendenz der Künste und die Beziehung zwischen Bildender Kunst und Film. Zudem stehen Themen wie Rezeptionsästhetik, Erkenntnisinteresse, Interaktivität und das Museum im Fokus der Arbeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Kinematographische und außerkinematographische Zuschauererfahrungen. Der "explizite Betrachter" nach Wolfgang Kemp, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191281